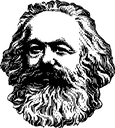Inhaltsverzeichnis
Textbeiträge 2017
An dieser Stelle veröffentlichen wir Texte und Debattenbeiträge. Einen XML Feed für aktuelle Texte und Termine stellen wir unter https://i-v-a.net/feed bereit.
Dezember
Im Gespräch mit, über oder gegen rechts
Gegen rechts wird auch pädagogisch einiges unternommen – das war bei IVA bereits im Juni Thema (siehe „Pädagogik gegen rechts“, Texte2017). Man soll ins Gespräch kommen, heißt es neuerdings, dabei aber schwer aufpassen, mit wem man es zu tun hat und wie stilvoll die Diskussion ist. Dazu ein Kommentar von Johannes Schillo.
Zuletzt rief der Bundespräsident in Dresden bei einer Veranstaltung der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung dazu auf, Rechtsextremismus in der Gesellschaft klar zu benennen, wobei „die Wiedergewinnung der Gesprächsfähigkeit“ und vor allem das „direkte Gespräch“ jenseits aller sozialen Netzwerke wichtig sei (vgl. Schillo 2017). Denn, so Steinmeier, es gebe leider „keine Gespräche miteinander. Alles, was inhaltlich dringend notwendig wäre, diese demokratische Kontroverse, findet nicht statt.“ Woran auch immer er das Versagen der Auseinandersetzung festmachen mag, in einem kann man ihm zustimmen: Radikale rechte Stimmen werden, sofern sie nicht im etablierten Parteienspektrum ihren Platz haben, als Extremismus ausgegrenzt – und dies ganz sachgemäß, da „Demokraten (Neo-)Faschisten nicht kritisieren, sondern nur verbieten können“ (Huisken 2012, 18).
Freerk Huisken hat diese These bereits in mehreren Veröffentlichungen ausgeführt, nicht als Angriff auf eine intellektuelle Schwäche, eine verminderte Kritikfähigkeit der etablierten Politik, sondern als sachlicher Nachweis, dass rechte und demokratische Positionen in den Essentials vom Volk und seiner Gemeinschaft, von seiner nationalen Identität und dem Staat, der ihr verpflichtet ist, erst einmal übereinstimmen und sich daher bei der inhaltlichen Abgrenzung schwer tun. Nationalismus ist bei beiden die gemeinsame Basis, doch heißt er nur im ersten Fall so, im andern ist er als Patriotismus oder Vaterlandsliebe ein ehrenwertes Anliegen, das mit der aggressiven Variante, die das Ausland und die Ausländer schlecht macht, nichts zu tun haben soll; das vielmehr als Bejahung der eigenen Nation, inklusive Gefühlsbindung, Stolz und Heimatliebe, das Selbstverständlichste von der Welt sein soll.
Woher der Ausgrenzungsbedarf rührt und wie er im pädagogischem Feld auftritt, ist auch Thema der neuen Arbeitshilfe „Gegen Rechts argumentieren lernen“ von Rolf Gloël, Kathrin Gützlaff und Jack Weber (2017). Die Publikation bietet in der Hauptsache einen Argumentationsleitfaden, der unmittelbar für die Bildungspraxis verwertbar ist. Im Weiteren geht es um „Wege und Holzwege politischer Bildung gegen Rechts“ sowie um die Frage, worin der Rechtsruck eigentlich besteht, was seine Gründe sind und wie er aus offiziellem Blickwinkel interpretiert wird. Warum sich Menschen rechten politischen Orientierungen und Organisationen anschließen, wird anhand gängiger Erklärungen („Angst“, „Soziale Unzufriedenheit“, „Einfache Lösungen“, „Unzufriedenheit mit den Eliten“, „Populismus und Rattenfängerei“) untersucht und mit Gegenthesen der Autoren konfrontiert. Dann wird thematisiert, wie die etablierte Politik auf den Rechtsruck reagiert. Dabei kommen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den staatstragenden und den Parteien des rechten Randes zur Sprache (vgl. dazu auch Bernhardt/Gospodarek 2017).
Ausgrenzen oder drüberstehen?
Gerade die inhaltlichen Gemeinsamkeiten, die sich bei den zentralen Punkten finden, machen die Auseinandersetzung mit rechten Positionen zu einer besonderen Herausforderung. Wer sich mit diesen anlegen will, stößt schnell auf die Prinzipien, die der nationalstaatlichen Verfassung des heutigen Kapitalismus zugrunde liegen und die gar nicht exklusives Merkmal eines leicht ausgrenzbaren rechten Weltbildes sind. Deshalb hat sich das gängige Verfahren etabliert, rechte Standpunkte dadurch zu desavouieren, dass man sie nicht inhaltlich kritisiert, sondern auf Grund formaler Kriterien als extremistisch charakterisiert oder hinter ihrer Äußerung nach – untragbaren, eben extremen – Absichten fahndet, also etwa am Beispiel der AfD den wahren, nämlich nationalsozialistischen Plan dieser Biedermänner enthüllt, den sie vor dem Publikum verbergen. Ein einschlägiges Beispiel aus der neueren Diskussionskultur haben jüngst die NachDenkSeiten aufgegriffen, nämlich den Hype, den das Buch „Mit Rechten reden“ (Leo u.a. 2017) in der Presse erfahren hat.
„Dieses Buch sprüht förmlich vor Geist und Witz“, hieß es in der Zeit (19.10.2017), auch die taz oder der Freitag (5.10.2017: „Alles hat seine Zeit. Dieses Buch gilt unserer.“) waren beeindruckt. Die FAZ hielt es für überschätzt, die Süddeutsche (SZ, 12.10.2017) aber meinte: „Ein Werk zur rechten Zeit… das Buch der Stunde“. Die NachDenkSeiten sahen das anders. Dort schrieb Paul Schreyer (2017), der Leitfaden zeige den typisch abgehobenen und selbstgerechten Ton einer Pseudo-Auseinandersetzung, die „Unfähigkeit, konträren Positionen inhaltlich zu begegnen. Die Autoren erklären genau das sogar zur besonderen Qualität ihres Werks: mit den geistigen Niederungen der Argumente mögen sich andere befassen, wahre Intellektuelle beleuchten dagegen die Meta-Ebene, die ‚Art des Redens‘. Zwar kritisieren auch sie stumpfes Lagerdenken und die Selbstgerechtigkeit auf beiden Seiten, vor allem aber geht es ihnen darum, im Spiegelsaal der Eitelkeiten kunstvolle Pirouetten der eigenen Klugheit zu drehen.“ In der Tat, den Zweifeln an der Leistung des Buches ist zuzustimmen.
So heißt es schon im Klappentext, dass es bei der ins Auge gefassten Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Neuen Rechten „um mehr geht als die Macht des besseren Arguments. Es geht vor allem um die Kunst, weniger schlecht zu streiten“. Es geht streng genommen gar nicht um Argumentation, sondern um die Belebung oder Kultivierung einer Streitkultur, die sich von den inhaltlichen Positionen, die dem Streit zu Grund liegen, freimachen soll. Ihr Konzept begründen die Autoren in der Einleitung so: „Wir begreifen als ‚rechts‘ keine eingrenzbare Menge von Überzeugungen oder Personen, sondern eine bestimmte Art des Redens… Fast alle ‚rechten‘ Phänomene, mit denen wir es derzeit zu tun haben, lassen sich als Formen der Rede auffassen…“ (Leo u.a. 2017, 12). Die Auseinandersetzung zwischen Rechten und Nicht-Rechten wird auf die persönliche Ebene verlagert, als ein „Beziehungsproblem“ gedeutet, zu dessen Bearbeitung eigentlich ein „Paartherapeut“ vonnöten wäre (ebd., 23f). Ganz in diese Rolle schlüpfen wollen die Autoren nicht. Da sie sich selbst als (Mit-)Betroffene sehen, beanspruchen sie für sich nicht direkt die über den Parteien stehende Neutralität eines Therapeuten – einerseits jedenfalls. Andererseits sind sie entschieden dagegen, sich im Links-Rechts-Schema zu verorten; sie betrachten sich als eine Art Schiedsrichter oder Moderator, der über beiden Extremen steht. Gar nicht leiden können sie es, wenn die Linke „rechtes Gedankengut“ (ebd., 24) identifiziert und dagegen vorgeht; dann wird ihnen regelrecht übel. In diese Kontroverse wollen sie sich nicht einmischen, sie betrachten sie von außen als ein „Sprachspiel“ (ebd., 28), dessen Verfahrensweisen sie nachsteigen und das man, so der Duktus des Buches von der ersten bis zur letzten Zeile, auch mal mehr von seiner spielerischen Seite nehmen sollte. Mit Humor geht bekanntlich alles besser.
Diese Pseudo-Auseinandersetzung ist typisch für eine Reihe von Veröffentlichungen, die von sich behaupten, auf die Möglichkeiten von Diskurs und Kritik zu setzen. Die Argumentationshilfe von Jürgen Beetz z.B., die sich ebenfalls explizit auf der Ebene der Sprachkritik bewegt, spricht das Prinzip einer solchen Herangehensweise offen aus: „Ein Vorteil der sprachlichen Analyse ist natürlich auch, dass ich auf sachlich-inhaltliche Argumente weitgehend verzichten kann (und muss).“ (Beetz 2017, 19) Das ist genau das, was die NachDenkSeiten als die Überheblichkeit einer Metaebene kennzeichneten: Man lässt sich mit ausgegrenzten Rechten nicht auf eine inhaltliche Kontroverse ein, sondern bestreitet ihnen, dass sie als Neofaschisten das Recht haben, ehrenwerte Titel wie Volk, Nation und Heimat zu ihren Anliegen zu erklären. Verwunderlich ist nur, dass Veröffentlichungen wie die von Leo und Co., die sich ganz abgebrüht der Kontroverse entziehen, aus entschieden antifaschistischer Perspektive als verständnisvolles Zugehen auf die Rechten genommen werden.
Kay Sokolowsky hat sich in einem Frontalangriff auf die „neue Volkspädagogik“ über die Idee ereifert, man könnte „mit Nazis reden“ (Sokolowsky 2017, 20f). Die „Alternativdeutschen“, die neue Bewegung von AfD, Pegida und Co. samt ihrer „Vordenker“ und „Intellektuellen“, seien trotz ihrer Dementis das, „was sie belegbar und untereinander offenherzig sind: Nazis.“ Und von denen sei klar: „Sie entziehen sich jeder rationalen Diskussion.“ Mit Nazis lässt sich eben „nicht reden, denn die hören gar nicht zu.“ Ja mehr noch, „diese Unterentwickelten sind durch keinen Appell an Vernunft und Gemeinsinn zu erreichen, geschweige denn zu erweichen.“ Man müsse nämlich, wie es Sebastian Haffner schon 1940 tat, das „Psychopathische der Parteigenossen“ in Rechnung stellen: Es ist nicht nur die mangelnde Bereitschaft zum Zuhören – die man ja auch von anderen Zeitgenossen kennt –, es ist der „autoritäre Charakter“ dieser Unterentwickelten. Sokolowsky würde sich wohl auch nicht scheuen, von Untermenschen zu reden. Jedenfalls ist für ihn klar: „Es kann und darf … keine Verständigung mit Unmenschen“ geben. Also kommt es auch gar nicht auf den Versuch an, ob sie sich ein Argument anhören oder nicht. Argumente kennt Sokolowsky zudem nur als „Fakten“, die man den Rechten entgegenhält (wahrscheinlich unter Berufung auf die Arbeitsmarkt- oder Kriminalstatistik), die diese aber als „notorische Schwindler“ mit ihren eigenen „Fakes“ kontern.
Wo Sokolowsky sich auf den Leitfaden von Leo, Steinbeis und Zorn einlässt, trifft er durchaus einzelne Mängel. So behaupten die drei Sprachspezialisten allen Ernstes, dass die Radikalisierung von Rechten das Ergebnis einer missglückten Gesprächssituation sei. „Wenn ich sehe“, zitiert Sokolowsky Ko-Autor Leo nach einem Interview mit der SZ, „wie zivilisierte Rechte höflich ihre Standpunkte darstellen und dann Nichtrechte in herablassender, moralistischer Form mit Nazi-Vorwürfen kommen – ist doch klar, dass sich viele Zuschauer irgendwann mit diesen Rechten solidarisieren…“ Man wird also rechts, weil man sich für eine verfolgte Minderheit einsetzt! Mit deren Inhalten soll es nichts zu tun haben. Leider muss man Leo und Co. aber auch konzedieren, dass Sokolowsky mit seinen Tiraden ein Musterbeispiel dafür abgibt, wie Linke in „enthumanisierender Weise“ und „pauschal disqualifizierend“ von den Rechten reden.
Oder argumentieren?
Dieser antifaschistische Furor macht natürlich auch Front gegen eine inhaltlich Stellung nehmende Argumentation, wie sie seit Ende der 1980er Jahre von Huisken (vgl. Huisken 1987) und nachfolgend für die politische Bildung vor allem von den Erwachsenenpädagogen Klaus Ahlheim (vgl. Ahlheim u.a. 1993) und Klaus-Peter Hufer (vgl. Hufer 2000) ausgearbeitet wurde. Hufers „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ avancierte zu einem Klassiker, ja zu einem regelrechten Bestseller, dessen Verfahren seinerzeit sogar die Bildzeitung adaptieren wollte, was der Autor aber ablehnte (zur inhaltlichen Kritik vgl. Huisken 2012, 192ff). Man hat übrigens den Eindruck, dass Leo, der sich selber als „Bestsellerautor“ bezeichnet, mit seinen Kollegen auf solche Erfolgsmöglichkeiten gespechtet hat. Der Einstieg ihres Leitfadens beginnt genau wie bei Hufer mit den Gesprächsblockaden, die engagierte Demokraten in der Begegnung mit Rechten erleben und die Thema einer Selbstreflexion werden sollen (Leo u.a. 2017, 18). Hufers Seminarkonzept eines Argumentationstrainings macht die Gesprächskonstellation – worin sein deutlicher Mangel besteht (vgl. Schillo 2017) – zur Hauptsache. Leo und Co. haben dem im Grunde nicht viel Neues hinzugefügt, sondern eher das bekannte Bestsellerrezept befolgt, das nachzuahmen, was bereits Erfolg hatte. Rhetorische und andere Fitness für Gesprächssituationen kann man jedenfalls in Hufers Seminaren besser lernen als anhand der Sprüche und Geistesblitze, die Leo und Co. zu bieten haben.
Es gibt natürlich auch Veröffentlichungen, die sich mit den Inhalten der Rechten auseinandersetzen, so z.B. das neue Handlexikon von Klaus Ahlheim und Christoph Kopke (2017), das die verschiedenen Spielarten des rechten Radikalismus erfassen und analysieren will, sich auch als Handreichung für die pädagogische Arbeit versteht. Hier hat Hufer einen aktuellen Beitrag zur Bedeutung des Argumentationstrainings beigesteuert, der sich zunächst deutlich vom erwähnten Gesprächs-Leitfaden absetzt. Hufer beginnt seinen Lexikonartikel mit dem Verweis auf die Parole „Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ (Ahlheim/Kopke 2017, 17f). Sie hat sich in den Seminaren als der eindeutige Spitzenreiter herausgestellt und auch in dem Buch von Gloël und Co. spielt sie eine prominente Rolle (siehe Gloël u.a. 2017, 141ff). So wird der Focus bei Hufer gleich auf den politischen Gehalt gerichtet – dem Ansatz politischer Bildung entsprechend, wie ihn Ahlheim in dem Lexikon vorstellt. Politische Bildung, so seine Feststellung, „will Einstellungen, Orientierungen, Überzeugungen problematisieren, korrigieren und neues politisches Denken und Handeln ermöglichen“ (Ahlheim/Kopke 2017, 110f). Ahlheim kommt zudem auf einen entscheidenden Punkt zu sprechen, nämlich auf die Notwendigkeit, dass eine solche Bildungsarbeit „auch die ökonomische Realität in Zeiten des Marktradikalismus thematisieren und soziale Ungleichheit problematisieren“ muss. Das trifft zu. Es ist ja kein Zufall, dass der Spruch über die Arbeitsplätze eine Spitzenposition einnimmt. Ein Nationalist und Ausländerfeind macht sich zwar nicht die soziale Frage zum Anliegen, aber er bezieht sich mit seiner nationalen Deutung auf die marktwirtschaftlichen Lebensumstände, die ihm oder seinen Volksgenossen zu schaffen machen und die eine existenzielle Herausforderung darstellen. Darin liegt eben die Wucht dieser Vorurteile, dass sie sich nicht einfach wie andere vorgefasste Meinungen, die aus zufälligen Irrtümern entstehen, rasch überprüfen und korrigieren lassen.
Bei Hufer kommt allerdings auch wieder eine grundlegende Skepsis im Blick auf den Sinn des Argumentierens zur Sprache. Die Stammtischparole sei ein „Stellvertreterbegriff für eindeutige weltanschauliche, vorzugsweise politische Botschaften, für platte Sprüche und für aggressive Rechthabereien“ (ebd, 17). Er hebt hervor, dass sie „trotz der Schlichtheit ihres Gehalt … nicht einfach spontan zu widerlegen“ sei. Trotz ihrer Plattheit, also ihrer intellektuellen Dürftigkeit, soll man ihr nur schwer beikommen – eigentlich eine rätselhafte Auskunft! Wenn man mit ihr konfrontiert werde, gerate man „sofort in die Defensive. Denn die Sprüche sind plötzlich und unerwartet da, selten ist man auf sie vorbereitet“. Die Parolenverkünder wollten „proklamieren und provozieren, agieren und aggressiv sein“. Schlüssig ist das nicht, denn wer Parolen auf Wahlplakaten oder in den Social Media verkündet, will ja überzeugen, Anhänger finden und nicht einfach die Adressaten vor den Kopf stoßen. Und leider verfängt das in Deutschland und anderswo bei vielen der so genannten besorgten Bürger, die sich mit ihren Sorgen von den rechten Parolen angesprochen fühlen.
Bei Hufer heißt es: „Gegen vorurteilsbeladene, autoritäre Ressentiments richten mit Vernunft vorgetragene Argumente zunächst einmal nicht viel aus.“ Konsequenter Weise sucht auch sein Fazit eigentlich nur eine Reihe von (Trost-)Gründen dafür, das Argumentieren nicht ganz aufzugeben. Er hält eingangs fest: „Erstens ist es ein gutes Gefühl, den Mund aufgemacht und nicht schicksalsergeben dabei gesessen zu haben“. (Ebd., 18) Das geht eher in Richtung „Selbstbestätigung“ und „Selbstbehauptung“, die Hufer sonst der anderen Seite vorwirft. Und so wird auch Arno Schmidts Kalauer, Diskussionen hätten lediglich den Wert, dass einem hinterher die besseren Argumente einfallen, noch einmal aufgewärmt. Dann heißt es, man müsste „wirkungsvolle Gesprächsstrategien“ erlernen, um sich Aufmerksamkeit und Gehör zu verschaffen, was eher an die vorgestellte Sprachkritik erinnert. „Und achtens schließlich wird man ja – trotz mancher Zweifel – noch weiter von der Kraft der Aufklärung und der Vernunft überzeugt sein dürfen“. Ja, man darf, doch klingt das ziemlich wie das Pfeifen im Walde…
Literatur
- Klaus Ahlheim u.a., Argumente gegen den Hass – Über Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Arbeitshilfen für die politische Bildung. Zwei Bände. Bonn 1993.
- Klaus Ahlheim/Christoph Kopke (Hg.), Handlexikon Rechter Radikalismus. Ulm 2017.
- Jürgen Beetz, Auffällig feines Deutsch – Verborgene Schlüsselwörter eines Parteiprogramms. Aschaffenburg 2017.
- Frank Bernhardt/Rudolf Gospodarek, Rechte „Argumente“ widerlegen! In: hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg, Nr. 11, 2017, S. 45-47.
- Klaus-Peter Hufer, Argumentationstraining gegen Stammtischparolen – Materialien und Anleitungen für Bildungsarbeit und Selbstlernen. Schwalbach/Ts. 2000.
- Freerk Huisken, Ausländerfeinde und Ausländerfreunde – Eine Streitschrift gegen den geächteten wie den geachteten Rassismus. Hamburg 1987.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012.
- Rolf Gloël/Kathrin Gützlaff/Jack Weber, Gegen Rechts argumentieren lernen. Aktualisierte Neuausgabe. Hamburg 2017.
- Per Leo/Maximilian Steinbeis/Daniel-Pascal Zorn, Mit Rechten reden – Ein Leitfaden. 4. Auflage, Stuttgart 2017.
- Johannes Schillo, Das „direkte Gespräch“ – mit, über, gegen rechts? Auswege-Magazin, 24. November 2017, http://www.magazin-auswege.de/2017/11/das-direkte-gespraech-mit-ueber-gegen-rechts/.
- Paul Schreyer, Kontaktverlust oder: Wenn unbequeme Bücher „verschwinden“. NachDenkSeiten, 8.11.2017, http://www.nachdenkseiten.de/?p=40961.
- Kay Sokolowsky, Auf kein Wort – Mit Nazis reden? Zurückweisung einer Zumutung. In: Konkret, Nr. 12, 2017, S. 20-21.
November
„Marx is back“, Vol. 9
Marx hatte in der Hauptsache zwei Erben, die Sozialisten/Sozialdemokraten und die Marxisten-Leninisten. Beide sind (bzw. waren) in der Brauchtumspflege engagiert – und werden damit natürlich durch das jüngste Marx-Jubiläum herausgefordert. Dazu einige Informationen der IVA-Redaktion.
Die chinesische KP reagierte rasch und bot der Stadt Trier Ende 2016 das Geschenk einer überlebensgroßen Marx-Statue an, die sogar die Porta Nigra, das Wahrzeichen der Stadt, zu überragen drohte. Nach einigen Kontroversen im Stadtrat – Grüne und AfD sprachen sich gegen die Annahme des Geschenks aus – fiel die Entscheidung, das Angebot anzunehmen und die Skulptur in einer kleineren Ausführung (neue Gesamthöhe jetzt: 5,50 Meter) aufzustellen. Letzter Stand vom 28. September 2017: Der Stadtrat fasste „mit großer Mehrheit den Baubeschluss für die Statue. Die Kosten für die Herstellung, den Transport und die Verankerung der Staute sowie für die Herstellung und Errichtung des Sockels trägt die Volksrepublik China. Der städtische Kostenanteil für Erdaushub, Bodenuntersuchung, Fundament, Pflasterbelag und Beleuchtung beläuft sich auf 39.000 Euro.“ (http://www.trier.de/kultur-freizeit/karl-marx/karl-marx-statue/) Muss nur noch geregelt werden, wer für die Graffitti-Entfernung zahlt.
Natürlich war das für die hiesige Öffentlichkeit eine Gelegenheit, über Personenkult und Heuchelei der chinesischen Kommunisten herzuziehen (vgl. IVA, „Marx is back“, Vol. 4). Die FAZ entlarvte überhaupt als Triebkraft im Jubiläumstrubel ein „Marx-Business“, bei dem es um ein „millionenschweres Geschäft“ gehe – betrieben vom Trierer Stadtmarketing über diverse Institute und Vereine bis hin zur VR China, wo die Feiern Staats- und Parteisache sind (Pennekamp u.a. 2017). Nachdem mitgeteilt wurde, wie viele Millionen von Bund, Land und Stadt in die „Große Landesausstellung“ 2018 in Trier fließen, hieß dann das überraschende Fazit der FAZ: „In China läuft das Marx-Business staatlich gelenkt. In Deutschland funktioniert es kurz vor dem großen runden Geburtstag ganz von selbst.“ Dabei wurde noch eigens aufgedeckt, dass es der chinesischen KP – „Ein Etikettenschwindel, von dem jeder weiß“ – gar nicht um Kapitalismuskritik geht, sondern um die Feier des eigenen Ladens!
Nichts Besonderes zu berichten gibt es für die hiesigen Medien aus Moskau, der Heimat des Marxismus-Leninismus. Das Putin-Regime hat das offizielle Gedenken an die Oktoberrevolution und damit natürlich auch an den Marxismus abgeschafft. Es überlässt das gnädiger Weise der russischen KP, deren Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr „freilich auch deutlich weniger kommunistisch als vielmehr russisch-patriotisch“ ausfielen (Lauterbach 2017). Der russische Staat ist dabei nicht ganz ausgemischt: Er hat in Kooperation mit der staatsnahen orthodoxen Kirche ein neues Geschichtsmuseum auf dem Gelände der ehemaligen Allunionsausstellung errichtet, das die beiden Revolutionen des Jahres 1917 als Ergebnis finsterer Machenschaften gegen den legitimen Zaren Nikolai II. präsentiert: „Die Darstellung in dem mit allem erdenklichen Multimedia-Schnickschnack ausgestatteten ‚My History Park‘ akzentuiert, wer da alles gegen den armen Zaren intrigiert habe: Liberale – für englisches Geld; Juden – aus Hass gegen die Orthodoxie; Marxisten, um die ‚von einem deutschen Rabbinersohn‘ (Karl Marx) ausgedachte Theorie des Sozialismus in einem dafür denkbar ungeeigneten Land auszuprobieren, und überdies mit deutschem Geld.“ (Ebd.)
Wer braucht Marx?
Als seriös gelten in der hiesigen Öffentlichkeit dagegen Veranstaltungen und Events, wie sie die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Träger des Karl-Marx-Hauses in Trier und damit an der Großen Landesausstellung 2018 maßgeblich beteiligt, im Programm hat. Am 22. November 2017 startete die SPD-nahe Stiftung an der Bonner Universität eine Ringvorlesung, die sich unter dem Titel „Klasse, Kapital & Revolution“ mit dem Marx-Jubiläum befasst bzw. ihren Teil dazu beiträgt. Eröffnet wurde die Reihe mit einem Vortrag von Prof. Thomas Meyer zum Thema „Gebrauch und Missbrauch von Marx“. Der Politikwissenschaftler Meyer, der als Chefredakteur für die FES-Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte (NG/FH) tätig ist, hatte sich dort schon vor Jahren mit der Frage befasst, ob „wir“ eine (neue) Marx-Renaissance brauchen (Meyer 2012). In dem betreffenden Heft kamen verschiedene Experten zu Wort, die der Marxschen Kapitalismuskritik – bedingte – Gültigkeit für die Gegenwart bescheinigten. Exemplarisch etwa der Kulturredakteur der Zeitschrift Hanjo Kesting in seinem „Rückblick auf das Kommunistische Manifest“, der vor allem im Blick auf die Krisentendenzen und Unregulierbarkeit des Systems festhielt: „Diese Analyse ist im Großen und Ganzen gültig geblieben.“ (Kesting 2012, 60) Gleichwohl soll Marx, der nach Auskunft des Autors die Globalisierung voraussah und schon die finanzkapitalistischen Entwicklungen analysierte (ebd., 61), mit seiner Erklärung die heutigen globalen Krisentendenzen und die bedingungslose Herrschaft des Marktes, auch als „Neoliberalismus“ bekannt, samt Gegenmaßnahmen und -kräften verfehlt haben: „Alles das hat Marx nicht vorausgesehen…“ (ebd., 63). Die Globalisierung ist zwar die weltweite Durchsetzung der Herrschaft des Kapitals, aber „nach welcher Gesetzmäßigkeit sie sich vollzieht, vermag niemand zu sagen.“ (Ebd.)
Ähnlich zweideutig fiel Meyers Antwort auf die von ihm gestellte Frage aus. Er äußerte sich zunächst süffisant, aber zutreffend zur jüngsten Wiederentdeckung des Klassikers der Arbeiterbewegung – eine Renaissance, die eine „veritable Feuilleton-Revolution bis in die konservativen Blätter“ (Meyer 2012, 4) nach sich gezogen habe. Im Endeffekt konstatierte er jedoch eine ernsthafte „Neubelebung der prinzipiellen Kapitalismuskritik“ (ebd.), die mit ihrer Lebendigkeit die ganzen Topoi von 150 Jahren Marx-Widerlegung der Unhaltbarkeit überführt habe. Auch auf der Ebene der Politik habe sich nun nach rund 100 Jahren gezeigt, dass die praktische Widerlegung der Marxschen These vom unversöhnlichen Klassengegensatz nicht haltbar ist – also, obwohl es nicht so direkt ausgesprochen wird: die sozialdemokratische Versöhnung des „antagonistischen“ Grundwiderspruchs misslungen ist. Es ist weiterhin, so Meyer, das von Marx analysierte kapitalistische System, was die ökonomische Basis bestimmt: „Die Zähmung des Kapitalismus nach der Weltwirtschaftskrise sozusagen zum harmlos gewordenen Haustier der stolzen Demokratie ist gescheitert. Die Bestie hat sich vom Halsband gerissen.“ (Ebd., 5)
Mit der Bildersprache vom „Raubtierkapitalismus“ ist aber schon der Weg gewiesen, die Marxsche Analyse dann doch wieder zu verabschieden. Das Raubtier ist entlaufen, also muss es erneut eingefangen und angekettet werden. Wenn das geschieht, dann werden sich auch wieder die idyllischen Verhältnisse einstellen, wie sie im rheinischen Kapitalismus der Adenauerära und überhaupt in den „westlichen Gesellschaften in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg“ geherrscht haben sollen – in Zeiten nämlich, als, laut Meyer, der Kapitalismus „den größten Teil seiner Versprechungen tatsächlich eingelöst (hatte): hoher Lebensstandard, soziale Sicherheit und die Verminderung von Ungleichheiten“ (ebd., 7). Dass das geschieht, hängt entscheidend davon ab, ob der „sozialdemokratische Kompromiss“ (ebd., 6), der in den letzten Jahrzehnten – irgendwie – ins Abseits geraten ist, wieder an Ansehen und Akzeptanz gewinnt. Dafür, dass das gelingt, kann man dann auch die Marxsche Kritik als eine Art „heuristischer Leitfaden“ (ebd., 8) gebrauchen.
Das ist schon ein bemerkenswertes Fazit! Nach 100 bis 150 Jahren Reformismus lässt sich der theoretische wie praktische Bankrott der Sozialdemokratie bilanzieren. Macht aber nichts, es heißt schlicht und ergreifend: auf ein Neues! Das Projekt soll wieder aufgelegt werden, jetzt aber wirklich ernsthaft und ganz konsequent im Sinne des sozialdemokratischen Ideals. Als dessen Statthalter tritt die Stiftung auf, die sich die Partei praktischer Weise auch noch hält, um neben der Finanzierung diverser Aufgaben die Strahlkraft der eigentlichen Werte („sozialdemokratischer Kompromiss“, „soziale Demokratie“…) zu erhalten oder aufzupolieren. Die These von der „Einhegung“ des Kapitalismus hat sich zwar als Unwahrheit herausgestellt, doch muss man diesen Befund nur mit einer kleinen Verschiebung vortragen – momentan ist die Zähmungsstrategie gescheitert, weil unfähige oder durch mächtige Gegenkräfte behinderte Politiker sie nicht fortgeführt haben – und schon lässt sich das Vorhaben eines regulierten Kapitalismus wieder als die beste aller Möglichkeiten, jedenfalls als die einzig realistische auftischen.
Dafür muss man nur noch die Marxsche Theorie, die im ersten Schritt als hellsichtig gelobt wurde, im zweiten Schritt als obsolet oder fehlerhaft beiseite legen. Bei Meyer geschieht das dadurch, dass entschieden vor ihrer „Heiligung“ und „Dogmatisierung“ (ebd., 8) gewarnt wird. Im Klartext: Ernst nehmen darf man sie nicht, interessant finden schon. Für die Befeuerung des heutigen sozialdemokratischen Projekts, das letztlich auch auf Marx zurückgeht – so jedenfalls Meyer in seiner „Theorie der sozialen Demokratie“ (2005, 94) –, kann man z.B. an sie erinnern. Wenn das jubiläumshalber geschieht und Aufmerksamkeit findet, sowieso. Man muss für die Neuauflage des besagten Kompromisses nur noch die Geschichte der Arbeiterbewegung umdeuten, etwa die Verhältnisse in der Nachkriegs-BRD, wo die Sozialdemokratie übrigens die allerwenigste Zeit mitregierte, als ein Goldenes Zeitalter des eingehegten Kapitalismus schönfärben. Eine Epoche, als „hoher Lebensstandard“ hieß, dass nach den Entbehrungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre die nationale Arbeitskraft wieder für mickrige Löhne in Dienst genommen wurde, wobei tatsächlich sukzessive einige Reproduktionsnotwendigkeiten des Arbeiterhaushalts (TV, Auto, Kühlschrank…) Berücksichtigung fanden. Dieses ominöse Wirtschaftswunder, das auf gar nicht wunderbare Weise den Aufwuchs der mächtigen Konzerne zustande brachte, die ihren Erfolg dann so rücksichtslos neoliberal auf dem Rücken der Arbeitnehmer und zunehmend auch der Arbeitnehmerinnen (ohne mitverdienende Ehefrau ging nichts mehr) austobten, soll man sich als Zustand „sozialer Sicherheit“ vorstellen. Und dies gleichzeitig auch noch als Weg zur „Verminderung von Ungleichheiten“ verstehen, wo doch spätestens seit der voluminösen Studie von Thomas Piketty (2014) bekannt ist, dass von einer Tendenz zur Ausgleichung der Einkommens- und Vermögensunterschiede nicht die Rede sein kann, dass der säkulare Trend vielmehr in die entgegengesetzte Richtung geht und dass die einschlägigen Beschönigungen aus der Nachkriegszeit auf Fehldeutungen basieren, die an regelrechte Bilanzfälschungen grenzen.
Vom Ge- und Missbrauch
Meyers Auftakt der Bonner Vorlesungsreihe bestätigte, nicht überraschend, diese Linie: Der sozialdemokratische Gebrauch ist streng vom Missbrauch zu trennen, wie ihn der Marxismus-Leninismus und von ihm inspirierte Bewegungen in der Dritten Welt Jahrzehnte lang praktizierten. Das Motiv der „Erlösung“ bei Marx – also sein Projekt, die Geschichte der Klassengesellschaften zu beenden, was von den Arbeiterparteien meist zu einer eigenen Geschichtstendenz überhöht wurde – sei endgültig passé und verbraucht, so Meyer im Vortrag. Wie er in seinem Eröffnungsbeitrag zum einschlägigen NG/FH-Themenheft festhielt, gehören aber auch die Lesarten eines „westlichen Marxismus“ (von Georg Lukács bis zur Frankfurter Schule) tendenziell in die Abteilung Missbrauch. Diese Varianten hätten zwar in wissenschaftlicher Hinsicht „durchaus fruchtbare Synthesen“ zustande gebracht, doch – „überwiegend eine Angelegenheit von Intellektuellen“ (Meyer 2017, 26) – keine Verbindung zur Arbeiterbewegung hingekriegt. Sie hätten wie der ML „für den Einzelnen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ähnliche integrale Lebensbedeutung“ (ebd.) gehabt. Seitdem stehe jedenfalls fest: „Die weltanschaulich-ethischen Energien beider Varianten des Marxismus sind heute vollständig erloschen, kaum vorstellbar, dass sie noch einmal zum Leben erweckt werden könnten.“ (Ebd.)
Denkbar wäre natürlich, dass man nach der „unerwarteten Finanzkrise von 2008 unter Umgehung aller drei genannten Haupttraditionslinien des Marxismus einen direkten Rückgriff auf Motive der Kritik der politischen Ökonomie“ versuche, denn „auf analytischer Ebene scheinen viele der marxschen Einsichten über die Motive die kapitalistisch verfasste Ökonomie auch heute noch – oder vielmehr gerade heute besonders – des Pudels Kern zu treffen.“ (Ebd., 26f) Aber das scheint eben nur so: Die Analyse des „Kapital“ ist definitiv veraltet! Dafür muss Meyer, wie er in seinem Aufsatz vorführt (was die Vorlesungsreihe im Einzelnen erbringt, bleibt abzuwarten), kein einziges Element aus der Marxschen Theorie bemühen. Denn den Kapitalismus, den Marx vor Augen hatte, gebe es gar nicht mehr – dies eben das Verdienst der sozialdemokratischen Politik! Der „tief gehende Wandel des Kapitalismus seit Marx“, der die „Domestizierung der Klassenkonflikte“ (ebd., 27) und sonstige Schönheiten hervorgebracht habe, sei der SPD zu verdanken, die deshalb auch zum einzig legitimen Gebrauch befugt sei. Man muss dafür nur vergessen, dass der sozialdemokratische Theoretiker an anderer Stelle noch das Raubtier unerwartet und höchst gefährlich von der Kette losgerissen sah…
Egal, es soll die Menschen das Fürchten lehren und dann natürlich das Hoffen, dass es tapferen Sozialdemokraten endlich gelingt, das Monster zu domestizieren. Irgendwie passt das auch ins Superwahljahr 2017 mit seinem beispiellosen Niedergang der großen Volkspartei SPD. Sie muss jetzt in der Opposition ihr oppositionelles Profil schärfen – vielleicht aber auch, so die neuesten Meldungen, durch Regierungsmitverantwortung stärker sichtbar machen. „Wir müssen wieder den Mut zur Kapitalismuskritik fassen“, heißt es vom Partei-Vorsitzenden Schulz (Die Zeit, 18.10.2017). „Kapitalismus-Kritik gehört zur DNA der SPD“, betont Fraktionschefin Nahles und präzisiert gleich, wie das gemeint ist: Man müsse dem US-dominierten digitalen Kapitalismus Paroli bieten, „die Ideologie des Silicon Valley verfolgt eine andere Idee als unsere soziale Marktwirtschaft“ (Bild am Sonntag, 21.10.2017). Neuerdings muss die SPD sogar konstatieren, dass sich in einen deutschen Vorzeigekonzern wie Siemens amerikanische Managementmethoden eingeschlichen haben, die der hiesigen „Sozialpartnerschaft“ Hohn sprechen…
Die Juso-Vorsitzende Uekermann gibt sich, wie üblich, radikaler und kündigt den Ausbau von Kapital-Lesekreisen bei der Parteijugend an (vgl. Brandt u.a. 2017). Und die Friedrich-Ebert-Stiftung tritt als der natürliche Nachlassverwalter des Marxschen Lebenswerks auf, über dessen Gebrauch und Missbrauch sie befindet. Da macht die Konrad-Adenauer-Stiftung, die 2017 mit ihrem Ludwig-Erhard-Gedenkjahr beim Publikum punkten wollte (vgl. IVA, „Marx is back“, Vol. 2), keine gute Figur, plagt sich statt dessen mit einem Streit über den Stiftungsvorstand: Kann die katholische Promotionsbetrügerin Schavan hier Abhilfe schaffen? Kann ein Schönredner und Prediger wie Lammert den Laden auf Vordermann bringen? Eine Neuaufstellung sei überfällig, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen, da die christdemokratische Stiftung zwar im Ausland exzellente Auftritte hinlege, „aber in Deutschland bei wissenschaftlichen Studien etwa hinter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hinterherhinke“ (General-Anzeiger, 10.11.2017). Vielleicht sollte sie als erstes eine Ludwig-Erhard-Statue aufstellen?
Literatur
- Peter Brandt u.a., Was uns Karl Marx heute noch zu sagen hat – Gespräch mit Peter Brandt, Michael Brie und Johanna Uekermann. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Nr. 10, 2017, S. 4-12.
- Hanjo Kesting, „… worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ – Rückblick auf das Kommunistische Manifest. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Nr. 4, 2012, S. 59-63.
- Reinhard Lauterbach, Peinliches Erbe – Wie Russland heute an die Oktoberrevolution erinnert. In: Junge Welt, 1.11.2017.
- Thomas Meyer (mit Lew Hinchmann und weiteren Mitarbeitern), Theorie der sozialen Demokratie. Wiesbaden 2005.
- Thomas Meyer, Der Kapitalismus und seine Kritik – Brauchen wir eine Marx-Renaissance? In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Nr. 4, 2012, S. 1-8.
- Thomas Meyer, Vom Gebrauch und Missbrauch des Marxismus. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Nr. 10, 2017, S. 23-27.
- Johannes Pennekamp u.a., Das Marx-Business. In: Frankfurter Allgemeine Woche, Nr. 18, 2017.
- Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert. München 2014.
Internet
Ringvorlesung „Klasse, Kapital & Revolution“ – 200 Jahre Marx: http://www.fes-soziale-demokratie.de/marx.html. Die Ringvorlesung findet von November 2017 bis zum Januar 2018 in der Universität Bonn statt – also in der Universität, wie die Stiftung hervorhebt, an der Marx studierte und die in seinem Geburtsjahr gegründet wurde. Aus der Ankündigung: 200 Jahre nach seiner Geburt feiert der Philosoph ein überraschendes Comeback. Seine Kritik richtete sich gegen die Klassenverhältnisse des 19. Jahrhunderts. Ungleichheit, Entfremdung, Finanzkrisen – ist Marx Kritik heute aktueller denn je? Sind es seine Antworten auch? Was hat Marx uns heute noch zu sagen? Als weitere Referenten sind vorgesehen: Beatrix Bouvier, Michael Quante, Nina Power, Ulrike Hermann und Oliver Nachtwey. Die Reihe wird in Zusammenarbeit mit Prof. Frank Decker vom Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Uni organisiert.
Große Landesausstellung in Trier: https://www.karl-marx-ausstellung.de/home.html. Aus der Homepage: Am 5. Mai 2018 jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Aus diesem Anlass widmet sich erstmals überhaupt eine kulturhistorische Ausstellung diesem bedeutenden Denker des 19. Jahrhunderts und beleuchtet sein Leben, seine wichtigsten Werke und das vielfältige Wirken in seiner Zeit. Getragen vom Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Trier wird die große Landesausstellung KARL MARX 1818 – 1883. LEBEN. WERK. ZEIT. vom 5. Mai bis 21. Oktober 2018 in gleich zwei Trierer Museen zu sehen sein, dem Rheinischen Landesmuseum Trier und dem Stadtmuseum Simeonstift Trier. Zeitgleich werden in Partnerausstellungen im Museum Karl-Marx-Haus und im Museum am Dom die Wirkungsgeschichte sowie zeitgenössische Aspekte ergänzend beleuchtet.
„Marx is back“, Vol. 8
Die Marxsche Analyse der kapitalistischen Produktionsweise – schlichtweg „a failure“ (Stedman Jones), ein Dokument des Scheiterns? Vor allem deshalb, weil die zu Grunde liegende „Arbeitswerttheorie“ längst widerlegt und aus der Wissenschaft ausgemustert ist? Dazu ein weiterer Kommentar der IVA-Redaktion.
Marx-Widerlegungen sind fester Bestandteil der gegenwärtigen Marx-Renaissance, dazu gehört an vorderster Stelle die Zurückweisung der „Arbeitswerttheorie“ (vgl. „Marx is back“, Vol. 4, IVA, Texte2017). Sie war angeblich eine grandiose Sackgasse. „Nicht die Krankheit hinderte Marx an der Arbeit, sondern die theoretischen und konzeptionellen Probleme erwiesen sich als unlösbar.“ (Plumpe 2017, 16) So der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe im Heft „Das Kapital“ (APuZ 19-20/2017) der Bundeszentrale für politische Bildung, wobei er als Erstes die „Arbeitswert- bzw. Arbeitsmengenlehre“ und das davon ausgehende „Transformationsproblem“ nennt: „Die insofern maßgebliche Kritik von Joseph Schumpeter wird von der modernen Forschung zumeist geteilt.“ (Plumpe 2017, 16; mit Schumpeters Einwänden setzen sich ausführlich Decker u.a. 2017, 94ff, auseinander.) In der Tat hat man es hier mit einem breiten Konsens zu tun, der allerdings einige Fragwürdigkeiten aufweist, beginnend mit der Wiedergabe dessen, was Marx von sich gegeben hat.
Wissenschaftliche Fehlleistung?
Einschlägige Rückblicke auf Marx, die dessen Fehler und Fehlleistungen hervorheben, veröffentlichte z.B. die FAZ zum Sommer 2017: „Der falsche Prophet“ von Philip Plickert und „Kathedrale des Kapitals“ von Stephan Finsterbusch. Plickert hielt fest, dass der Versuch von Marx kläglich gescheitert sei, mit seinem wissenschaftlichen Hauptwerk „wortgewaltig zu belegen, warum der Kapitalismus zwangsläufig gegen die Wand fahren werde“ (Plickert 2017). Hier war der Akzent also auf die fehlgehende Prognose gesetzt. Finsterbusch gab eine kurz gefasste Übersicht über die Entstehungsgeschichte der „Bibel der Arbeiterklasse“, wie er das „Kapital“ nannte, und über die Rezeption des Werks (Finsterbusch 2017). Als es „vor 150 Jahren erschien, hat es kaum jemand verstanden“, hieß es dazu. Eine nicht ganz einsichtige Feststellung – denn wie soll das gehen, dass das Opus auf allergrößtes Unverständnis stößt und gleichzeitig bei den Arbeitern in den Rang einer Offenbarungsschrift aufsteigt?
Finsterbusch referiert u.a. den aktuellen Stand der Zurückweisungen am Fall der Arbeitswerttheorie. Er bezog sich dabei – dem modernen Meinungsbetrieb entsprechend – auf die maßgeblichen Positionen des wissenschaftlichen Pluralismus. Dort hat z.B. Hans-Werner Sinn, der vielleicht wichtigste deutsche Wirtschaftswissenschaftler, wie es in Fachkreisen heißt, die Fehlerhaftigkeit der Marxschen Theorie statuiert. Daneben lässt sich freilich, das wird vom FAZ-Autor nicht verschwiegen, auch ein Kollege finden, nämlich der Amerikaner David Harvey, der Marx die Stange hält. Relevant ist das jedoch im Unterschied zu Sinn nicht. Finsterbusch zitiert eine Passage aus dessen Aufsatz, der in dem genannten Heft der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen ist (und der auch schon Thema in „Marx is back“, Vol. 4, war). Das Heft scheint überhaupt maßgebliche Stichworte für die öffentliche Debatte geliefert zu haben. Deshalb hier noch einmal einige Anmerkungen zu Wert und Wertgesetz (die bei Bedarf fortgesetzt werden).
Laut Sinn ist die Marxsche Erklärung der Ausbeutung nicht haltbar, da schon die Arbeitswerttheorie grundlegende Mängel aufweise: „Zu Marx’ größten wissenschaftlichen Fehlleistungen gehört die Arbeitswerttheorie…, denn erstens sind die Löhne nur eine von vielen Kostenkomponenten einer Firma und zweitens sind Preise grundsätzlich Knappheitspreise, die ihren Wert auch von den Präferenzen und der gegenseitigen Konkurrenz der Nachfrager herleiten.“ (Sinn 2017, 24) Das flankiert die taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann im selben APuZ-Heft und wird damit auch im FAZ-Aufsatz gewürdigt: „Marx wusste, dass seine Mehrwerttheorie eine zentrale Schwäche hatte – was vielleicht der Grund ist, warum er Band zwei und drei des ‚Kapitals‘ nie beendet hatte. Er kämpfte nämlich mit dem ‚Transformationsproblem‘, wie es heute heißt. Marx konnte nicht erklären, wie sich der Wert einer Ware in ihren Preis übersetzt. Zwischen der Tiefenstruktur der Werte und der Oberfläche der Preise schien es keine zwingende Verbindung zu geben. Dieses ‚Transformationsproblem‘ entstand, weil im modernen Kapitalismus nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Maschinen eingesetzt werden. Doch Marx’ Mehrwerttheorie ging davon aus, dass nur die menschliche Arbeit Werte schafft… Kapitalisten kalkulieren letztlich simpel, wie auch Marx feststellte: Sie berechnen ihre Produktionskosten – und schlagen einen Gewinn obendrauf. So ergibt sich dann der Preis, den sie auf dem Markt erzielen wollen. Aber wo bleibt da der Mehrwert? Darauf hatte Marx keine Antwort.“ (Herrmann 2017, 19/20)
Bei der – traditionsreichen – Zurückweisung der Arbeitswerttheorie erstaunt zunächst die pure Ignoranz gegenüber den Marxschen Schriften. Was z.B. Herrmann als „Transformationsproblem“ einführt, ist Teil des Argumentationsgangs im „Kapital“. Marx will ja gerade vom Produktionsprozess im Allgemeinen, den er im ersten Band abhandelt, zum Gesamtprozess gelangen, wo dann die Erwirtschaftung des Profits erklärt wird, wie er sich in Unternehmergewinn, Zins und Grundrente aufspaltet (vgl. MEW 25). Dabei ist natürlich Thema, dass der Unternehmer kein Wertgesetz kennt und daher auch nicht zur Leitschnur seines Handelns macht. Für ihn wirft sein gesamtes Kapital den Profit ab. Wenn dieser Standpunkt explizit zur Sprache kommt – so vor allem im dritten Band (vgl. MEW 25, 208, 269) –, spricht Marx daher vom „Extraprofit“. Dass Marx „keine Antwort“ auf solche Fragen gehabt hätte, ist ein Zerrbild seiner Erklärung. Die Fehlermeldungen bedienen sich einfach einzelner – bewusst? – missverstandener Teile der Theorie, um sie gegeneinander auszuspielen und sich dann als Entdecker der eigentlichen Problemlage aufzuplustern. Marx erinnerte z.B. in der Kontroverse mit dem deutschen Ökonomen Adolph Wagner daran, dass er in seinen Schriften zur Ökonomie, so im „Kapital“, „ausdrücklich darauf hingewiesen“ habe, „daß Werte und Produktionspreise (die nur in Geld die Produktionskosten ausdrücken) nicht zusammenfallen“ (MEW 19, 359).
Eine einfache Übung ist es natürlich auch, wie Sinn und Plumpe demonstrieren, die Marxschen Theorie dadurch abzuqualifizieren, dass man ihr kategorisch entgegenhält, sie stimme nicht – im Gegensatz zur subjektiven Werttheorie, die stimmt! Letztere gilt heutzutage eben etwas, die Marxsche nicht. Sinn bleibt aber nicht bei der Berufung auf den Konsens der Wirtschaftswissenschaft stehen, er liefert auch zwei Argumente. Sie lauten: „Was hat beispielsweise der Preis eines Gemäldes von Rembrandt mit dem Lohn des Meisters zu tun? Was hat der Preis des Erdöls mit dem Lohn der Arbeiter am Bohrloch zu tun? Nichts, oder so gut wie nichts.“ (Sinn 2017, 18) Michael Heinrich hat darauf hingewiesen, „dass Sinn hier die Wertbestimmung durch Arbeitszeit mit der Wertbestimmung durch die Arbeitslöhne zusammenwirft“ (Heinrich 2017, 428). Die Beispiele treffen ja gar nicht die elementaren Bestimmungen des Warenwerts, wie sie Marx in den ersten Kapiteln des „Kapital“ entwickelt hat, sondern beziehen sich auf Spezialfälle bzw. auf die entfaltete kapitalistische Warenproduktion. In der geht natürlich nicht bloß der im Lohn repräsentierte Wertteil, also in der Marxschen Diktion klein v, das variable Kapital, in das Arbeitsergebnis ein, sondern genauso und in wachsendem Maße das in Maschinerie etc. ausgelegte konstante Kapital, so weit sein Wert eben im Produktionsprozess übertragen wird.
Hinzu kommt, dass gleich im ersten Fall mit dem Hinweis auf den Maler Rembrandt eine absolute Ausnahmesphäre, die mit der Normalität kapitalistischer Warenproduktion nichts zu tun hat, etwas über den Alltag des Warenaustauschs aussagen soll. In dem Beispiel geht es um künstlerische Hervorbringungen, die gerade nicht der eine wie der andere Warenproduzent zustande bringen kann, sondern nur eine ganz bestimmte Person. Der Terminus „Lohn“ ist dabei überhaupt ein Witz: So viel weiß auch ein Gerhard Richter, dem der Kunstmarkt selber unverständlich ist, dass er nicht für seine Arbeitsstunden vor der Leinwand entlohnt wird. Die Preisbildung vollzieht sich hier gemäß den Kalkulationen von – als Kunstfreunden getarnten – Investoren, die auf die Kursentwicklung bei bestimmten Unikaten setzen. Es handelt sich also im Grunde um eine Anlagesphäre im Rahmen der Finanzbranche, eben um eine Sphäre, die von der Herstellung von Gebrauchswerten meilenweit entfernt ist.
Im zweiten Fall soll die Widerlegung eine andere Sondersphäre leisten, die auch kein Normalbeispiel der Warenproduktion ist, sondern sich aus der imperialistischen Benutzung und Alimentierung „unterentwickelter“ Regionen sowie der Einrichtung eines Weltenergiemarktes ergibt. Hier hängt die Preisbildung in letzter Instanz von staatlichen Eingriffen (Steuern und Abgaben) ab, die dort anfallen, wo der Rohstoff als Ware in die individuelle und produktive Konsumtion eingeht, also der Akkumulation an einem Kapitalstandort die Grundlage verschafft. Interessant übrigens, dass der Wirtschaftsexperte Sinn die Lohnhöhe für unerheblich erklärt. Aus dem Normalfall der Vernutzung von Lohnarbeit, die als variables Kapital dem Produktionsprozess zugeführt wird, kennt dagegen jeder die Forderung der Unternehmer, dass die Lohnkosten niedrig genug sein müssen, damit ein rentables Geschäft zustande kommt. Bis neulich gab es ja auch die berühmte Lohn-Preis-Spirale, wo jeder Prozentpunkt Lohnerhöhung gleich die Ware verteuerte. Auf die Arbeit, die geleistet wird – und die nach der Marxschen Erklärung als „notwendige“ entlohnt und als „Mehrarbeit“ vom Unternehmer angeeignet wird –, kommt es also schon an. Diesen Tatbestand, der in der Klage über Ausbeutung als „Raub“ am Arbeiter (vgl. MEW 19, 359f) moralisch gedeutet wurde und wird, hat Marx zum zentralen Gegenstand seiner Theorie gemacht. Dass Waren im Durchschnitt zu ihrem Wert bezahlt werden, dass sie bei entwickelter kapitalistischer Produktionsweise auch einen Mehrwertbestandteil enthalten, um den sich alles dreht, hielt er für die entscheidenden Punkte der Erklärung.
Dass solche Marx-Widerlegungen zum Standardrepertoire gehören, zeigt auch die große Biographie von Gareth Stedman Jones (2017), die schon in „Marx is back“, Vol. 7, erwähnt wurde. Die Biographie kommt „zu dem nicht ganz unoriginellen Schluss, dass jenes Buch, das neben Bibel und Harry Potter immer noch mit den höchsten Gesamtauflagen und der größten Zahl an Übersetzungen überhaupt aufwarten kann, ‚a failure‘ sein soll: ein Fehler, Manifestation eines biografischen und theoretischen Scheiterns, politisch ein Schuss in den Ofen“ (Eiden-Offe 2017, 67). Die Biographie – das wäre hier nachzutragen – verbleibt nicht einfach im Rahmen der lebensgeschichtlichen Details, sondern widmet sich, der Profession des Autors gemäß, auch der Ideengeschichte. Dabei spielt die Arbeitswerttheorie eine besondere Rolle, denn, so der angelsächsische Biograph, Marx habe sie von Ricardo gestohlen und anschließend verballhornt. Das ist ein absurder Vorwurf. Marx hat sein Opus explizit „Kritik der politischen Ökonomie“ genannt. Die Bezugnahme auf die Klassiker dieser Disziplin, auf Smith, Ricardo u.a., war sein Ausgangspunkt; er schätzte einige ihrer Erkenntnisse und unterzog andere der Kritik; all das kann man in ersten Band des „Kapital“ nachlesen…
Der Wirtschaftshistoriker Patrick Eiden-Offe ist Stedman Jones’ Enthüllungen im Einzelnen nachgegangen und bringt triftige Einwände gegen diese Art der Widerlegung. Er hält übrigens auch fest, dass „diese Anamnese der Genese des Marx’schen Werks“ bei aller Sorgfalt nichts Neues zu bieten habe: „Nach einer ersten Sichtung der nur im Nachlass überlieferten Grundrisse hat Roman Rosdolsky in seiner monumentalen Studie Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ 1968 diese schon früh und für die Studentenbewegung wirkmächtig auseinandergelegt“ (Eiden-Offe 2017, 70; vgl. Rosdolsky 1972, dazu auch Schillo 2015, 193ff).
Eiden-Offe erinnert zudem daran, dass „die Aufarbeitung der Vorgeschichte des Kapital im Osten“ Wesentliches zur Entstehungsgeschichte beigetragen habe, dass also in der Sowjetunion, der CSSR oder der DDR solide Wissenschaft und nicht, wie immer behauptet, bloßer ML-Dogmatismus betrieben wurde (Eiden-Offe 2017, ebd.). Dass Marx Vorläufer hatte – diese Banalität, die das für die MEW-Ausgabe verantwortliche „Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED“ mit der Herausgabe der „Theorien über den Mehrwert“ (MEW 26, Teil 1-3) aller Welt bekannt machte –, gilt neuerdings als brandneue Erkenntnis!
Die Theorie des Werts
Angesichts solcher Begriffsverwirrungen und seltsamen Entdeckungen soll im Folgenden ein Literaturhinweis nachgetragen werden, die legendäre „Arbeitswerttheorie“ betreffend. Der Terminus kommt im „Kapital“ übrigens nicht vor, die Sache natürlich schon. Wenn man sich von marxistischer Seite dazu Aufklärung holen will, empfiehlt sich als Einführungsschrift „Das Geld“ von Wolfgang Möhl und Theo Wentzke (2007). Die Veröffentlichung will in den ersten Kapiteln eine „Verständnishilfe für Marx’ ominöse ‚Arbeitswertlehre‘“ (ebd., 8) liefern. Sie erinnert auch an die früheren Bemühungen – vor allem der westdeutschen Linken –, sich mittels methodologischer (Vor-)Überlegungen zur „Kapital“-Lektüre Aufschluss über die Theorie zu verschaffen. Eine Anstrengung, die sehr zum Nachteil soliden Wissens über die kapitalistische Ökonomie ausschlug – und die leider heute auch wieder anzutreffen ist. Solche Leser „haben die ersten drei Kapitel des 1. Bandes des Kapital studiert und glatt aus den Augen verloren oder gar nicht erst gemerkt, dass es der allgemein bekannte Alltag des kapitalistischen Betriebs ist, von dem diese Kapitel handeln, und dass an dem kein gutes Haar bleibt, wenn man ihn begreift und nicht wohlwollend danach beurteilt, dass man sich wunderbare Sachen kaufen kann, wenn das Geld reicht“ (ebd.).
Eine derartige philosophisch oder methodologisch angeleitete Lektüre will auf Fragen nach der Möglichkeit von Wissenschaft und Erkenntnis überhaupt hinaus, statt die von Marx vorgelegten Erkenntnisse zu überprüfen. Letzteres ist der Vorschlag von Möhl und Wentzke. Sie halten das „Kapital“ nicht für eine tendenziell unverständliche Schrift, deren Lesern erst durch eine propädeutische Hinführung oder Kommentierung der Zugang eröffnet werden müsste. Ihr Buch will auch die Lektüre des Originals nicht ersetzen, im Gegenteil, es rät dazu. Es bemüht sich nur, den verbreiteten Missverständnissen mit einer Konzentration aufs Wesentliche entgegenzutreten. Das ist die Intention des Hauptteils. Es geht dann aber darüber hinaus und bringt einen historischen Exkurs zur deutsch-deutschen Währungsunion des Jahres 1990, die den Anschluss der DDR an die BRD einleitete. Hier wird also ein Fall verhandelt, den Marx natürlich nicht – wie so vieles andere im 20. Jahrhundert – voraussehen konnte, nämlich die Tatsache, dass der reale Sozialismus in seiner Planwirtschaft eine „bewusste Anwendung des Wertgesetzes“ praktizieren wollte und dazu sein eigenes Zahlungsmittel schuf.
Das eigenartige Vorhaben führte dazu, dass die Ware-Geld-Beziehung in dieser alternativen Wirtschaftsordnung erhalten blieb, jedenfalls so lange, bis Westdeutschland mit seinem Geld, der weltweit geachteten DM, die Beziehung dann wieder vom Kopf auf die Füße stellte, also wirkliches Geld statt der realsozialistischen Planungs- und Verrechnungsgröße in Kraft setzte. Der Exkurs macht sich die Mühe, die Rolle des Geldes in Plan- und Marktwirtschaft zu vergleichen – und damit noch einmal das von Marx entwickelte Wertgesetz zu verdeutlichen. Das letzte Kapitel des Buchs widmet sich dann einem Thema, das über die Rekapitulation der Werttheorie weit hinausgeht: nämlich dem Geld des Staates in der Welt des modernen Imperialismus. Das ist eine notwendige Fortsetzung, denn Marx war, was von seinen Kritikern neuerdings als großartige Entdeckung präsentiert wird, nicht mehr dazu gekommen, diese Fragen in seinen geplanten Büchern über den Staat und über den Weltmarkt abzuhandeln. Möhl und Wentzke führen den Nachweis, dass sich ausgehend von der Marxschen Theorie in den drei Bänden des „Kapital“ durchaus die modernen Verhältnisse erklären lassen, in denen der Staat das Geld macht.
Die Autoren bestehen auch darauf, dass sich die Marxsche Analyse nicht in einer Untergangsprognose erschöpft. Marx habe gerade konstatiert, „dass die kapitalistische Wirtschaft funktioniert; er hat das bloß nicht für einen Grund gehalten, sich die Überlegung zu ersparen, was da funktioniert. Dass ihm dann der Begriff des allgemeinen Äquivalents, das den Warenaustausch vermittelt, zur Kritik dieses ökonomischen Gegenstands geraten ist, liegt am Gegenstand: daran, dass das Geld ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis vergegenständlicht und quantifiziert, dem die gesellschaftliche Arbeit unterworfen ist.“ (Ebd.) Das Buch von Möhl/Wentzke beginnt mit den grundlegenden Kategorien – dem Geld als Maß der Werte, das als die verselbstständigte Gestalt des Warenwerts auftritt und das das maßgebliche kapitalistische Prinzip, den abstrakten Reichtum, verkörpert. Die zentrale Bestimmungen aus dem „Kapital“ werden erstens aufgeführt und erläutert, zweitens mit dem Standpunkt der modernen Volkswirtschaftslehre konfrontiert, die mit Wert und Wertgesetz gar nichts anfangen kann. Drittens werden davon spezielle Erscheinungen wie die Ersetzung der Geldmaterie durch Papiergeld oder dessen Emanzipation von einer zugrundeliegenden (Gold-)Deckung abgetrennt und gesondert erklärt. Dies geschieht auch durch die Heranziehung weiterer Texte von Marx, etwa aus den „Grundrissen“, die heute gern als Beweis für den unabgeschlossenen, soll heißen: nicht schlüssigen Charakter der Marxschen Theorie präsentiert werden.
Mit der hier vorgestellten Einführungsschrift erspart man sich, wie bemerkt, nicht die Lektüre der betreffenden Passagen im „Kapital“. Aber sie leistet – gegen die zahlreichen Fehldeutungen und schon rein inhaltlich fehlgehenden Referate des Gemeinten – eine erste Orientierung darüber, womit man es bei der besagten Theorie des Werts zu tun hat.
Literatur
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), 150 Jahre ‚Das Kapital‘ und seine bürgerlichen Rezensenten: Der Marxismus – zu Tode interpretiert, vereinnahmt, bekämpft. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2017, S. 93-109.
- Patrick Eiden-Offe, Der alte Karl Marx. In: Merkur, Nr. 817, 2017, S. 66-75.
- Stephan Finsterbusch, Kathedrale des Kapitals. In: FAZ, 5.7.2017.
- Michael Heinrich, 150 Jahre „Kapital“ – und kein Ende. Unsystematische Anmerkungen zu einer unendlichen Geschichte. In: PROKLA, Nr. 188, Oktober 2017, S. 421-434.
- Ulrike Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung – Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir heute von Smith, Marx und Keynes lernen können. Frankfurt/M. 2016.
- Ulrike Herrmann, „Das Kapital“ und seine Bedeutung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 17-22.
- Karl Marx, Randglossen zu Adolph Wagners „Lehrbuch der politischen Ökonomie“. In: Marx Engels Werke MEW), Bd. 19, Berlin 1973, S. 355 - 383 (zit. als MEW 19).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx Engels Werke, Band 23, Berlin 1977 (zit. als MEW 23).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band. In: Marx Engels Werke, Band 24, Berlin 1971 (zit. als MEW 24).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. In: Marx Engels Werke, Band 25, Berlin 1983 (zit. als MEW 25).
- Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. In: Marx Engels Werke, Band 26, Teil 1-3, Berlin 1976 (zit. als MEW 26).
- Wolfgang Möhl/Theo Wentzke, Das Geld – Von den vielgepriesenen Leistungen des schnöden Mammons. München 2007.
- Philip Plickert, Der falsche Prophet. In: FAZ, 30.6.2017.
- Werner Plumpe, „Dies ewig unfertige Ding“ – „Das Kapital“ und seine Entstehungsgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 10-16.
- Roman Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ – Der Rohentwurf des Kapital 1857-1858. Band 1 und 2. 2. Aufl., Frankfurt/M. 1972. (Eine Neuauflage ist für 2017 geplant.)
- Johannes Schillo (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie. Hamburg 2015.
- Hans-Werner Sinn, Was uns Marx heute noch zu sagen hat. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 23-28.
- Gareth Stedman Jones, Karl Marx – Die Biographie (Originalausgabe: Karl Marx – Greatness and Illusion, 2016). Frankfurt/M. 2017.
Oktober
„Marx is back“, Vol. 7
Was war eigentlich Marx für einer – als Mensch betrachtet? Der biographische Unfug, bei der Würdigung eines Theoretikers nicht dessen Erkenntnisse, sondern die persönlichen Lebens-umstände zu thematisieren, liegt natürlich nahe, wenn der Ausgangspunkt, wie zur Zeit mal wieder, Jubiläumsfeierlichkeiten sind. Dazu weitere Hinweise der IVA-Redaktion.
Wenn der Gehalt der Marxschen Theorie heute wieder ernsthaft zur Diskussion stünde, müsste es unerheblich sein – so hieß es schon in „Marx is back“, Vol. 5 (IVA, Texte2017) –, wie das Privat- und Liebesleben, die Krankenakte oder der Kontostand des Betreffenden aussahen. Dann würde eben nicht das interessieren, was Ilona Jerger in ihrer Romanbiographie in den Mittelpunkt rückte und was in seriöser Form auch andere Lebensbeschreibungen beschäftigt: „Wie verbrachte er seine Tage? Was fürchtete und was hoffte er? Was sagt seine Sprache über ihn aus? Was bedeutete das ewige Pleitesein, seine unentwegten Krankheiten…“ (Jerger 2017, 273). Dass dieses Bedürfnis unausrottbar ist, zeigt nur, wie sehr sich die biographische Methode dazu eignet, Marx als einen erledigten Fall aus dem 19. Jahrhundert zu behandeln und seine Kritik zum Verschwinden zu bringen: Marx war ein Kind seiner Zeit – wer hätte das gedacht! Dabei gilt es allerdings zu differenzieren, wozu es im Folgenden einige Hinweise gibt.
Marx – der Rückwärtsgewandte
„Biografien zu Marx sind zahlreich, und es kommen immer neue, umfänglichere hinzu. Die jüngsten von ihnen, die maßgeblichen darunter angelsächsisch, haben epische Ausmaße angenommen.“ Das schreibt Thomas Steinfeld in seiner aktuellen Essay-Sammlung zum Marx-Jubiläum „Der Herr der Gespenster“ (2017, 24). Und er bemängelt etwa an den neueren Gesamtdarstellungen von Jonathan Sperber (2013) oder Gareth Stedman Jones (2016), dass sie allen persönlichen Details nachsteigen, um Marx als Gefangenen seiner Zeitumstände, als einen eher „rückwärtsgewandten romantischen Träumer“ (FAZ) zu porträtieren. „Beide Arbeiten stehen in einer Tradition, die mit großem Aufwand zu belegen sucht, dass Karl Marx und sein Werk maßlos überschätzt werden – und belegen allein schon durch die Größe der Anstrengung das Gegenteil.“ (Steinfeld 2017, 268)
Steinfeld hatte seine Kritik an Sperber auch schon in einer ausführlichen Rezension in der SZ formuliert: „Sperbers Biografie, so detailliert und sachlich sie erscheinen mag, hat eine polemische Spitze. Sie ist gegen jeden Versuch gekehrt, aus den Marx’schen Schriften etwas für die Gegenwart lernen zu wollen… Die zentralen Kategorien der marxistischen Lehre: die Arbeit und das Eigentum, der Mehrwert und das Kapital, der Markt und die Ware, finden sich in dieser Biografie an den Rand gerückt.“ (Steinfeld 2013) Steinfeld hielt zudem fest, dass diese Schieflage eine logische Folge des biographischen Ansatzes ist: Jede Etappe in der Entwicklung der Theorie wird unter diesem Blickwinkel zu einer biographischen Episode, im Werk spiegelt sich der Urheber. Die Person sei aber nicht von Belang. Es sei auch ein Abweg, sie umgekehrt als „leere Autorität“ aufzubauen, die gegen andere recht hatte. Vielmehr müsse es darum gehen, sich die Erkenntnisse anzueignen.
Das denunziatorische Interesse der biographischen Herangehensweise ist auch anderen Autoren aufgefallen, die nicht unbedingt wie Steinfeld die Marxsche Erklärung des Kapitalismus weiterhin für relevant halten. „Statt ‚eines Zeitgenossen, dessen Ideen die moderne Welt prägen‘, zeichnet Sperber Marx als einen ‚rückwärtsgewandten Menschen‘, der ganz dem frühen 19. Jahrhundert verhaftet geblieben sei und für ein Verständnis des modernen Kapitalismus und der Gegenwart wenig beizutragen habe. Im Übrigen stimme das, was Marx selbst geschrieben und vertreten habe, ‚wenn überhaupt, nur und hier und dort mit dem überein, was spätere Freunde und Feinde in seinen Schriften fanden‘“, referierte Gerd Koenen (2013) Sperbers Marx-Biographie in der FAZ und fragte: „Beruhte die ganze, epochale Wirkung dieses Werks und seines Urhebers also auf einem Missverständnis?“ Der Ex-Maoist Koenen ist zwar in Deutschland einer der führenden, biographisch gewendeten Antikommunisten, der ja auch jüngst noch einmal in seinem Opus Magnum den Kommunismus als Ausfluss einer romantischen Ursehnsucht der Menschheit enthüllt hat (vgl. Koenen 2017). Die angelsächsische Abfertigung wollte er aber so nicht stehen lassen. Er vermisste Ausgewogenheit bei der historischen Einordnung: Vor der enormen Wirkungsgeschichte der Marxschen Theorie sollte man schon einigen Respekt aufbringen!
Ähnliches war in der FAZ über die andere große Biographie von Gareth Stedman Jones zu erfahren. „Karl ist ein Träumer. Und er wird es sein Leben lang bleiben. Vor allem in den letzten Jahren seines Lebens… Marx’ Interessen folgten seinen Launen und den Moden der Zeit. In der Jugend waren es die Literatur, die Juristerei, die Religionskritik und die Philosophie. Später konzentrierte er sich auf die Ökonomie. Mit Wissenschaft hatte das nicht allzu viel zu tun.“ (Hank 2016) So resümierte Rainer Hank, Wirtschaftsredakteur der FAZ, das Ergebnis der biographischen Forschungen von Stedman Jones, Professor der Ideengeschichte an der Queen Mary University in London, der übrigens Marx in seinem fast 900 Seiten dicken Opus penetrant beim Vornamen nennt (von wegen „Kind“ seiner Zeit!). Die Einordnung des Kapitalismuskritikers als Repräsentant einer verflossenen Epoche erscheint dem Fachmann aus der Wirtschaftsredaktion im Grunde plausibel. „Marx muss man aus der Zeit verstehen, oder man versteht ihn gar nicht. Ihn aus seiner Zeit zu verstehen, heißt aber: Karl Marx war und blieb ein Romantiker, was keine Abwertung ist… Nirgends wird das deutlicher als in seinen späten Schriften, wo er wieder ganz zum rückwärtsgewandten romantischen Träumer wird. Den ersten Band des ‚Kapitals‘ hatte Marx vollendet; an einem zweiten oder dritten Band zur Fortsetzung hatte er, wiewohl versprochen, die Lust verloren.“ (Hank 2016)
Hank hält Stedman Jones zugute, dass er die romantische Grundposition des (pseudo-)wissenschaftlichen Kommunisten belegt habe – Weltfremdheit als Signum der Zeit, verbunden mit humanistischen Impulsen und gewissen Idealen von Gemeinschaftlichkeit, die aber auch in eine bedenkliche Richtung ausarten können. Der biographischen Interpretation zufolge hat sich Marx nach der Veröffentlichung des „Kapital“ von der Politökonomie ab- und anderen Themen zugewandt, speziell altgermanischen Vergemeinschaftungsformen, der dörflichen Allmende und dem kommunalen Gemeinbesitz. „Er hängt einem germanischen Traum einer sozial friedlichen Welt an, die bis zum Mittelalter Bestand gehabt haben und dem römischen Ausbeuterrecht überlegen gewesen sein soll. Auch solche Mythen haben bis in das 20. Jahrhundert überlebt, nicht zuletzt hierzulande, bekanntlich aber eher nicht in sozialistischen oder kommunistischen Kreisen. Womöglich hoffte Marx, dass diese Urdörfer und Stämme das Geheimnis eines anderen Weges zur postkapitalistischen Gesellschaft bergen könnten. Gerade seine deutschtümelnde Sehnsucht – mit Abschweifungen in russische Dörfer – könnte der Grund dafür gewesen sein, dass diese Stammesmythologie später als peinlich unterdrückt und alsbald vergessen wurde.“ (Hank 2016)
Marx – der Vorwärtsgewandte
Wenn man Ingo Elbe folgt, hat auch die vor Jahren erschienene Biographie von Francis Wheen (2002) nicht mehr zu bieten. Sie tritt demnach nicht gleich wie die beiden genannten Werke mit dem Interesse der Zurückstufung und Historisierung an, gibt sich auch Mühe, gegen die Zerrbilder aus den Zeiten des Kalten Kriegs und des verordneten Antikommunismus einige wohlwollende Elemente in die Beurteilung des „Menschen Marx“, so der Hauptgegenstand des Buchs, einzuführen. „Dennoch ist man nach der Lektüre eher um viele Anekdoten reicher als um einen Deut klüger.“ (Elbe 2002) Auf über 500 Seiten erfährt man „buchstäblich nichts über Marx’ Kritik der Formen des gesellschaftlichen Reichtums (Ware, Geld, Kapital, Recht und Staat), nichts darüber, dass erst seine Theorie diese als nur scheinbar naturgegebene Tatsachen dechiffriert und damit der menschlichen Gestaltungs- und Veränderungskompetenz zugänglich macht.“ (Ebd.)
Aber wie gesagt, in diesem Zusammenhang muss man differenzieren. Im September 2017, auf den Tag genau 150 Jahre nach Erscheinen des „Kapital“, legte der Bertelsmann-Verlag die neue, große Gesamtdarstellung „Marx – Der Unvollendete“ des Wirtschaftspublizisten Jürgen Neffe, Verfasser einer Einstein- und Darwin-Biographie, vor. Zu dieser Publikation wäre im Einzelnen vieles zu sagen, die oben geäußerte Kritik trifft auf sie aber nicht zu. Sie geht zwar auch episch ziemlich in die Breite, will Marx jedoch nicht historisieren, sondern seine Vorwärtsgewandtheit herausstellen. Neffe nimmt für sich in Anspruch, als Nicht-Marxist einen unvoreingenommenen Blick auf den wissenschaftlichen und sozialen Revolutionär Marx geworfen zu haben. Er stellt auch einiges im Blick auf die Verleumdungen der antikommunistischen Tradition richtig – einer Tradition, die mittlerweile über 150 Jahre alt ist (die erste einschlägige, übrigens antisemitische Schmähschrift gegen Marx veröffentlichte 1850 der Journalist Eduard von Müller-Tellering zur Entlarvung des ehemaligen Chefredakteurs der Neuen Rheinischen Zeitung, dieses „feigen, Blutsäure knirschenden Juden, Schurken und Arbeiterexploiteurs…“). Aber das ist nicht das Hauptinteresse des Autors. Er will mit seinem Buch einen Zugang zur theoretischen Leistung von Marx schaffen. Gegen übliche hermeneutische Bedenken – aus dem bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb oder der marxistischen Tradition – votiert er dafür, zurück zum Original zu gehen, also die Marxschen Hauptwerke, darunter natürlich an erster Stelle das „Kapital“, unter die Lupe zu nehmen. Es lohne sich, „die Texte wie frisch entdeckt zu lesen, um sich dann erst mit ihrer Herkunft und Zukunft zu beschäftigen“ (Neffe 2017, 126).
Die Stärke von Neffes Buch liegt darin, dass es sich von der Kammerdiener-Perspektive löst und im Grunde eine intellektuelle Biographie liefert, also dem Werdegang der Theorie nachgeht. Dazu ist in die beiden Hauptteile jeweils ein umfangreicher Theorieblock eingefügt (Kapitel 8: „Die Entwicklung der Marxschen Gedankenwelt“ und Kapitel 23: „Das Kapital – eine Schauergeschichte“). Der Lebenslauf gibt natürlich auch hier den roten Faden ab, dieser Blickwinkel wird nicht aufgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob Michael Heinrich, der ebenfalls eine Marx-Biographie angekündigt hat, dem noch viel Neues hinzufügen kann. Da seine Arbeit allerdings auf drei Bände angelegt ist – der erste soll Anfang 2018 erscheinen –, wird sie natürlich weiter ausholen können. Nur bleibt ihr dann auch nichts anderes übrig, als sich auf dem mittlerweile ziemlich breit getretenen biographischen Pfad zu bewegen und in diesen Rahmen die Erkenntnisse zur Kritik der kapitalistischen Produktionsweise einzufügen.
Der Spiegel hat Neffes Buch eine Rezension gewidmet, die an die breite biographische Aufarbeitung seit Franz Mehrings erster großer Darstellung aus dem Jahr 1918 erinnert (vgl. Mehring 1976). Mehrings letztes großes Werk war im Zuge der Auseinandersetzungen der sozialistischen Bewegung entstanden, hatte insofern einen anderen Ausgangspunkt als Neffes Arbeit. Dass solche Vorarbeiten aber zu einer „fast unüberwindbaren Schwierigkeit“ für die Nachgeborenen geführt haben sollen – „Mit Marx lässt sich nicht unbefangen umgehen“ (Leick 2017, 8) –, ist nicht einleuchtend. Neffe demonstriert das Gegenteil. Er geht immer wieder auf solche Vorläufer ein und ist durchaus in der Lage, dem Leser die Unterschiede zwischen Marxschen Positionen und daran anschließenden Interpretationen deutlich zu machen. Sein Resümee der Marxschen Ökonomiekritik würdigt die Spiegel-Rezension bezeichnender Weise nur obenhin. Der Rezensent konzediert, dass die Marxschen Begriffe „noch immer das Lebensgefühl der Moderne zum Schwingen bringen“ können (ebd., 9); doch soll dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Marx ein „profaner Metaphysiker“ und sein „Weltmodell“ im Grunde ein „Kunstwerk“ war (ebd., 8).
Der Spiegel wollte auch nicht am 150. Jahrestags des Erscheinens von Band 1 des „Kapital“ vorbeigehen und griff dafür passender Weise – die Redaktion sitzt ja in Hamburg – die Veröffentlichung „Karl Marx in Hamburg“ von Jürgen Bönig (2017) auf. Marx hatte sein „Saubuch“, wie er bei der Abfassung stöhnte, im Hamburger Verlag von Otto Meissner herausgebracht und war zur Drucklegung 1867 nach Hamburg gereist. Dazu kann man natürlich einiges erzählen, auch Abbildungen sind vorhanden. Neffes Buch wird dabei vom Spiegel en passant gewürdigt, es hat möglicher Weise auch Modell gestanden für die Parallelisierung von Aussagen der Kritik der politischen Ökonomie mit heutigen Zeiterscheinungen, wie sie die Autorin Barbara Supp vornimmt: „Es geht auch um unsere Gesellschaft und wenn in diesem Wahlkampf das große Ganze wichtig gewesen wäre…, dann hätte guten Stoff in diesem Buch gefunden, wer danach sucht. Ungleichheit. Gerechtigkeit. Die Rolle von Politik und Ökonomie.“ (Supp 2017, 72). Dass das „Kapital“ unlesbar ist, muss dabei mehrfach betont werden, was zu dem Fazit führt: „Man kann beides herauslesen: Auf zur Reform. Auf zur Revolution.“ (Ebd., 79) In der entscheidenden Frage ist nach dem großen Wurf also angeblich noch alles offen. Aber in einer Sache ist sich die neue Marx-Renaissance im Jubiläumsbetrieb sicher: Marx war zwar die längste Zeit seines Lebens staatenlos, aber seine Heimat war Deutschland und Städte wie Trier, Bonn, Berlin, Köln oder Hamburg können einen Teil des Erbes für sich beanspruchen. Das wirkt nun in Gedenktafeln, Stadtrundgängen, Museen fort. Das war‘s dann auch.
Literatur
- Jürgen Bönig, Karl Marx in Hamburg – Der Produktionsprozess des „Kapital“. Hamburg 2017.
- Ingo Elbe, Menscheln mit Marx – Bemerkungen über die freundliche Entsorgung der Marxschen Theorie (Rezension zu Wheen, Karl Marx). 2002. Online: https://www.uni-oldenburg.de/.../user.../ingo.elbe/.../(9)_Marx-Literatur_2001-09.pdf.
- Rainer Hank, Karl Marx: Ein echter Romantiker (Rezension zu Stedman Jones, Karl Marx). In: FAZ, 11.9.2016.
- Ilona Jerger, Und Marx stand still in Darwins Garten. Roman. Berlin 2017.
- Gerd Koenen, Ein revolutionärer Denker sieht aber anders aus (Rezension zu Sperber, Karl Marx). In: FAZ, 26.5.2013.
- Gerd Koenen, Die Farbe Rot – Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. München 2017.
- Roman Leick, Doppelcharakter (Rezension zu Neffe, Marx). In: Literatur Spiegel, Oktober 2017, S. 8-9.
- Franz Mehring, Karl Marx – Geschichte seines Lebens (1918). In: F.M., Gesammelte Schriften, Bd. 3, Berlin 1976.
- Jürgen Neffe, Marx – Der Unvollendete. München 2017.
- Jonathan Sperber, Karl Marx – Sein Leben und sein Jahrhundert. München 2013.
- Gareth Stedman Jones, Karl Marx – Die Biographie (Originalausgabe: Karl Marx – Greatness and Illusion, 2016). Frankfurt/M. 2017.
- Thomas Steinfeld, Leere Autorität (Rezension zu Sperber, Karl Marx). In: SZ, 1.8.2013.
- Thomas Steinfeld, Der Herr der Gespenster – Die Gedanken des Karl Marx. München 2017.
- Barbara Supp, „Dieses Saubuch“ – Vor 150 Jahren ist es in Hamburg erschienen: „Das Kapital“… In: Der Spiegel, Nr. 39, 2017, S. 72-79.
- Francis Wheen, Karl Marx (Originalausgabe: Karl Marx, 1999), München 2002.
September
„Marx is back“, Vol. 6
Aktualität wird heute nicht nur der Marxschen Ökonomie-, sondern auch der Religionskritik bescheinigt. Dabei bleibt allerdings von Anliegen und Gehalt der materialistischen Auseinandersetzung mit dem Jenseitsglauben nicht viel übrig. Näheres dazu in einem Kommentar der IVA-Redaktion.
„Die Religion gewinnt in den letzten Jahren gesellschaftspolitisch wieder an Bedeutung. Da wäre beispielsweise die Tea-Party-Bewegung in den USA… In Lateinamerika stellt das evangelikale Christentum eine zunehmend einflussreiche soziale Bewegung dar… In Teilen Afrikas stehen evangelikal-christliche Kräfte mit der Verfolgung von Menschen aus der LGBT-Community in Verbindung. In Frankreich mobilisieren rechte Gruppierungen Hunderttausende, vor allem aus den kulturkonservativen, katholischen Milieus, zu Demonstrationen gegen die Homo-Ehe. Und in Teilen Osteuropas scheint sich ein neuer Block an der Macht herauszubilden, der aus Versatzstücken postkommunistischer Staatsapparate, nationalistisch-faschistischer Bewegungen und den durch den Kommunismus hindurch relativ stabil gebliebenen Kirchenstrukturen besteht. Und dann wäre da nicht zuletzt der politische Islam…“ (Müller 2014)
Diesen Trend kann man nicht bestreiten. Im Zuge der antiislam(ist)ischen Feindbildpflege hat aber nicht nur Religion, sondern auch Religionskritik, jedenfalls in der Öffentlichkeit des Westens, gesellschaftspolitisch wieder an Bedeutung gewonnen. Hier wird speziell das Erbe der Aufklärung beschworen und gegen den rückständigen Islam in Stellung gebracht, wobei kurioser Weise – bis hinein ins christdemokratische Milieu – explizit oder summarisch an die Marxsche Religionskritik angeknüpft oder zumindest erinnert wird. In dem Zusammenhang ist freilich eine eigenartige Tendenz zu verzeichnen. Angeblich soll es bei der aufklärerischen Kritik der Religion um deren Modernisierung, also gewissermaßen um eine Rettung gegangen sein. Mehr noch: In die Marxschen Schriften wird eine Interpretation hineingelesen, der zu Folge ihr Autor die frühe Religionskritik, wie sie 1844 in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern formuliert wurde („Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie…“, MEW 1), später widerrufen habe, weil mit dem „Kapital“ – siehe den berühmten Abschnitt über den Fetischcharakter der Ware – der Kapitalismus als die eigentliche Religion ins Visier geraten sei, der man ideologiekritisch zu Leibe rücken müsse.
So kommt gerade unter Marxisten – wie die Zeitschrift Das Argument 2012 in einer dem Schwerpunkt Religion gewidmeten Ausgabe exemplarisch vorführte (vgl. Schillo 2015) – eine Absage an die Religionskritik des jungen Marx in Umlauf. Nicht mehr die Religion soll Kritik verdienen, sondern der Götzendienst des Mammons, der Tanz ums goldenen Kalb, den der Kapitalismus veranstalte und der gerade vom Standpunkt des abendländischen Monotheismus aus verwerflich sei, ja durch Kirchenmänner wie Papst Franziskus oder – in historischer Perspektive – den Reformator Luther am Entschiedensten bekämpft werde (vgl. Segbers/Wiesgickl 2015, Schillo 2017). Die Religion vollführt demnach heute das Geschäft der Kritik, Religionskritik wird überflüssig, ja schädlich. „Religionen sind“, so Rolf Bossart im Argument, „auch als Orte permanenter Religionskritik aufzufassen“, woraus dann die Notwendigkeit einer permanenten Kritik „jeglichen – auch des atheistisch-aufgeklärt sich verstehenden – Glaubens“ abgeleitet wird (Bossart 2012, 683). Das Fazit dieser eigentümlichen Umkehrung lautet: Jede Äußerung zu religiösen oder Sinnfragen ist Glaube; wer die Vernünftigkeit des Glaubens bestreitet, glaubt selber an etwas und ist damit im Grunde unaufgeklärter als der religiöse Mensch, der in seiner Glaubensgemeinschaft mit permanenter Religionskritik vertraut gemacht wird.
Das Ende der Religionskritik
Man kennt dies als populären Argumentationstrick: Theisten glauben an Gott, Atheisten an die Gottlosigkeit; wer nicht an die Schöpfungsgeschichte glaubt, sondern sich von Darwins Evolutionslehre überzeugen lässt, ist wissenschaftsgläubig; wer die Sinnfrage zurückweist, glaubt an die Sinnlosigkeit des Daseins etc. Die Revision der Marxschen Position, die ebenfalls mit solchen Versatzstücken arbeitet, beruft sich nun bemerkenswerter Weise auf Marx selbst. Dieser habe sich als Kritiker auf das Feld der politischen Ökonomie begeben, die Religionskritik also hinter sich gelassen und sie mit den Ausführungen zum „Fetischcharakter der Ware“ im ersten Band des „Kapital“ (MEW 23, 85ff) auf die Ökonomie bezogen, somit die Religion im eigentlichen Sinne aus der Kritik entlassen und dafür eine ökonomische „Zivilreligion“ ins Visier genommen. Das ist eine erstaunliche Fortsetzung der religiös interessierten Auslegung, die sich den Frühschriften widmet.
Letztere wird übrigens teilweise (siehe Haug 2016) als eine schiefe Kombination von zwei Aufsätzen des jungen Marx vorgenommen, nämlich der erwähnten Einleitung zur Hegel-Kritik und des Textes „Zur Judenfrage“ (1844). Der erstgenannte beschäftigt sich in der Tat mit der Religion, liefert die bekannten Sprachbilder vom „Seufzer der bedrängten Kreatur“, dem „Geist der geistlosen Zustände“ oder dem „Opium des Volkes“ und resümiert die bis zu Feuerbach geleistete Religionskritik als eine Aufgabe, die „im wesentlichen beendigt“ sei (vgl. MEW 1, 378; bei Schillo 2015 ist diese Position nochmals zusammengefasst). Der andere Aufsatz befasst sich nicht mit dem Thema Religion, sondern mit den republikanischen Freiheitsrechten, speziell der Religionsfreiheit, die im Staat allen Bürgern, damit auch den Juden, gewährt werden müssten. Oder auch nicht, wie der Junghegelianer Bruno Bauer damals in einer Schrift behauptete. Sein Argument lautete: Erst sei der preußische Staat zu liberalisieren, bevor einzelne Kollektive in den Genuss der vollen Religionsfreiheit kommen könnten. Gegen diese Position bezog Marx in seinem Aufsatz Stellung und entwickelte daraus eine Kritik der Menschenrechte, die ihm nicht als Maßstab der menschlichen Emanzipation galten, sondern die Frage nach der menschlichen Emanzipation offen ließen. Zu deren Beantwortung müsse man erst die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, die in der ökonomischen Basis zu finden sei, studieren.
Marx hat also die Auseinandersetzung mit der Religion nicht fortgeführt. Die für ihn erledigte Aufgabe legte er beiseite, wandte sich der Ökonomie zu und sah hier das Projekt seiner Kritik. Im „Kapital“ stellte er dann bei der Analyse der Ware fest, dass diese kein „selbstverständliches, triviales Ding“ ist, sondern ein widersprüchliches gesellschaftliches Verhältnis einschließt (MEW 23, 85). Um dies zu erläutern, genauer gesagt: die vorhergehende Analyse des ersten Kapitels zusammenzufassen, suchte er nach einer Möglichkeit der Veranschaulichung und wählte die Methode des Vergleichs. Er machte auch sein Verfahren explizit kenntlich: „Um (…) eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten.“ (Ebd., 86) Es ging ihm also um eine Analogiebildung zwecks Verdeutlichung der Kritik – nicht als Erklärung selber, sondern korrekter Weise im Anschluss an die ersten drei Abschnitte der Waren- und Wertanalyse, die für das Verständnis der Kapitalverwertung konstitutiv sind und die die Erklärung geleistet hatten. So kam Marx auf die Ähnlichkeit der Warenproduktion mit dem Fetisch zu sprechen. Der Fetisch diente ihm als vergleichendes Beispiel dafür, wie Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhang, den sie selber mit Willen und Bewusstsein herstellen, als eine fremde, ihnen gegenübertretende Macht erleben. Es geht im „Kapital“ also nicht mehr um Religionskritik. Die Kritik ist vielmehr bei dem eigentlichen, ein Vierteljahrhundert früher angekündigten Thema angekommen.
Bei Jens Rehmann, der gerade auf die Umkehrung des Verhältnisses von Religion und Kritik hinaus will, erscheint dagegen der Fortgang der Analyse, die sich auf einen neuen Gegenstand richtet, als Relativierung des theoretischen Ausgangspunkts: „Die marxsche Spezifik in der Behandlung des Religiösen wird man also nicht in inhaltlichen Bestimmungen als 'verkehrtem Weltbewusstsein' oder 'Opium des Volkes' usw. finden, sondern gerade in einem Paradigmenwechsel, der die religionsförmigen Verkehrungen im Recht, in der Politik und schließlich in den ökonomischen Entfremdungen der bürgerlichen Gesellschaft selbst aufdeckt.“ (Rehmann 2012, 658) Ein erstaunliches Resultat: Die Religionskritik soll man bei Marx gerade da finden, wo von ihr nicht mehr die Rede ist! Dabei kennt diese Art einer Marx-Revision Varianten. Dick Boer kreidet ganz prinzipiell und abstrakt, gemäß den Paradigmen moderner Wissenschaftstheorie, Marx drei Grundfehler an: „Auch für ihn war selbstverständlich: Es gibt das Phänomen 'Religion', deren 'Wesen' sich bestimmen lässt. Und eurozentrisch, wie er auch war, war die christliche Religion ihre höchste Form.“ (Boer 2012, 665) Zweimal gesetzte Anführungszeichen sollen zeigen, dass, wie vom modernen Pluralismus vorexerziert, weder ein Gegenstand noch dessen wesentliche Bestimmungen eine Selbstverständlichkeit sind.
Alles ist dem zu Folge vielgestaltiger, es gibt oder gab z.B. auch Christen, die sich für den Marxismus interessier(t)en. Für diesen Nachweis wird gerne die lateinamerikanische Befreiungstheologie herangezogen. Es ist schon erstaunlich, dass das zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschieht, wo die Sache eher einen nostalgischen Stellenwert besitzt. Leonardo Boff, ein ehemaliger Wortführer der marginalen, inzwischen untergegangenen Richtung, teilte noch unter dem Ratzinger-Papst mit, dass es sich bei der Begegnung von Christentum und Marxismus eher um ein Missverständnis gehandelt habe (vgl. sein Interview mit dem Spiegel, Nr. 50, 2012). Boff selber votiert mittlerweile – ähnlich wie der Dalai Lama – für „ökologische Spiritualität“ und sieht im kapitalistischen Aufbruch des emerging market Brasilien letztendlich auch einen Erfolg seiner heterodoxen theologischen Bemühungen. Papst Franziskus, früher ein Gegner der Befreiungstheologie, habe, so Boff neuerdings (im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger vom 25.12.2016), „die Befreiungstheologie zum Allgemeingut der Kirche gemacht“. Dem fügt er allerdings eine bemerkenswerte Ergänzung an: „Und er hat sie ausgeweitet. Wer von den Armen spricht, muss heute auch von der Erde reden, weil auch sie ausgeplündert und geschändet wird. ‚Den Schrei der Armen hören‘, das bedeutet, den Schrei der Tiere, der Wälder, der ganzen gequälten Schöpfung zu hören. Die ganze Erde schreit.“ Hier steht also, wie in der Umweltenzyklika „Laudato Si“ ausgeführt und wie bei IVA bereits kritisiert (vgl. „Religiöser Antikapitalismus“, Texte2017), „der“ Mensch „der“ Erde gegenüber – von marxistischen Kategorien wie Klassen oder Klassengesellschaft, die noch die katholische Soziallehre eines Oswald von Nell-Breuning kannte, keine Spur! Es ist schon merkwürdig, dass das historische Zwischenspiel einer Befreiungstheologie heute als maßgeblicher Bezugspunkt in religiösen Dingen gelten soll und dass daran wieder Interpretationen der Bibel als antiimperialistische Kampfschrift – „Der Gott der Bibel richtet sich gegen ökonomische Ausbeutung, Herrschaft und imperiale Fremdbestimmung…“ (Junge Welt, 29.12.2012) – oder als ein „atheistisches Buch“ (Boer 2012, 666) anknüpfen.
In diesem Zusammenhang kann man natürlich auch – wenn schon an die lateinamerikanischen Aufbrüche von vorgestern erinnert wird – den Vorwurf des Eurozentrismus erheben. Das geschieht bei Boer ganz formell, ohne nähere Begründung. Marx war schließlich Europäer. Und er hatte in seinem frühen Hegel-Aufsatz wohl auch die jüdisch-christliche Tradition vor Augen, ohne dass er übrigens vom Christentum als der „höchsten Form“ sprach. Marx ging von der faktischen Geltung der Religionen seiner Zeit aus, zu Anthroposophie, Islamismus oder Scientology konnte er sich wirklich nicht äußern. Und was er mit seinem abendländisch orientierten Ansatz aus dem Blick verloren haben soll, ist nicht ersichtlich. Besonderheiten des Christentums wie Trinitätslehre oder Christologie sind bei ihm kein Thema. Bezeichnend auch, dass Boers Einspruch sich auf das Allgemeine, alle Religionen Auszeichnende bezieht, auf den von der Kritik hervorgehobenen Tatbestand, dass der Mensch die Religion macht. Boer kontert (ebd., 668): „Die Erfahrungen, die in der Religion mythologisiert werden, sind nicht menschlich 'gemacht'“. Ideologiekritik wird schlichtweg verworfen, das „Argument“ besteht allein in der Berufung aufs religiöse Selbstbewusstsein, das sein Gedankenprodukt als Ausfluss einer höheren Realität vorstellig macht.
Zurück zum höheren Wesen
Zum Marx-Jubiläum wird von verschiedenen Seiten diese seltsame Umwidmung der Religionskritik wieder ins Spiel gebracht, so paradigmatisch von Wolfgang Fritz Haug (2016). Auch bei Christoph Henning (2005, 362ff) finden sich schon Anklänge an diese These, während das neue Marx-Handbuch (Kehrer 2016, 399ff) korrekter Weise einen Abriss des gespannten Verhältnisses von Christen und Marxisten seit dem 19. Jahrhundert bietet (und dabei auch die Defizite der Religionswissenschaft zur Sprache bringt). Haug schreibt: „Indem Marx die Religionskritik als Fundus von Metaphern und Topoi für die Kapitalismuskritik nutzt, entsteht ein eigentümlicher Rückstoßeffekt, der die Frage nach der Religion aus ihrer kapitalistisch-bürgerlichen Abfertigung freisetzt und neu zu stellen erlaubt“ (Haug 2016, 861). Dabei wird als Gewährsmann für diesen eigentümlichen Rückruf der Kritik vor allem Ernst Bloch mit seiner Schrift „Atheismus im Christentum“ (1968) genannt. Jüngst hat Bruno Kern ein Buch zur Religionskritik von Karl Marx vorgelegt (Kern 2017), das die Junge Welt mit einer lobenden, aber etwas unentschiedenen Rezension bedacht hat (JW, 18.9.2017). Es bringt diesen Rückstoß noch einmal auf den Punkt – im Prinzip zustimmend, wenn man seiner Einleitung „Warum, um Himmels Willen, Marx?“ folgt. Schlüssig ist auch das nicht. Drei Punkte seien hier genannt.
- Kern beschwert sich über eine „Marx-Scholastik“, die „ebenso gekonnt wie unfruchtbar mit Begriffen hantiert“ (Kern 2017, 9). Er selber versteht sich aber genauso auf scholastische Wortklauberei (wobei die ständigen Anführungszeichen bei seinen zentralen Kategorien wohl dafür stehen, dass er sich im Zweifelsfall darauf berufen kann, es sei alles nicht so gemeint). So heißt es bei ihm, Glaube sei das genaue Gegenteil von Fundamentalismus. „Er ruht nicht auf theoretischen ‚Gewissheiten‘ auf, die man einem ‚ungläubigen‘ Gegner um die Ohren haut. Glaube ist, wie auch der Atheismus, eine existenzielle Stellungnahme zum eigenen Dasein und zur Wirklichkeit insgesamt.“ (Ebd., 10) Hier löst sich der Gegenstand, um den es geht, in eine nebulöses Gebilde auf; der Unterschied von Glauben und Wissen verschwimmt; Umgangsformen mit Gegenpositionen (Aufdringlichkeit, Aggressivität…) werden kontrafaktisch zur Bestimmung der Sache herangezogen. Das erinnert an Helmut Gollwitzers Trick, der Religionskritik dadurch den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man pauschal die Marxsche Position bejaht, „da der christliche Glaube keine Religion sei (Religion sei grundsätzlich menschengemachte Ideologie)“ (Kehrer 2016, 400). Bei Kern wird der Glaube, der doch für seine Anhänger das Fundament ist, auf dem die Deutung ihres Daseins ruht, zu einer Stellungnahme neben anderen – so wie jeder sie aus seinem Alltag kennt. Das Spezifische des Standpunkts wird zum Verschwinden gebracht. Dabei ist doch gerade in den Offenbarungsreligionen das Wort Gottes die unhintergehbare Leitschnur des gläubigen Menschen und das christliche Credo spricht all die Gewissheiten von Alpha bis Omega, vom Anfangs- bis Endpunkt des Kosmos, aus und schreibt sie als verbindliche Lehre fest. Zwei Seiten später fällt Kern dann ein, dass der Glaube „Letztbegründung“ ist und dem Gläubigen „Letztmotivation“ liefert. Es handelt sich eben um einen letzten Halt, um eine letzte Gewissheit. Die gibt denjenigen, die sich die Sinnfrage vorlegen, ja gerade die Kraft, die Härten des modernen Daseinskampfes auszuhalten – normalerweise als Einzelkämpfer in den Widrigkeiten der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft, bei Kern in der Ausnahmeform, dass ein randständiger oppositioneller Standpunkt sich selber Mut zuspricht.
- Für den oben genannten Taschenspielertrick, alle Menschen als Gläubige zu vereinnahmen, kann Kern sogar einen Gewährsmann angeben, den französischen Philosophie-Professor André Comte-Sponville. Der hat 2006 ein Buch „Woran glaubt ein Atheist?“ veröffentlicht, in dem es zur (Nicht-)Existenz Gottes heißt: „Ich habe keine Beweise. Niemand hat welche. Aber ich habe eine bestimmte Anzahl von Gründen und Argumenten, die mir stärker erscheinen als jene, die für das Gegenteil sprechen… Ich behaupte nicht, zu wissen, dass Gott nicht existiert; ich glaube, dass er nicht existiert…“ (Zit. nach Kern 2017, 11) Der Philosoph gibt gleich mit dem Untertitel seines Buchs „Spiritualität ohne Gott“ zu erkennen, dass es ihm darum geht, im friedlichen Wettbewerb mit seinem Gegenpart eine Weltanschauung zu kreieren, die als innerweltliches Pendant dieselbe übersinnliche Dimension abdeckt und damit auch denselben sittlichen Rang besitzt. Ein apartes Bedürfnis – zu dem man einiges sagen könnte! Im hier zur Rede stehenden Zusammenhang ist jedoch als Erstes der Widerspruch festzuhalten, der sich zu Kerns eigener Position ergibt. Der zu Folge ist der Glaube ja nicht ein Abwägen zwischen Wahrscheinlichkeiten, sondern stellt ein existenzielles Statement dar, das sich, wie es weiter heißt, „nie völlig theoretisch ‚einholen‘ lässt“ (ebd.). Das trifft zu. Ginge es in dieser Sache nämlich um eine theoretische Streitfrage, müsste man sich um Gründe bemühen, Pro und Contra abwägen, Erkenntnisforschritte abwarten etc. – und der Glaube hätte hier alle Berechtigung verloren. Er käme höchstens, im Sinne der erweiterten Wortbedeutung des Verbs „glauben“, als unsicheres Wissen ins Spiel, wäre also etwas Vorläufiges, Hypothetisches und nicht der existenzielle Akt, den der Mensch in seinem „Freiheitsvollzug“ (ebd.), also rein als Leistung seines Willens, zustande bringt. Und das Geschäft der Religionskritik, so wie es Marx gefordert bzw. resümiert hat, besteht ja gerade nicht in der Propaganda einer gottlosen Welt, sondern in der Befragung des gläubigen Menschen darauf, welche geistigen Leistungen er mit seiner Entscheidung zustande bringt. Der Beweis einer Nichtexistenz von etwas wäre zudem ein kurioses Unterfangen! Mit dem plagt sich normaler Weise auch keiner ab. Vielmehr bringt derjenige, der glaubt, erst mit seiner „Letztbegründung“ in das Getriebe der Menschen, die ihren Verstand mal besser oder schlechter zur Daseinsbewältigung benutzen, den Standpunkt ein, dass es um etwas ganz Anderes, Letztes, Unhinterfragbares geht oder gehen müsste. Im profanen Getriebe haben es die Menschen mit Alltags- oder auch mit Luxus-Problemen zu tun, aber sie gehen nicht mit dem Programm ans Werk, dass kein Gott existiert. Die Frage nach dessen Existenz bewegt nur den religiösen Menschen, der sie damit seinen Mitmenschen aufmacht – meist aufdringlich, von den vorbürgerlichen Zeiten mit Staatskirchentum, Ketzerverbrennungen etc. bis zur Moderne, in der die Religion ja (siehe oben) in unterschiedlicher Form immer noch sehr präsent ist und allen möglichen Leuten um die Ohren gehauen wird (man denke nur an das penetrante Glockenläuten, das vielen Anwohnern den Schlaf raubt).
- Kern bringt dann wieder ausführlich eine Sache zur Sprache, die er für ein Argument hält: Es hat in der Tat seit der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts diverse Kontakte, Verbindungen, Vermischungen von Christentum und Marxismus gegeben. Aus den Beispielen, die Kern anführt, geht selber hervor, dass es sich um marginale, in der Hauptsache historische Erscheinungen handelt, in denen sich Christen Unterstützung bei Sozialisten holten oder in deren Lager wechselten (die besagte Befreiungstheologie) oder beide Seiten sich etwa zu Zeiten des Kalten Kriegs um die Erhaltung des Weltfriedens bemühten (Paulus-Gesellschaft, christlich-marxistischer Dialog zwischen West- und Ostblock). Was auch immer dazu zu sagen wäre: Die gleichzeitige Berufung auf Marx und Jesus (und eventuell noch weitere Autoritäten) mag es bei Einzelnen oder Gruppen geben, sie sagt aber nichts über den Status von Religionskritik aus oder über die Kompatibilität von wissenschaftlichem Sozialismus und christlichem Glaubensbekenntnis. Ja solche Berufung sagt noch nicht einmal etwas darüber aus – siehe die marxistische Staatspartei in China oder die staatstragenden christlichen Parteien in Deutschland –, ob an solcher Bezugnahme mehr dran ist als die Absicherung durch eine klangvolle Tradition oder einen praktisch folgenlosen Überbau.
Kern ist auch, trotz aller Beschwörung von Gemeinsamkeiten, das Trennende bewusst. So kommt er ausdrücklich zu dem Schluss, dass man Marx revidieren muss, um als Christ etwas mit ihm anzufangen. Um sich das „nach wie vor Gültige seines Denkens anzueignen, muss man es mutig und entschlossen von den Schlacken des 19. Jahrhunderts befreien. Man kann sich sein Denken nur dann fruchtbar zu eigen machen, wenn man es überschreitet.“ (Ebd., 10) Nichts gegen Revisionen, wenn sie sich aus der Sache ergeben und Fehler beseitigen! Hier ist aber erkennbar Revisionismus nur deshalb am Werk, weil die kritisierte Sache in Schutz genommen werden soll. Und diese Sache besteht, wohlgemerkt, in der Normalität der Religion im globalisierten Kapitalismus – und nicht in exzentrischen Positionen, etwa in einem Interesse an Marx, das einzelne Juden, Christen oder Muslime an den Tag legen mögen.
Literatur
- Dick Boer, Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik – Biblisch-theologische Notizen zum 'Ende der Religion'. In: Das Argument, Nr. 299, 2012, S. 665-671.
- Rolf Bossart, Die Rettung der Religionskritik vor ihren Verfechtern. In: Das Argument, Nr. 299, 2012, S. 683-692.
- Wolfgang Fritz Haug, Karl Marx‘ Metakritik der Religionskritik. In: Das Argument, Nr. 320, 2016, S. 861-879.
- Christoph Henning, Philosophie nach Marx – 100 Jahre Marxrezeption und die normative Sozialphilosophie in der Kritik. Bielefeld 2005.
- Günter Kehrer, Stichwort „Theologie/Religionswissenschaft“. In: Michael Quante/David P. Schweikard (Hg.), Marx-Handbuch, Stuttgart 2016, S. 399-402.
- Bruno Kern, „Es rettet uns kein höh’res Wesen“? Zur Religionskritik von Karl Marx – ein solidarisches Streitgespräch. Ostfildern 2017.
- Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung/Zur Judenfrage (Erstveröffentlichung: Paris 1844) In: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin 1974 (zit. als MEW 1).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Marx-Engels-Werke, Bd. 23, Berlin 1977 (zit. als MEW 23).
- Tadzio Müller, Politische Religion als neue Avantgarde? In: Luxemburg, September 2014, online: http://www.zeitschrift-luxemburg.de/politische-religion-als-neue-avantgarde/.
- Jens Rehmann, Für eine ideologietheoretische Erneuerung marxistischer Religionskritik. In: Das Argument, Nr. 299, 2012, S. 655-664.
- Johannes Schillo, Die Aktualität der Marxschen Religionskritik. In: J.S. (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Hamburg 2015, S. 131-149.
- Johannes Schillo, Mit Luther, Marx & Papst contra Kapitalismus? Zur Wiederentdeckung der Marxschen Theorie. In: Erwachsenenbildung, Nr. 3, 2017, S. 136-137.
- Franz Segbers/Simon Wiesgickl (Hg.), ›Diese Wirtschaft tötet‹ (Papst Franziskus) – Kirchen gemeinsam gegen Kapitalismus. Hamburg 2015.
„Marx is back“, Vol. 5
Das Interessanteste beim aktuellen Marx-Jubiläum scheint die Privatperson zu sein – diese verkrachte bürgerliche Existenz aus dem 19. Jahrhundert. Zwar sehr gelehrt, doch offen gesagt: als Familienmensch ein autoritärer Sack, voll von „wütendem Antisemitismus“ und mit null Ahnung in puncto Gender Mainstreaming. Dazu ein Kommentar der IVA-Redaktion.
Was Marx für ein Mensch (bzw. Unmensch) war, müsste – wenn der Gehalt seiner Theorie heute wieder ernsthaft zur Diskussion stünde – unerheblich sein. Das Bedürfnis, seinem Privat- und Familienleben nachzusteigen, ist aber unausrottbar. Und das hat seine Gründe. Dass Marx, wie ein breiter Konsens lautet, mit seiner Erklärung des Kapitalismus letztlich gescheitert ist, soll in charakterlichen Defekten begründet sein. Exemplarisch hat das noch einmal zum 150. Jubiläum des „Kapital“ das einschlägige Heft der Bundeszentrale für politische Bildung vorgeführt (vgl. „Marx is back“, Vol. 3, IVA, Texte 2017). Der Historiker Werner Plumpe befasst sich dort mit der biographischen Seite der „Kapital“-Entstehung und kommt zu dem Schluss, dass in diesem Fall ein tendenziell größenwahnsinniger Autor mit dem Anspruch einer Gesamterklärung angetreten ist und wegen der Fehlkonzeption seiner Analyse Schiffbruch erlitten hat. Immerhin habe Marx, der Krankheiten vorschob und seinen Sponsor Engels systematisch täuschte, das Scheitern durch die Nicht-Veröffentlichung von Band zwei und drei des „Kapital“ im Grunde eingestanden, die Dogmatisierung der Theorie sei dann durch die Nachfolger erfolgt (Plumpe 2017).
Im neuesten Marx-Roman von Ilona Jerger „Und Marx stand still in Darwins Garten“ (2017), den Ullstein zum Spätsommer herausgebracht hat, wird der Ertrag biographischer Nachforschungen und entsprechender Interpretationen vom Standpunkt der Political Correctness zu Beginn des 21. Jahrhunderts anschaulich zusammengefasst. Demnach hat man es bei Marx mit einem zerrissenen, gescheiterten Charakter zu tun, der sein Leben am Ende als ein Trümmerfeld betrachten musste – im Unterschied etwa zu einem anderen Revolutionär der modernen Wissenschaft, Charles Darwin, der schließlich im Einklang mit der Natur einen Lebenssinn und damit vor seinem Tod noch zu einer gewissen Form von Religiosität gefunden haben soll (vgl. Schillo 2017). Marx dagegen verbleibt im Negativem, im Widerborstigen, wie es Jerger vor allem unter Berufung auf den Briefwechsel von Marx und Engels ausführlich schildert. Das wird zwar in aller dichterischer Freiheit ausgemalt – besonders bei der Umgestaltung Helene Demuths, der Haushälterin des Marxschen Familien- und Politikbetriebs, zu einer alten Betschwester –, stützt sich aber auf diverse biographische Vorarbeiten.
Jüngst hat der Soziologe Hans Jürgen Krysmanski übrigens in einer ebenfalls leicht romanhaft angelegten „Ideensammlung für einen Spielfilm“ (Krysmanski 2014, 9), auf authentisches Material gestützt, die letzten Monate des alten Revolutionärs rekonstruiert, der sich bei Darwins Tod ja nicht in England, sondern im Ausland aufhielt, nämlich auf eine Gesundheitsreise von Paris über Algier nach Monte Carlo. Bei Krysmanski kommen auch feministische Defizite von Marx zur Sprache (ebd., 53), er zeigt aber, dass das Bild vom polternden, widerborstigen Privatmann eine Karikatur ist – genau so wie das Bild der frommen Helene, die vor dem unnachgiebigen Atheisten zurückschreckt. Das Hauptinteresse des Autors gilt hier freilich einer – mit fiktiven Elementen angereicherten – Blickerweiterung, die Marx in den letzten Monaten seines Lebens erfahren haben soll: nämlich der Kenntnisnahme der globalen Macht, die von der Finanzspekulation ausgeht. Man kann Krysmanski zugute halten, dass er sich dabei auf Aussagen der Kritik der politischen Ökonomie bezieht (mit einschlägigen Verweisen auf das „Kapital“, Band 1 bis 3) und dass er speziell der Legende von der Unverständlichkeit des Werks, das alle Leser abgeschreckt haben soll, mit einleuchtenden Darlegungen entgegentritt. Die theoretische Debatte aber, die damit angestoßen wird, kann und will das Büchlein nicht führen.
Marx – der destruktive Atheist
Das Bild von Marx als einem Menschen, der die (jüdische) Religiosität in sich abtötet und dies auch seinen Kindern vorschreibt, hat exemplarisch vor einigen Jahren Eva Weissweiler mit ihrer Biographie über die Marx-Tochter Eleanor, genannt „Tussy“, gezeichnet. Die Biographin fasste im Radio-Gespräch das von ihr zu Tage geförderte „Drama der Vatertochter“ folgendermaßen zusammen: „Das offensichtlichste Drama, besser gesagt, die Tragödie, besteht ja darin, dass sie sich umgebracht hat mit 43 Jahren, und die ‚Schuld‘ daran kann man sicher nicht nur ihrem damaligen Lebensgefährten zuschieben… Wie die meisten Kinder eines Genies, ist es ihr nicht gelungen, auch nach seinem Tod, sich aus seinem Schatten zu befreien, sie wurde immer als Tochter von Karl Marx angesehen und sie litt auch durchaus sehr an der historischen Bürde, die ihr auferlegt war, das Erbe ihres Vaters adäquat der Nachwelt weiterzugeben… Ihr Problem war, dass sie sich im letzten Moment immer verpflichtet fühlte, eine orthodoxe Marxistin zu sein und die Lehren ihres Vaters zu befolgen“ (Pfister 2003). Der Biographin ist, wie sie mitteilt, schon früh, vor Abfassung ihres Buchs, aufgefallen, „in welch unbegreiflicher Form Marx nicht nur sein eigenes Judentum verleugnete, sondern auch gegen andere Juden Stellung genommen hat… also, wie man trivialpsychologisch sagen würde, der typische Selbsthass. Ich glaube, das war für Tussy eine schmerzliche Entdeckung, dass ihr geliebter Vater sich derartig antisemitisch geäußert hat. Und das war für sie nach seinem Tod ganz wichtig, da tätige Reue leisten… Sie hat – ohne sich für die jüdische Religion und Tradition näher zu interessieren… – versucht, eine Symbiose von Judentum und Sozialismus herzustellen, und ich denke, das ist ein ganz großes Verdienst von ihr.“ (Pfister 2003)
In Weissweilers Buch ist Marxens Ablehnung der jüdischen Religiosität – neben der Missachtung feministischer Anliegen – das Leitmotiv. Die Biographin schreibt über die jüngste Marx-Tochter: „Von der jüdischen Religion wußte sie so gut wie nichts.“ (Weissweiler 2002, 292). Nach dem Tod ihres Vaters agiert sie in der Arbeiterbewegung und „ohne es selbst zu wollen oder zu bemerken, bringt sie sich langsam aber sicher in den Ruf, nur die Thesen ihres verstorbenen Vaters nachzubeten, dessen Porträt wie eine Heilandsdarstellung an der Wand hängt.“ (Ebd., 288). Marx, „der es … für sich ablehnt, Jude zu sein und seine Herkunft verdrängt hat“ (ebd., 265), habe Religion strikt ausgeblendet. Dazu wird ein Bild der Marxschen Familie gezeichnet, das einer Brutstätte von Neurosen gleicht: Offene Aussprache kommt nicht vor, über der Religion hängt ein Tabu etc. Biographisch korrekt ist das übrigens nicht, denn Tussy hat durchaus von der Beschäftigung mit religiösen Themen berichtet. So schreibt sie in ihren Erinnerungen von einem Besuch in einer katholischen Kirche, wo sie als junges Mädchen mit ihrem Vater der „prächtigen Musik gelauscht“ habe und tief beeindruckt gewesen sei: „Mohr [Marx‘ Spitzname] setzte mir in seiner ruhigen Weise alles so klar und deutlich auseinander… Und wie er mir die Geschichte des Zimmermannssohnes erzählte, den die Reichen töteten, so einfach und erhaben!“ (zit. nach Marx/Engels 1967, 29f). Das passt nicht gerade ins Bild eines eifernden Atheisten. Aber das nur nebenbei.
Weissweilers Biographie „Tussy Marx“ (2002) will, so die Ankündigung des Klappentextes, „eine Fülle unbekannter Details aus dem Leben und Wirken von Karl Marx – etwa über seinen wütenden Antisemitismus“ liefern. Spezielle Fakten werden dazu allerdings nicht beigebracht. Es wird nur eingangs die alte Fehlinterpretation von Marx` Jugendschrift „Zur Judenfrage“ (1844) als antisemitisches Machwerk fortgeschrieben. Genauer gesagt, die Autorin will gar nicht in eine Diskussion über den Gehalt der Schrift eintreten; ihr ist die einschlägige Kontroverse bekannt, doch die soll nicht weiter interessieren. Sie setzt auch etwas anders an als die übliche Verballhornung des Marx-Aufsatzes, die ihm die Liquidierung des Judentums als Absicht unterstellt (vgl. die neuerdings wiederholten Vorwürfe bei Brumlik 2014). Weissweiler fährt nach einer summarischen, negativen Charakterisierung des Marx-Textes fort: „Es gibt viele Stimmen, die diese Schrift anders interpretieren, als nicht antisemitisch, ja sogar als progressiv. Es gibt meterweise Literatur über den ‚sogenannten‘ Marxschen Antisemitismus, der in Wirklichkeit nur Atheismus und Anti-Kapitalismus sei. Doch es geht hier nicht darum, diese Stimmen zu würdigen und zu zitieren. Es geht um den Eindruck, den die Abhandlung auf Tussy, die Tochter, gemacht hat, und der muß – jenseits aller späteren Theoriebildung – niederschmetternd gewesen sein, einen schweren Loyalitätskonflikt, schlimme Verwirrungen ausgelöst haben. Wie bewältigt sie diese Verwirrungen? Welche Mittel und Wege findet sie, auf ihre jüdische Herkunft stolz zu sein und den Vater trotzdem zu lieben?“ (Weissweiler 2002, 265)
Der Eindruck muss niederschmetternd gewesen sein. Das ist der Beweis der Biographin! Ein Vater, der sein ethnisch-religiöses Erbe in sich auslöscht und diese Leerstelle seinen Kindern aufzwingt, muss einen Vater-Tochter-Konflikt, ja eine Tragödie mit Spätfolgen wie Bulimie, Hysterie, Suizid provozieren. Die Methode besteht schlicht und ergreifend darin, in die Biographie der Marx-Tochter eine Problematik – „trivialpsychologisch“ – hineinzulesen, nämlich einen tiefgreifende Zwiespalt, der ihr Leben geprägt haben soll. Durch Zeugnisse aus der damaligen Zeit belegt ist das nicht. Das von Weissweiler referierte Material legt eher das Gegenteil nahe. Tussys späteres Engagement für die jüdischen Arbeitervereine in London oder für die jüdische Autorin Amy Levy zeigt, dass sich die Tochter nicht von ihrem Vater distanzierte, ihre Arbeit vielmehr in der Marxschen Tradition sah. „Tussy sah im Juden nur den Verfolgten, den sozial Geächteten, den Vertreter eines Volkes, dessen Erbe ihr Vater in sich auslöschen wollte“, zitiert Weissweiler aus dem zeitgenössischen Porträt des jüdischen Journalisten Max Beer (ebd., 292). Wie die Protagonisten der Arbeiterbewegung fühlte sich Tussy solidarisch mit dem Proletariat, mit den Ausgebeuteten jedweder Nationalität. Den armen jüdischen Arbeitern stand sie wohl besonders nahe, weil sie aus derselben Minorität stammte. Sich in dieser Form zum Judentum zu bekennen, war für sie kein ethnisches Anliegen, sondern ein soziales. „Wir Juden haben eine besondere Pflicht, für die Arbeiterklasse zu wirken“, zitiert Weissweiler Tussy nach der angegebenen Quelle (ebd., 289). Zum Judentum als nationalreligiöser Bewegung hielt sie, wie die Biographin vermerkt, dagegen Distanz. Die atheistisch-materialistische Position ihres Vaters zu revidieren, kam für sie nicht in Frage.
Diese religionskritische Position, die den Atheismus nicht einfach als eine weitere weltanschauliche Strömung versteht – als sittlich hochwertigen Standpunkt, der, wie moderne Agnostiker und Konfessionslose betonen, neben den bestehenden Religionsgemeinschaften seinen Platz im Pluralismus finden muss –, ist auch Jerger ein Dorn im Auge. Sie zielt mit ihrem Roman vor allem auf dieses weltanschauliche Defizit. Sexismus und Antisemitismus spielen bei ihr eine untergeordnete Rolle. Letzterer wird ganz in der Art Weissweilers als selbstverständliche Tatsache mitgeteilt, so wie es heute vom grünen Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik bis zur rechten Szene Konsens ist. Im Trierer Stadtrat gab es ja Anfang 2017 bezeichnender Weise von den Grünen und der AfD Protest gegen die Aufstellung einer Marx-Statue, die die VR China der Stadt als Geschenk angeboten hatte. Die Grünen wandten sich gegen das Angebot, weil durch dessen Annahme die Kommunistische Partei Chinas geehrt werde. Auch die AfD sprach sich während der Ratssitzung gegen eine solche Ehrung des berühmtesten Sohns der Stadt aus, und zwar mit der Begründung: „Marx hat die parlamentarische Demokratie abgelehnt. Zum Judentum hatte Marx ein schwieriges Verhältnis“. (Spiegel-Online, 14.3.2017)
In Jergers Roman wird die neugestaltete Figur der frommen Helene dafür eingesetzt, das religiöse Defizit deutlich zu machen. Als Vertreterin des einfachen Volks weiß sie, woher die Misere im Marxschen Haushalt rührt. Sie beklagt, „dass es in dieser Familie an Gott fehlt.“ (Jerger 2017, 55) Im Gespräch mit dem (erfundenen) Arzt Beckett äußert sie: „Wissen Sie, Herr Doktor, ein bisschen Frömmigkeit würde nicht schaden. Bei all dem Unglück! Es wird einem so kalt ums Herz, wenn man auf gar nichts hoffen darf.“ (Ebd.) „Keine Hoffnung mehr zu haben quält mich, besonders jetzt, wo wir alt werden… Der Himmel ist leer. Hat Mohr einmal gesagt. Wenn das stimmt, kommt mir das schlimmer vor als die Hölle… Ein wenig Gottesfurcht könnte auch Mohr nicht schaden.“ (Ebd.) Als wollte die Autorin Marx‘ Diktum von der Religion als Opium des Volkes bebildern, muss die trostreiche und aufbauende Funktion des Jenseitsglaubens beschworen werden, eben von einer Frau aus dem Volk. Ja, wenn‘s hart auf hart kommt, wenn‘s ans Sterben geht oder der Torwart Angst vorm Elfmeter hat, ist ein Stoßgebet oder ein Kreuzzeichen immer noch der nächstliegende Rettungsanker.
Helene Demuth gibt in dem Roman auch die Kronzeugin für Marx‘ Antisemitismus ab. So berichtet sie von dessen Vorfahren: „die Mutter eine fromme Jüdin und Tochter eines holländischen Rabbiners. Auch der Vater war Jude. Und seinerseits Rabbinersohn. Und Mohrs Onkel war der Rabbiner von Trier. Aber von alledem will Mohr nichts wissen. Wenn jemand ihn darauf anspricht, wird er, wie soll ich sagen…“ (Ebd., 115) Ihr Gesprächspartner souffliert, ein zentrales Charaktermerkmal der Romanfigur Marx beisteuernd: „Grob?“ Helene fährt fort: „Unwirsch, ja. Manchmal sagt er gegen Juden wüste Worte.“ Der Arzt teilt Darwin später das Gespräch mit: Eigentlich „hätte Karl Marx Rabbi von Trier werden können. Nichts hätte seine Mutter mehr gefreut.“ (Ebd., 138) Darwin hält das für ein bemerkenswertes Schicksal. Beckett: „Ja, das finde ich auch. Meine Intuition sagt mir, dass ein Beinahe-Rabbi, der das diesseitige Paradies verkündet, kein Zufall sein kann. Sein auserwähltes Volk hat er übrigens auch gefunden, es ist das Volk der Arbeiter.“ (Ebd.) Es wird sogar die Bibel mit ihren Aussagen über den Auszug der Juden aus Ägypten zu Rate gezogen. Darwin fragt: „Sie meinen, der verhinderte Rabbi Marx hat doch noch einen Weg gefunden, den Menschen das Heil zu verkünden?“ (Ebd., 139) Beckett stimmt zu und findet noch weitere Zitate aus dem Alten Testament. Auf das Lob Darwins, er sei ein kluger Arzt, antwortet er: „Ach, wissen Sie, mich interessieren eigentlich nur die Hintergründe meiner Patienten. Ich mag es, ihre Krankheiten und Ängste zu verstehen. Das ist für mich wie Schach. Zug um Zug kommt man dem Kern der Sache näher.“ (Ebd., 140)
In diesem stocksteifen Dialogstil werden in Jergers Opus – wie in Fontanes Bourgeoisie-Romanen aus der wilhelminischen Gründerzeit – die Gesprächskonstellationen abgewickelt, angereichert durch moderne Talk-Show-Floskeln, mit denen man auf Anmache oder Komplimente reagiert: Ach, wissen Sie, Frau Maischberger, mich interessieren eigentlich nur die Sachfragen… Dies findet gelegentlich, wenn es bedeutsam wird, eine Auflockerung dadurch, dass in der Ferne ein Hund bellt, der Mond aufgeht etc. Aber der Stil dieses dahindümpelnden Endspiels – die zwischen Marx und Darwin vermittelnde Hauptfigur heißt, wie gesagt, Beckett – steht hier nicht zur Diskussion, sondern der ideelle Ertrag. Und der ist eindeutig. Erstens ist Marx der Stifter einer Ersatzreligion, der neue Heiland. Zweitens: Vom Judentum kommt man nicht los und wer es versucht, scheitert. Sicherheitshalber wird das Ganze dann noch einmal zum Ende des Kapitels wiederholt, damit der ideelle Tiefgang nicht am Leser vorbeigeht, also das Fazit gezogen, „dass Marx im neuen Gewand die Geschichte des Alten Testaments erzählt“ (ebd., 143). Hier wird zudem ein dritter wesentlicher Punkt, der zum Ertrag der meisten Marx-Rückblicke gehört, nachgetragen, nämlich die Gewaltdimension. Beckett klärt Darwin auf: „Sogar das Fegefeuer findet seine Entsprechung in der Diktatur des Proletariats. Dieses gewalttätige Zwischenstadium ist der Übergang zum kommunistischen friedlichen Endzustand. Da geht es hitzig zu. Diejenigen, die noch nicht verstanden haben, wohin die Reise geht, müssen schmoren.“ (Ebd.) Darwin repliziert: „Oder werden einen Kopf kürzer gemacht.“ (Ebd.) Beckett resümiert: „So ist es. Außerdem glaube ich nicht an Zufall, wenn einer, der zunächst aus dem Judentum und dann aus seiner Heimat entwurzelt wurde, der als Staatenloser auf der Flucht war und nun im Exil lebt, immerzu vom entfremdeten Menschen spricht.“ (Ebd.) So ist dann, viertens, alles beisammen: Sich der Heimat zu entfremden, geht natürlich gar nicht. Oder: wenn man es trotzdem macht, wird man krank (die Krankenakten der beiden alten Männer Marx und Darwin werden in Jergers Roman ja ausführlich ausgebreitet und stellen dessen eigentliches Handlungsgerüst dar). Hier hätte der Trierer AfD-Mann übrigens noch etwas lernen können: Marx hatte nicht nur ein Problem mit dem Judentum, sondern auch mit der deutschen Heimat!
Eine hochproblematische Natur war also Marx. Er lieferte eine Theorie, die keiner verstand und die er selber nicht auf die Reihe bekam. Die Triebkraft dahinter war eine Utopie, die die Conditio Humana verleugnete bzw. entstellte. Tja, so naiv war dieser kluge Kopf, imaginierte sich eine bessere Welt, träumte allen Ernstes, there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion, too, imagine all the people living for today. Ja man stelle sich vor, all die Menschen leben nur für das Heute und singen mit Harry Heine, einem anderen gottlosen Juden: Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Wo bleibt da der Sinn? Das Gefühl dafür, dass man Teil eines größeren Ganzen ist? Wo bleibt die Verwurzelung in den religiösen und ethnischen Traditionen, der Respekt vor dem Gott der Väter und die Verbundenheit mit der angestammten Heimat? Von wegen, you may say I‘m a dreamer. Wenn das ein Jude macht, der auch noch seinen eigenen Kindern die roots verschweigt, dann kann es sich nur um arschnackten Antisemitismus handeln.
Literatur
- Micha Brumlik, Karl Marx: Judenfeind der Gesinnung, nicht der Tat – War Marx Antisemit? In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 7, 2014, S. 113-120. (Eine Variante des Beitrags steht online: http://michabrumlik.de/micha-brumlik-karl-marx-ein-judenfeind-der-gesinnung-nicht-der-tat-2/.)
- Ilona Jerger, Und Marx stand still in Darwins Garten. Roman. Berlin 2017.
- Hans Jürgen Krysmanski, Die letzte Reise des Karl Marx. Frankfurt/M. 2014.
- Karl Marx/Friedrich Engels, Über Kunst und Literatur. Band 1. Berlin 1967.
- Eva Pfister, „Tussy Marx“ (Buchvorstellung und Gespräch mit Eva Weissweiler). Deutschlandfunk, 3.2.2003, online: http://www.deutschlandfunk.de/tussy-marx-das-drama-der-vatertochter-eine-biographie.700.de.html?dram:article_id=80767.
- Werner Plumpe, „Dies ewig unfertige Ding“ – „Das Kapital“ und seine Entstehungsgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 10-16. Online beim Herausgeber, der Bundeszentrale für politische Bildung, greifbar: http://www.bpb.de/.
- Johannes Schillo, Und Marx sprach zu Darwin… Schöne Künste und Marx-Jubiläum. In: Auswege-Magazin, 10. 9. 2017, online: http://www.magazin-auswege.de/2017/09/und-marx-sprach-zu-darwin/.
- Eva Weissweiler, Tussy Marx – Das Drama der Vatertochter. Eine Biographie. Köln 2002.
Letztes zur Wahl
In gut zwei Wochen ist es so weit: Am Sonntag, dem 24. September, wird in Deutschland mal wieder der Höhepunkt des demokratischen Lebens erreicht. An Informationen mangelt es in der „Informationsgesellschaft“ nicht. Doch helfen sie weiter – und wenn ja, wozu? Dazu einige Hinweise der IVA-Redaktion.
„Ich habe die freie Wahl“, verkündet im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) der polnischstämmige Musiker Mateo Jasik: „Ich nutze mein Recht und gebe meine Stimme ab. Wenn ich es nicht tue, kann ich mich über das Ergebnis auch nicht beschweren!“ (bpb 2017b) Mit diesem bemerkenswerten, schon sehr auf eine allgemeine Bürgerpflicht zielenden Statement wird ein bpb-Online-Auftritt samt Printmaterialien eröffnet, der sich auch in Arabisch, Türkisch etc. an die lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen wendet und sie zum Wahlgang motivieren will. Das fremdsprachige Publikum hat zwar zu großen Teilen bei der diesjährigen Bundestagswahl – dem Highlight des demokratischen Gemeinwesens schlechthin – nichts zu melden. Aber was haben eigentlich diejenigen, die zur Wahl gehen (sollen), davon, dass sie ihre Stimme abgeben? Dazu gibt es, gerade auch für die pädagogische Arbeit, zahlreiche Angebote. Hierzu einige Anmerkungen.
Der Volkssouverän tritt auf…
Ein Klassiker, der alles erschöpfend behandelt, ist das Heft „Demokratie“ der Informationen zur politischen Bildung, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb 2017a). Verfasst hat es Politik-Professor Hans Vorländer, der aus der (FDP-nahen) Friedrich-Naumann-Stiftung kommt. Er behandelt alles – von den Grundzügen der athenischen Demokratie in der antiken Sklavenhaltergesellschaft bis zu den aktuellen Ideen einer global governance und den jüngsten Bedenken in Sachen „Postdemokratie“ (so der Sozialwissenschaftler Colin Crouch) oder den Ansagen einer „illiberalen Demokratie“ (so der ungarische Regierungschef Orbán). Das Heft endet mit einem Plädoyer „für gesunden Realismus“, dem zu Folge man die Erwartungen an die Demokratie nicht zu hoch schrauben, vielmehr realistisch bleiben soll, damit man sich mit dem hierzulande praktizierten Modell als der besten Herrschaftsform zufrieden geben kann. Das Ideal, dass es allein der Wille der Bürger ist, der, in Wahlen und Abstimmungen artikuliert, die Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen begründet und legitimiert, soll in Kraft bleiben. Nur dürfe man von daher die Defizite, die bei realistischer Betrachtung in den Blick geraten, nicht als Versagen des Systems oder als Fingerzeig auf ganz andere Zwecke nehmen, sondern als die Realität, die in – noch – unvollkommener Weise den hohen normativen Anforderungen gerecht zu werden versucht. So betrachtet gilt dann „nach wie vor“ der Ausspruch Churchills aus der Zeit des Kalten Kriegs: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von allen anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ (Ebd., 80) Das Fazit, d.h. derselbe Spruch in den Worten des Politologen wiederholt, lautet: „Die Demokratie mag als das kleinere Übel angesehen werden, vereint aber andererseits so viele Vorteile auf sich, dass sie weiterhin als die beste bekannte Herrschaftsform bezeichnet werden kann.“
Ergänzt wird das Heft der Bundeszentrale durch die Einlage Info aktuell Bundestagswahl 2017 von Politik-Professor Frank Decker (der u.a. für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung tätig ist). Das Info will neben Rückblick und Ausblick Antworten auf die „wichtigsten Fragen zum Ablauf“ und das nötige Grundwissen bieten, so dass die „Grundprinzipien“, also die „Grund-Grundsätze“ des hochkomplexen Vorgangs, bei dem man zwei Kreuze auf einem Wahlzettel anbringen muss, für jedermann verständlich werden. Bei Decker und seinem Rundgang durchs hiesige Parteiensystem wird als erste Antwort auf die Frage „Warum wählen gehen?“ übrigens folgender Grund aufgeführt: „Wählen tut gut. Dieser Moment, nachdem die Wahlzettel in der Urne verschwinden, ist immer wieder ein Genuss. Für viele ist das ja ohnehin einer der seltenen Momente im Leben, in denen sie aktiv die ganz große Politik mitbestimmen können. Wer darauf verzichtet, der verpasst etwas!“ (Info aktuell, 23, in: bpb 2017a) Wer nicht wählen geht, verpasst das Wählen – ein starkes Argument! Speziell Anno Domini 2017, wo viele Menschen schon den Wahlkampf verpassen.
Wer nicht weiß, wohin er die Kreuze malen soll, erhält auch Hilfe. Dazu gibt es seit Jahren den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale (Adresse siehe unten), der den Uninformierten oder Unentschiedenen sagt, welcher Partei sie nahestehen. Man muss sich durch 38 Fragen klicken – von Bundeswehreinsatz im Innern über die Freigabe von Cannabis bis zur stärkeren Zusammenarbeit in der EU –, dann noch bei Bedarf eine Gewichtung der Themen vornehmen und erhält, wenn man bis zu acht Parteien zum Vergleich herangezogen hat, eine eindeutige Wahlempfehlung. Überraschungen für Stamm- oder Protestwähler sind dabei nicht ausgeschlossen! Eine elaborierte Fassung des Spektrums an Themen, bei denen sich die Parteien unterscheiden bzw. unterscheiden wollen, gibt es natürlich auch. Die Bundeszentrale hat ihre Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte mit einer einschlägigen Auswahl online gestellt. Steuerpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Integrationspolitik, Familienpolitik und Innere Sicherheit hat sie als Themen parteipolitischer Auseinandersetzung und Positionierung im Bundestagswahlkampf 2017 identifiziert: „So können sie als kompakter Einblick in die Wahlprogramme gelesen werden, als Informationsgrundlage für die eigene Meinungsbildung oder als Rückblick auf den (Vor-)Wahlkampf. Die fünf Themenbereiche wurden bereits Anfang des Jahres von der APuZ-Redaktion ausgewählt – aufgrund unserer Einschätzung, dass sie den bevorstehenden Bundestagswahlkampf dominieren würden, aber auch in dem Bewusstsein, dass möglicherweise nicht jedes davon tatsächlich virulent werden würde.“ (APuZ 2017)
Irgendwie hat die Liste der APuZ-Reihe hingehauen, auch wenn in ihr das Thema Soziale Gerechtigkeit nicht so breit vorkommt, wie es die SPD eigentlich herausstellen wollte. Aber das ist ja das Charakteristikum des gegenwärtigen Wahlkampfs, dass in ihm die großen staatstragenden Parteien so gut wie alle Themen besetzen und es als besonders raffiniert gilt, dem Kontrahenten ein Thema wegzunehmen. Bei diesem generellen Konsens tun sich dann immer wieder überraschende Möglichkeiten auf, Differenzen deutlich zu machen – sei es im Blick auf die maßvolle, aber notwendige Aufrüstung der Bundeswehr, sei es hinsichtlich der dringend notwendigen, aber maßvoll zu handhabenden Auflagen für Autoabgase etc. Der entscheidende Punkt bei all den Anstrengungen, die potenzielle Wählerschaft zu erreichen, wird dabei leicht übersehen: Der Souverän dieser – trotz allem – besten Herrschaftsform zeigt sich bei seinem zentralen öffentlichen Auftritt, den er alle paar Jahre zu bestreiten hat, ziemlich unsouverän. Er meldet sich nicht zur Wahl, verschläft sie möglicher Weise, ja muss mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln zu diesem Akt herausgelockt werden. Und die Methoden der Volksbetörung, die dafür zum Einsatz kommen, werden in aller Öffentlichkeit diskutiert.
…und beherrscht sich selbst?
Es ist ja nicht so, dass Derartiges verschwiegen würde. Der Spiegel (Nr. 36/2017) hat in seiner letzten Titelstory „Aufwachen!“ einmal mehr den Wahlkampf als Unding bloßgestellt. Der Kommentar „Wir Eingelullten“ zielt dabei auf die neueste Manipulationstechnik der Machthabenden, d.h. speziell der Kanzlerin, das Wahlvolk mit dem Gefühl einzuschläfern, die Wahl sei bereits gelaufen. Der Kolumnist bekennt sich dazu, selbst „ein Opfer der Merkel-Müdigkeit“ geworden zu sein; es sei festzustellen, „dass die Kanzlerin das Land sediere“, sie werde zurecht „mit einer Narkoseärztin verglichen, die ganz Deutschland in ein Schlaflabor verwandele“ (ebd., 8). Die Titelstory will diesem Zustand auf den Grund gehen. Wesentlichen Anteil daran habe der nette Herr Schulz von der SPD, der zu wenig Machtwille entfalte bzw. rüberbringe. Zwar sei es ehrenwert, politische Themen zu suchen, die man den Wählern präsentieren kann. „Aber es geht immer auch darum, ob man ein Amt unbedingt will.“ (Ebd., 12) Und in puncto Machtgeilheit habe Schulz, nach anfänglich beeindruckenden Auftritten, wenig zu bieten. Die eine hat die Macht, der andere will sie – aus dieser Konstellation strickt der Spiegel seine Analyse, die die Wählerschaft als ein Publikum anspricht, das sich mehr oder weniger spannend unterhalten lassen will. Und da nimmt der Spiegel am Schluss den rechten Protest im Lande, der sich unübersehbar bei Merkels Auftritten bemerkbar macht, fast mit Erleichterung auf: Hier entsteht wenigstens der Eindruck, dass hart wahlgekämpft wird. So leisten die „Rechtspopulisten“ auch noch ihren Beitrag zur Demokratie. Der überhaupt ein Kreuz zu schenken, ist schon eine verdienstvolle politische Tat – da ist man sich von rechts (FAZ-Erstwählerkampagne: „80 % für Deutschland“) bis ganz links, wo z.B. die Antifa übers Thema „(Nicht-)Wählen in Zeiten des Rechtsrucks“ diskutiert, im Prinzipiellen einig.
Georg Schuster hat im Online-Magazin Auswege (Schuster 2017) den aktuellen Stand in Sachen Wahlwerbung 2017 resümiert. Er thematisiert den breiten Konsens der öffentlichen Meinung, dass man es in Deutschland im Sommer 2017 – wie so oft in Zeiten großer Koalitionen – mit einem „Zirkus“ ohne ernsthafte politische Alternativen zu tun habe, bei dem es nur um den „Stimmenfang“ der Politiker gehe. Schuster dokumentiert dafür zu großen Teilen das, was als Selbstverständnis der Macher und Strategen des Wahlkampfs explizit vermeldet wird. Die abgefeimten Methoden, das Volk als Stimmvieh zu behandeln und es gründlich einzuseifen, sprechen die Experten selber an. Hier besteht kein großer Bedarf zu entlarven, was mit dem Wahlvolk angestellt wird. Es besteht vielmehr Aufklärungsbedarf im Blick auf die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, also darauf, was „so garantiert nicht in den Sozialkundebüchern (steht)“ (ebd., 8). Denn der Politikunterricht hält (vor-)entschieden daran fest, dass die Wahlen Ausweis und Beglaubigung der Tatsache sind, dass das Volk das eigentliche Subjekt der Demokratie ist.
Schuster dagegen verweist auf die erste Schlussfolgerung, die aus den bekannten Befunden zu ziehen wäre: „Politik zu machen ist Sache der gewählten Regierung, daneben auch der mitgewählten Opposition, aber nichts für das Volk.“ (Ebd.) Dessen Aufgabe sei es, auf Kommando oder, wie dargelegt, als Folge beeindruckender Inszenierungen anzutreten, um die Personalalternativen bei der Herrschaftsbestellung zu entscheiden – einer Herrschaft, die im Anschluss daran bedingungslosen Gehorsam verlangt und die dafür in aller Freiheit definiert, worin der einsilbige, im Wahlzettel dokumentierte Wählerwille besteht, also welchen politischen Inhalt er eigentlich hat. In der Konsequenz heiße das, dass „in dieser demokratischen Form der Herrschaftsbestellung der Wahlbürger Untertan und Souverän zugleich (ist). Die erste Eigenschaft stellt freilich die maßgebliche Seite der Angelegenheit dar…“ (Ebd.)
Freerk Huisken hat in einer Fortsetzung seiner Gegenreden (siehe: http://www.magazin-auswege.de/tag/gegenrede/) zum Thema Wahl ebenfalls den Ansatzpunkt bei einer gängigen Idealisierung aus dem Sozialkundeunterricht gewählt. Genauer gesagt: bei einer Deutung des Höchstwerts Demokratie, die sich gerade als folgerichtiger Realismus ausgibt. Demokratie, so heißt es ja in den maßgeblichen politikdidaktischen Direktiven, ist Herrschaft durch und für das Volk, also im Grunde keine Herrschaft mehr. Man soll sich Herrschaftsfreiheit durchaus als Gehalt der Wahl vorstellen, indem man diese als eine große Beratschlagung versteht, die das Volk mit sich selber führt. Dann aber ist laut Sozialkunde Realismus angebracht: Das Ideal, dass alle an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen und diese solange offen zu lassen sind, bis eine einvernehmliche Lösung zustandekommt, wird nicht einfach zurückgewiesen, sondern auf den Boden der Tatsachen gestellt. Man muss dieses Anliegen, heißt es, notgedrungen in der Form parlamentarischer Repräsentation durchführen, da es sich in Industriegesellschaften und Flächenstaaten nun mal nicht anders machen lässt. Schon eine Vertagung wichtiger Fragen sei nicht möglich…
Huiskens Ausführungen bestehen darauf, das solche Argumente alles andere als stichhaltig sind. „Denn auch in Verhandlungen zwischen Parteien einer Regierungskoalition oder auch im Parlament wird gelegentlich sehr viel Zeit aufgewandt, um einen Beschluss unter Dach und Fach zu bringen, kommt es gelegentlich zu einstimmigen Beschlüssen und gehen Parteien mit unterschiedlichen Programmen aufeinander zu, um zu ‚tragfähigen‘ Entscheidungen beizutragen.“ (Huisken 2017, 1) Man könnte auch an die Bildung der letzten großen Koalition unter Merkel denken, die Monate in Anspruch nahm, ohne dass diese Zeitspanne irgendetwas durcheinander gebracht hätte. Oder man nehme gleich unsere Nachbarländer Belgien und Niederlande, wo es mitunter über ein Jahr braucht, bis eine Regierung steht. Die holländischen Parlamentarier z.B. haben dieses Jahr vier Monate nach der Wahl immer noch keine Regierung zustande gebracht und sich erst einmal in den Sommerurlaub verabschiedet.
Um die Machbarkeit des Ideals einer allgemeinen Volksberatschlagung sicherzustellen, kann es also nicht gehen, wenn eine Stimmabgabe zugunsten parlamentarischer Repräsentation installiert wird, die dann qua Mehrheitsprinzip herrscht. Dagegen würde ja auch schon der oben geschilderte Umstand sprechen, dass sich am Wahltag nicht ein Wille von unten zu Wort meldet, sondern mit den raffiniertesten, auf Äußerlichkeiten oder Geschmacksfragen zielenden, das Subliminale umfassenden Methoden zur Äußerung verlockt werden soll. Es verhält sich also keinesfalls so, lautet Huiskens erste Schlussfolgerung, dass in der Demokratie ein „eigentlich für vernünftig erkanntes Prinzip der Beschlussfassung wegen Durchführungsschwierigkeiten nicht zur Anwendung kommt. Es verhält sich anders. Eine Demokratie ist kein Verfahren, in dem es unter Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen zu Entscheidungen kommt. Wenigstens dies wäre dem Mehrheitsprinzip bereits zu entnehmen…“ (Ebd., 2) Dies wäre dann aber auch der Anfang einer Analyse, die sich nicht endlos damit beschäftigt, dass das hehre demokratische Prinzip in der Praxis nur schwer aufzufinden ist.
Literatur, Materialien, Internet
- APuZ 2017 – Aus Politik und Zeitgeschichte Bundestagswahl 2017, Beiträge zur Bundestagswahl. Hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, online: http://www.bpb.de/apuz/255137/beitraege-zur-bundestagswahl?pk_campaign=nl2017-09-06&pk_kwd=255137.
- bpb 2017a – Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Demokratie. Informationen zur politischen Bildung, Bonn 2017, Heft 332, mit Info aktuell Bundestagswahl 2017, online: http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/247723/demokratie.
- bpb 2017b – Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Du hast die Wahl – Infobroschüre zur Bundestagswahl 2017 (in Deutsch, Arabisch, Polnisch, Russisch und Türkisch erhältlich), Bonn 2017, online: https://www.duhastdiewahl.de/.
- Freerk Huisken, Was man Heranwachsenden zum Thema „Wahlen“ sagen müsste, was ihnen aber viel zu selten gesagt wird. September 2017, online: http://www.contradictio.de/blog/archives/7422.
- Georg Schuster, Wahlwerbung 2017: Zukunft ist für alle da. In: Auswege – Perspektiven für den Erziehungsalltag, 6. September 2017, online: http://www.magazin-auswege.de/2017/09/wahlwerbung-2017-zukunft-ist-fuer-alle-da/.
- Wahl-O-Mat 2017. Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ist ein Produkt der Bundeszentrale für politische Bildung und hat die Homepage: https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2017/. Thesen und Inhalte des Wahl-O-Mat wurden von einem Redaktionsteam aus 26 Jungwählern entwickelt. Die Homepage macht auch weitere Angebote für den Unterricht etc.
- Diverse Materialien zur Bundestagswahl (z.B. Programme der Parteien, Stellungnahmen der Gewerkschaften, Kommentare von Parteienforschern etc.) finden sich beim GEW-Magazin „Auswege – Perspektiven für den Erziehungsalltag“, online: http://www.magazin-auswege.de/tag/bundestagswahl-2017/.
August
Der Kampf gegen links
Seit den Protesten beim Hamburger G20-Gipfel ist der hiesigen Öffentlichkeit klar, dass man sich der „überfälligen Debatte über linksextreme Gewalt“ (Junge Freiheit) stellen und handfeste Maßnahmen ergreifen muss. Zu der – nicht erst seit dem Sommer 2017 – mit vereinten Kräften geführten Kampagne ein Kommentar der IVA-Redaktion.
Bundeskanzlerin Merkel besucht am 11. August, in der Startphase des diesjährigen Bundestagswahlkampfs, die Stasi-Gedenkstätte Höhenschönhausen. Und wenn sie, wie die Presse registriert, „diesen Ortstermin als allerersten Termin nach ihrem Urlaub auswählt, dann steckt viel Symbolik in diesem Besuch“ (General-Anzeiger, 12./13.8.2017). Die von ihrem Chef Hubertus Knabe schon einmal als „Dachau des Kommunismus“ (Junge Welt, 12./13.8.2017) bezeichnete Gedenkstätte eignet sich natürlich immer als „Wahlkampfarena“ (Junge Welt), um die Güte von „Merkels Land“ herauszustellen. In dem werden, versteht sich, keine Antikommunisten oder einheimischen Fluchtkandidaten eingesperrt. Es werden bloß türkische Kommunisten eingesperrt, die Erdoğans Geheimdienst bei den deutschen Behörden denunziert hat, oder Flüchtlinge in Abschiebeknästen drangsaliert, weil sie aus den falschen Elendsgebieten stammen.
Die unseligen Zeiten der deutschen Spaltung, als Ulbricht sich – noch lange vor Netanjahu oder Trump – als kompetenter Mauerbauer hervortat, sind aber nur die eine Seite des Besuchs, gewissermaßen die Pflichtübung, mit der die „Verbrechen von Kommunisten und Sozialisten“ (General-Anzeiger) in Erinnerung gehalten werden sollen. Merkel knüpft nämlich laut Pressebericht „nach den Krawallnächten am Rande des Hamburger G20-Gipfels eine weitere, aktuelle Verbindung, indem sie die Gedenkstätte als Teil der Bekämpfung des Linksradikalismus sieht. Diese Gefahr könne nicht negiert werden, darum müsse sich die Politik kümmern, unterstreicht sie. Zuvor hatte bereits Gedenkstätten-Chef Knabe diesen Zusammenhang aufgegriffen: Wenn die Menschenwürde im Namen einer Ideologie nichts mehr zähle und das Werfen eines Brandsatzes ins Gesicht eines Polizisten als etwas Gutes im Namen einer guten Idee angesehen werde.“
Knabes Phillippika bricht der Zeitungsbericht nach dem Konditionalsatz ab. Was danach kommen müsste, kann man sich aber denken. Nicht denken darf man in diesem Zusammenhang an die heldenhaften Demonstranten vom Euro-Maidan in Kiew, die bei ihrer Militanz unsere volle Sympathie hatten und die mit ihren selbst gebastelten Waffen in der Bildzeitung gefeiert wurden. Oder an die Streetfighter aus der venezolanischen Opposition, wo es eine ansehnliche Fitnesstrainerin sogar bis zur Ikone des Straßenkampfes geschafft hat: Das Bild der vermummten, steinewerfenden Dame ging um die Welt – zumindest so weit die „freie Presse“ reicht – und zeigte eindrücklich, wie weit es das sozialistische Regime bei der Erregung des Volkswiderstands gebracht hat. Seltsam auch, dass Knabe als Betreiber einer Gedenkstätte, die an die geheimpolizeiliche Unterdrückung des Volkes erinnert, Widersetzlichkeiten gegen polizeiliche Zugriffe – und Übergriffe, die es, wie man mittlerweile vom Mainstream-Journalismus erfährt, in Hamburg auch gegeben haben soll – aufs Entschiedenste brandmarkt.
Auf der anderen Seite ist es gar nichts seltsam. Es zeugt von der unbedingten Parteilichkeit, die für die hiesige Staatsverfassung gefordert wird und die nicht mit einer Gefahrendiagnose zu verwechseln ist. Die Hamburger Proteste kamen eher wie bestellt, um das Problembewusstsein der Republik, die schon immer den Extremismus jeder Couleur bekämpft hat, noch einmal zu schärfen (vgl. „Politik und Pädagogik gegen links“, IVA, Texte 2017). Von rechts außen bis in die Sozialdemokratie hinein wird die angeblich so lange „unterschätzte Gefahr“ nun konsequent ins Visier genommen.
Die unterschätzte Gefahr
„Der Aufwand, der in Sachen Antimarxismus als Teil einer generellen Bekämpfung des Linksextremismus betrieben wird, hat etwas Irreales“, hieß es bereits 2015 in einer Analyse zum „Antimarxismus heute“ (Schillo 2015, 122). Mit dem Start der schwarzgelben Koalition 2009 wurde der vorher noch angesagte „Kampf gegen rechts“ – eine Fortsetzung von Schröders „Aufstand der Anständigen“ – offiziell beendet und in ein Extremismusbekämpfungsprogramm transformiert, das übrigens bis heute, auch unter der aktuellen großen Koalition, die offizielle Leitlinie abgibt. Es wurden damals eigens Programme gegen den Linksextremismus aufgelegt (vgl. Roßbach 2011). Es gab eine Verstärkung entsprechender Maßnahmen im Rahmen des Staatsschutzes, Aussteiger-Telefone, Erarbeitung eigener Materialien wie der „Andi-Comics“ (vgl. Arbeitskreis Extremismusbegriff 2012) oder das Vordringen des Verfassungsschutzes in den Bildungsbereich (vgl. Mohr/Rübner 2010, Schillo 2012). Die Publikationspolitik der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) oder der – von der bpb maßgeblich unterstützten – Extremismusforschung langte hier auch kräftig zu. So wurde der absurde Eindruck erweckt, „in der Republik hätten sich Politik und Öffentlichkeit in den letzten Jahren gegenüber linksradikaler Kritik nachsichtig gezeigt und man müsste sich jetzt dem drohenden Ansturm einer mit Marx- und Engels-Zungen auftretenden Bewegung entgegenstemmen“ (Schillo 2015, 122).
Uwe Roßbach, in Thüringen Geschäftsführer der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, die sich explizit gegen eine Beteiligung an solchen Programmen wandte, führte deren Installierung auf ein innerparteiliches Problem der Konservativen zurück: „Nicht ohne Grund sorgen sich politische Formationen wie die beiden C-Volksparteien um ihr Wählerpotenzial, seitdem mit Angela Merkel der Weg in die politische Mitte nicht nur wahlarithmetisch und rhetorisch angetreten wurde“ (Roßbach 2011, 51). Um den rechten Rand zufriedenzustellen, würden dann entsprechende Kampfansagen gegen links in die Welt gesetzt – ein parteitaktisches Kalkül, das man wohl nicht bestreiten kann und das zur Aufbauschung der linksextremistischen Gefahr wesentlich beiträgt. Interessant ist auch, dass selbst Einrichtungen der politischen Bildung, die sich seinerzeit an den Programmen gegen linken Extremismus beteiligten, der Skepsis von Roßbach zustimmten und in ihre Arbeit „die zahlreich vorgetragenen inhaltlichen Gegenargumente gegen das Vorhaben des BMFSFJ“ (Ballhausen 2011, 61) einbauen wollten.
Der Extremismusforscher Harald Bergsdorf und Rudolf van Hüllen, der lange Jahre im Bundesamt für Verfassungsschutz für die Bobachtung des Linksextremismus zuständig war, veröffentlichten im Herbst 2011 ihre Studie „Linksextrem – Deutschlands unterschätzte Gefahr? Zwischen Brandanschlag und Bundestagsmandat“, die „in erster Linie für die politische Bildung konzipiert“ war (Bergsdorf/van Hüllen 2011, 7). Unglücklicher Weise erschien die alarmierende Studie parallel zur Aufdeckung des NSU-Skandals, der den Verfassungsschutz etwas in Bedrängnis und dessen Mitarbeiter teilweise vor Untersuchungsausschüsse brachte. Denn bei diesem Skandal lag – um das Mindeste zu sagen – die „Unterschätzung“ einer ganz anderen extremen Gefahr auf der Hand, was eine neue Klarstellung verlangte, die strikte Trennung von rechtsradikalem Heimatschutz und amtlichem Verfassungsschutz betreffend. Bei Bergsdorf/van Hüllen spielten übrigens, wie der Titel bereits signalisierte, Brandanschläge auf Autos in Berlin eine entscheidende Rolle. Diese wurden zwar nachträglich größtenteils einem unpolitischen Einzeltäter zugeordnet. Doch mit der Logik des Verdachts lässt sich hier trotzdem immer operieren, und nach Hamburg hat man ja endgültig den Beleg, dass das Auto-Abfackeln ein Schwerpunkt linksextremer Subversion ist.
So gibt es nun mit Hamburg einen neuen Schwung für die Programme gegen links. Diese dümpelten – im außerschulischen Bereich mangels größerer Nachfrage – vor sich hin, und auch die pflichtgemäß veranstalteten Evaluationen konnten keine besonderen Erfolge vermelden. Wie zu hören war, fanden die Angebote vor allem Akzeptanz im christdemokratischen und -sozialen Lager, wo z.B. Gruppen aus der Jungen Union eine Berlin-Reise finanziert wurde, damit sich die Teilnehmer mit ihrem MdB treffen und einen Spaziergang durch die Kreuzberger Kneipenszene absolvieren konnten. Oder die Programme verpufften. Wie die Junge Welt (12./13.8.2017) meldet, hat das vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingerichtete „Aussteigerprogramm Linksextremismus“ (AP LEX) ein „erbärmliches Ergebnis für die Behörden“ erbracht. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von Abgeordneten aus der Linkspartei hervor (vgl. Drucksache 18/13268 vom 7.8.2017): „Im Jahr 2014 gab es demnach sieben ‚Kontaktaufnahmen‘ (d.h. Anrufe auf der ‚Hotline‘ oder E-Mails) beim Aussteigerprogramm. Im Jahr 2015 waren es vier, 2016 wieder sieben Kontaktaufnahmen. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 gab es laut Auskunft der Regierung zehn Kontaktaufnahmen. Bei drei Kontaktaufnahmen handelte es sich um Scherzanrufe. Fünf Anrufe kamen von Journalisten, Schülern und/oder Forschern.“
Die neue Wachsamkeit
Die Inanspruchnahme solcher Programme ist aber nicht entscheidend, als propagandistische Aufrüstung und als amtliche Klarstellung erfüllen sie ihre Rolle ohnehin – gerade auch für die pädagogische Arbeit, die sich natürlich immer um Ausgewogenheit oder (im Sinne des „Beutelsbacher Konsenses“) um Kontroversität zu bemühen hat. Die Rechten mischen bei der erneuerten Kampfansage eifrig mit. So hat ihre Wochenzeitung Junge Freiheit „nach Hamburg“ ein Sieben-Punkte-Programm formuliert, mit dem der linksextremen Gefahr begegnet werden soll. Darin heißt es unter Nr. 2 („Staatsfinanzierung unterbinden“): „Über hundert Millionen Euro jährlich verteilt der Bund für den ‚Kampf gegen Rechts‘, von den vielfältigen Subventionen auf Länderebene und über andere Kanäle nicht zu reden. Kontrollen, die sicherstellen könnten, daß Linksextremisten nicht als Straßenkampftruppe gegen mißliebige Oppositionelle mit Steuergeld gepäppelt werden, finden faktisch nicht statt, seit die damalige zuständige Ministerin Manuela Schwesig die Extremismus-Klausel gestrichen hat. Ihre Wiedereinführung auf allen Ebenen ist die Mindestforderung. Noch besser wäre es, auf ‚zivilgesellschaftliche‘ Programme ganz zu verzichten. Null Toleranz gegen politisch motivierte Straftäter ohne Unterschied der Gesinnung zu zeigen ist Sache von Polizei und Justiz.“ (Paulwitz 2017)
Das ist übrigens die einzige Stelle in dem Programm, die etwas aus dem Rahmen fällt und einen oppositionellen Touch aufweist. Ansonsten sind alle von rechts aufgeführten Punkte im Konsens der staatstragenden Parteien aufgehoben. Und auch die Wiedereinführung der Extremismusklausel ist im Gespräch. Dazu ist im Übrigen Folgendes anzumerken: Erstens hat die jahrelang praktizierte Extremismusklausel (die die Kooperation mit bestimmten Experten oder Initiativen im Rahmen geförderter Maßnahmen unterbinden sollte) genau die Funktion gehabt, den Kampf gegen rechts direkt mit der Aufgabenstellung zu verbinden, gegen links – d.h. gegen die dort je nach aktueller Verfassungsschutzeinschätzung beheimatete extreme Variante – Position zu beziehen. Von Unterschätzung oder Duldung kann also keine Rede sein. Zweitens hat die Familienministerin in Abstimmung mit Innenminister de Maizière 2013 diese Klausel nicht deshalb abgeschafft, weil man die genannte Zielsetzung aufgegeben hätte, sondern wegen der Unhandlichkeit und im Grunde auch der Überflüssigkeit des speziellen Verfahrens. Die Abgrenzung vom Linksextremismus sei nämlich schon durch entsprechende Anerkennungsprozeduren sichergestellt bzw. müsste auf andere Weise effektiver geregelt werden. Möglicher Weise kommt dazu ja demnächst ein neues Demokratieförderungsgesetz, das den „zivilgesellschaftlichen“ Wildwuchs überhaupt beseitigt. (Zum gegenwärtigen Stand auf Bundesebene siehe: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/07/praeventionsstrategie-gegen-extremismus-mit-bmfsfj.html.)
Die neue Wachsamkeit dokumentiert auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Gerade mal einen Monat nach den Hamburger Protesten legt sie das Schwerpunktheft „Innere Sicherheit“ ihrer Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) vor, in dem der Extremismusforscher Armin Pfahl-Traughber, ehemals im Bundesamt, jetzt an der Akademie des Verfassungsschutzes tätig, das „Gefahrenpotenzial im Linksextremismus“ bilanziert. Es ist natürlich groß – nach den G20-Protesten zog sich „eine Spur der Verwüstung durch einige Straßen der Hansestadt, die Bilder davon gingen um die Welt“ (Pfahl-Traughber 2017, 28) – und hat mit seiner Aktivierung in Hamburg noch einmal eindeutig belegt, dass hier eine „unterschätzte Gefahr für die innere Sicherheit“ besteht (ebd.). Man könne zwar nicht direkt von einer „Zäsur in der Geschichte der Autonomen“ (ebd., 33) sprechen, denn Militanz gehöre, wie der Autor an den Memoiren eines Alt-Autonomen nachweist, seit den 1980er Jahren zum Selbstverständnis dieser Subkultur. Aber eine Besonderheit scheint es schon zu geben, dass nämlich „die Gewalt so viele Trittbrettfahrer mitreißen konnte“ (ebd.).
Das Bedrohungsszenario, das Pfahl-Traughber aus den Verfassungsschutzberichten abschreibt – aktuell soll das Gefahrenpotenzial bei amtlich nachgezählten 6.800 Personen liegen –, besteht einerseits aus einem Feindbild, in dem aller politischer Inhalt getilgt ist. In der Szene „herrscht“ dem Experten zu Folge „eine Begeisterung für Gewalt an sich“ (ebd., 31). Es gebe eine „instrumentelle Einstellung der Autonomen gegenüber angeblich oder tatsächlich bestehenden Problemen“ (ebd.). Soll heißen, sie benützen gesellschaftliche Missstände, um ihr Gewaltbedürfnis auszuleben, bedienen sich ihrer also als Vorwand. An einer Lösung von Problemen, so wie sie der demokratische Verfassungsstaat vorgibt und einem Interessenausgleich zuführt, seien sie nicht interessiert. Vielmehr würden sie eigene Interessen anmelden, die aber wieder „primär Ausdruck der erwähnten Grundauffassung der ‚Militanz‘ sein“ sollen (ebd.), also nur dazu dienen, den „Kampf als inneres Erlebnis“ zu inszenieren (diese Parallele zum rechtsradikalen Dichter Ernst Jünger hatte vorher schon der Spiegel gezogen, vgl. Latsch 2017).
Andererseits aber bleibt es gerade nicht bei diesem Befund, dass man es also wie bei Fußball-Hooligans und sonstigen Vandalen mit einem „Handlungsstil“ zu tun hat, der der Polizei, der Feuerwehr und dem Straßenverkehr ein paar untergeordnete Ordnungsprobleme bereitet und damit in gewisser Weise als „normal“ abzuhaken ist (Pfahl-Traughber 2017, 32). Die Autonomen sind für den Autor die Speerspitze des Linksextremismus, sie sind das Symbol für die Gefährdung, die „das linke Lager“ (ebd., 29) für die Demokratie bereithält. Sie sind entschieden präventiv zu bekämpfen, was an erster Stelle heißt, dass der Staatsschutz aufzurüsten ist, damit z.B. im Vorfeld politischer Großereignisse, gerade auch durch europaweite Kontrollen, jedwedes Auftreten dieser Protestszene verhindert wird. An zweiter Stelle kommt dann die politische, auch pädagogische Extremismusbekämpfung zum Zuge: Es muss eine neue Wachsamkeit nach links installiert und „eine klare Distanzierung von der Szene seitens bestimmter politischer Akteure“ verlangt werden (ebd., 33). Das heißt, die autonome Widersetzlichkeit soll eine Art Lackmustest für das gesamte linke Lager sein, das sich zu den staatlichen Vorgaben der Problemdefinition und -lösung bekennen und allem anderen eine Absage erteilen muss, um Teil des anerkannten politischen Pluralismus zu sein. Erbringt es die Distanzierung nicht, hat es sich selber ins Aus manövriert.
Der Extremismusforscher zeigt sich dabei, wenn es um die Vereinnahmung des politischen Extremismus etwa am rechten Rand geht, durchaus tolerant. Wie er in einer aktuellen Bestandsaufnahme zur Gefährdung durch extremistische Parteien in Europa schreibt, müsse man konstatieren, „dass einige extremistische Parteien einen Demokratisierungsprozess vollzogen“ haben und dies Schule machen könnte (Pfahl-Traughber 2015, 152). Der allgemeine, nationalistische Stimmungswandel in Europa und der dazugehörige Vormarsch rechtspopulistischer oder -radikaler Positionen in Europa erscheinen so in einem relativ harmlosen Licht. Sofern sich nationalistische bis neofaschistische Formationen wie der französische Front National, die österreichische FPÖ oder die italienische Alleanza Nationale ordentlich zur Wahl stellen, Koalitionsbereitschaft zeigen oder Koalitionsangebote annehmen, wertet sie der Extremismus-Experte eher als gemäßigt. Sie brauchen ihre politischen Programmpunkte dafür nicht groß zu ändern. Es reicht, wenn sie nach den Regeln des demokratischen Verfassungsstaates politikfähig werden.
So großzügig ist Pfahl-Traughber im Grunde aber auch, wenn er nach links blickt. Exemplarisch hat er das in seiner jüngsten Auseinandersetzung mit dem Marxismus dargelegt (Pfahl-Traughber 2014, 29-41). Der Marxismus – im Unterschied zum Leninismus etc. – ist demnach nicht per se extremistisch und muss nicht von vornherein aus dem politischen Diskurs ausgegrenzt werden. Das Studium und die Vermittlung der Marxschen Theorie sind legitim, solange und sofern sich die Rezeption – so die Quintessenz der umständlichen methodologischen Vorschriften, die sich aus Extremismus- und Totalitarismustheorie ergeben (vgl. Schillo 2015, 100) – davon distanziert, dass sie die Theorie ernst nimmt. Wenn man die Kritik der politischen Ökonomie als einen möglichen Denkansatz relativiert, neben dem auch viele andere ihren Platz haben, darf man sich getrost damit beschäftigen. So großzügig ist der demokratische Verfassungsstaat – zur Zeit jedenfalls, nach der quasi-amtlichen Auslegung eines Geheimdienst-Professors und soweit linker Protest nicht unangenehm auffällt!
Literatur
- Arbeitskreis Extremismusbegriff, Schulverweis für Andi! Warum der Verfassungsschutz mit seiner Bildungsarbeit gegen „Extremismus“ scheitert. Münster 2012.
- Ulrich Ballhausen, Soll sich politische Bildung am neuen Linksextremismusprogramm beteiligen? Anmerkungen zur aktuellen Debatte. In: Journal für politische Bildung, Nr. 1, 2011, S. 56-61.
- Harald Bergsdorf/Rudolf van Hüllen, Linksextrem – Deutschlands unterschätzte Gefahr? Zwischen Brandanschlag und Bundestagsmandat. Paderborn u.a. 2011.
- Gunther Latsch, Im Rausch der Gewalt – Warum linke Autonome und ein rechter Dichter Brüder im Geiste sind. In: Der Spiegel, Nr. 29, 2017.
- Markus Mohr/Hartmut Rübner, Gegnerbestimmung – Sozialwissenschaft im Dienst der „inneren Sicherheit“. Münster 2010
- Michael Paulwitz, Man muß nur wollen. In: Junge Freiheit, 22.7.2017.
- Armin Pfahl-Traughber, Linksextremismus in Deutschland – Eine kritische Bestandsaufnahme. Wiesbaden 2014.
- Armin Pfahl-Traughber, Die Gefahr des Extremismus durch links- und rechtsextremistische Parteien – Darstellungen und Einschätzungen zur Entwicklung in Europa. In: Eckhard Jesse (Hg.), Wie gefährlich ist Extremismus? Gefahren durch Extremismus, Gefahren im Umgang mit Extremismus, Baden-Baden 2015, S. 137-160.
- Armin Pfahl-Traughber, Autonome und Gewalt – Das Gefahrenpotenzial im Linksextremismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 32-33, 2017, S. 28-33.
- Uwe Roßbach, Erfolge kopieren? Die Auseinandersetzung mit dem Linksextremismus. In: Journal für politische Bildung, Nr. 1, 2011, S. 50-55.
- Johannes Schillo, Zur staatlichen Formierung politischer Bildung. In: Klaus Ahlheim/J.S. (Hg.): Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, Hannover 2012, S. 126-143.
- Johannes Schillo, Antimarxismus heute. In: J.S. (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Hamburg 2015, S. 87-129.
Juli
Politik und Pädagogik gegen links
„Nach Hamburg“ wird das Problembewusstsein der Republik, die schon immer den Extremismus jeder Couleur bekämpft hat, wieder einmal geschärft. Der Linksextremismus, die lange „unterschätzte Gefahr“, soll nun konsequent ins Visier genommen werden. Dazu ein Kommentar der IVA-Redaktion.
Im Sommer erschien die aktualisierten Neuausgabe „Gegen Rechts argumentieren lernen“ von Rolf Gloël und Co. im VSA-Verlag (siehe IVA, Texte2017, Juni). Zur vorausgegangenen zweiten Auflage dieses Argumentationsleitfadens hatte es bei Amazon zwei positive Rezensionen gegeben (https://www.amazon.de/Gegen-Rechts-argumentieren-lernen-Gloel/dp/3899651464/ref=cm_rdp_product_img), worauf sich ein heftiger Internet-typischer Schlagabtausch entwickelte, ausgelöst durch die Frage eines Kommentators „Wann erscheint denn ‚Gegen Links argumentieren lernen‘?“ und bis in die jüngste Zeit mit zahlreichen Statements fortgeführt.
Dem Fragesteller muss man leider bescheinigen, dass er keine Ahnung hat. Seit Jahrzehnten ediert und verbreitet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) dicke Bände zur Extremismusbekämpfung, in denen der Linksextremismus seine gehörige Rolle als Gefährdung des demokratischen Verfassungsstaates spielt (vgl. Schillo 2015), jetzt auch mit einer aktuellen Fachtagung vom Juni 2017 (siehe: http://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/251709/fachtagung-linksextremismus-und-linke-militanz). Mitarbeiter des Verfassungsschutzes wie Armin Pfahl-Traughber oder Rudolf van Hüllen – also in klandestinen Zusammenhängen tätige Strategen der Ausgrenzung politischer Positionen – gelten als seriöse Experten; Jahrbücher und Fachdienste kümmern sich regelmäßig um das Thema; eine Flut von Warnungen vor der „unterschätzten Gefahr“ ist seit einem Jahrzehnt erschienen (vgl. Roick 2006, Dovermann 2011, Stiftung Zeitbild 2011, Koenen 2011, Hirscher/Jesse 2013, Pfahl-Traughber 2014, Sarrazin 2014, Schroeder/Deutz-Schroeder 2015 und 2016, nicht zu vergessen die einschlägigen Publikationen aus der Konrad-Adenauer- oder Hanns-Seidel-Stiftung etc.). Rudolf van Hüllen, bis 2006 Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, der kürzlich mit dem Kollegen Grumke eine institutionenkundlich orientierte Verteidigung der Behörde – vor allem gegen Vorwürfe in Sachen NSU-Skandal – vorgelegt hat (Grumke/van Hüllen 2016), hatte schon vor Jahren die Schwerpunktsetzung beim Linksextremismus bekräftigt und dazu auch Enthüllungen über die „Argumentations- und Agitationstechniken von Linksextremisten“ sowie ein Training gegen linksextreme „Stammtischparolen“ geliefert (Bergsdorf/van Hüllen 2011, 160ff).
Das hat jetzt „nach Hamburg“ wieder seine Zuspitzung erfahren. Was man in Deutschland aktuell nach den Ansagen des Innen- bzw. Justizminister erlebt, kann man, wie die Junge Welt (12.7.2017) schrieb, als eine „Querfront aus CDU, CSU, SPD, AfD, FDP und NPD“ bezeichnen: Kritik am Kapitalismus, wenn sie nicht mit konstruktiven Vorschlägen für den nationalen Standort und dessen Führungskompetenz aufwartet, gehört definitiv nicht zum „besten Deutschland, das es je gab“ (Gauck), sondern ist Zersetzung der Volksgemeinschaft. Die Artikulation solcher Kritik muss möglichst weit im Vorfeld und – wie der neue Verfassungsschutzbericht zeigt – im Grunde schon bei der Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften bekämpft werden.
Eine Querfront gegen links?
Dass die Proteste gegen den G20-Gipfel „nun für eine breitangelegte Kampagne gegen die gesamte Linke instrumentalisiert werden“, dass die politische Öffentlichkeit einen „Generalangriff“, ein „Sperrfeuer von Medien und SPD/CDU/AfD“, gestartet hat, ist in der Tat zu konstatieren (Florian Wilde von der Linkspartei in: Junge Welt, 21.7.2017). Dass es nötig sei, dem eine „linke Gegenerzählung“, „eine Erzählung der Erfolge“, „eine Erzählung vom Scheitern der Gegenseite“ (ebd.), entgegenzusetzen, ist allerdings fraglich. Man sollte sich zunächst einmal Rechenschaft davon ablegen, womit man es hier zu tun hat – in der Politik, aber auch bei den Maßnahmen im schulischen oder außerschulischen Bereich, wo ja aktuell die Wiedereinführung der „Extremismusklausel“ im Gespräch ist. Freerk Huisken hat schon vor Jahren die Frage gestellt, ob nicht die pädagogische Mobilisierung gegen den Linksextremismus, wie sie mit diversen Programmen und Anleitungen forciert wird, „eigentlich überflüssig“ sei (Huisken 2012). Seine Antwort könnte man, um ein Bonmot abzuwandeln, so zusammenfassen: Die Auflage der speziellen Programme soll davon ablenken, dass der Rest der Bildungsbemühungen sowieso aus einer Immunisierung der Adressaten gegen linke Kritik am demokratischen Kapitalismus besteht (vgl. Schillo 2015, 122ff).
Speziell was die Aussage von der „Querfront“ betrifft, muss man genauer hinschauen. Wenn damit gemeint ist, dass hier eine rechtsradikale Position eine Neuorientierung im Bündnis mit der gesellschaftlichen Mitte, mit konservativen und liberalen Kreisen bis hin zur Sozialdemokratie zustande gebracht habe, unterliegt man einer Täuschung. AfD und Co. betreiben einen „Kulturkampf von rechts“, heißt es z.B. immer wieder in linken Publikationen (vgl. Kastrup/Kellershohn 2016). Die AfD versuche nach dem Vorbild der französischen Neuen Rechten die „kulturelle Hegemonie“ zu erlangen und habe dafür vom rechten Rand aus eine Adaption der Theorie Antonio Gramscis vorgenommen: „Das Denken möglichst vieler Menschen, ihre Lebensweise und Weltanschauung zu prägen, wird als Voraussetzung betrachtet, die politische Macht zu erringen: entweder auf den Wegen, die die bestehende Verfassungsordnung bereit stellt, oder, unter Umständen, wenn die staatliche Ordnung sich auflöst oder zerbricht, in einem realen Bürgerkrieg als ultima ratio“ (ebd., 6).
Dabei vertritt die AfD aber, wenn man einmal ihre bildungspolitischen Stellungnahmen und Aktivitäten näher betrachtet, keine Positionen, die groß aus dem Rahmen fallen. Sie sammelt im Grunde nur das ein, was sich in den letzten Jahrzehnten vom christlich-sozialen Konservatismus bis weit in die SPD und die Grünen hinein an Rechtstrend herausgebildet hat und was als Gesinnung in der legendären Mitte der Gesellschaft sowieso zuhause ist – und bringt das mit einer fundamentaloppositionellen Tonlage gegen die herrschende Politik in Stellung. Das ist jedenfalls das Fazit einer Untersuchung, die Anfang 2017 die bundespolitischen Ansagen und die landespolitischen Aktivitäten der AfD unter die Lupe genommen hat (vgl. Schillo 2017a, Schillo 2017b). Kurz und zugespitzt gesagt: Entscheidend ist der Politikstil, nicht ein abweichender Inhalt.
Bei den traditionellen Family Values – die als unbestrittenes pädagogisches Leitbild wieder verankert werden sollen – nimmt die AfD eine gewisse Außenseiterposition ein. Doch diese findet sich auch bei der CSU, beim „freiheitlich-konservativen Aufbruch“ der CDU, in evangelikalen Kreisen oder in der Deutschen Bischofskonferenz. Streng genommen ist es also keine Randpositionen, sondern ein in der Republik geachtetes Bedenken. Alles andere, was die rechte Partei vertritt, so die Forderung nach einem Schlussstrich unter den ewigen „Kult mit der Schuld“, also nach Beendigung der „einseitigen“ NS-Vergangenheitsbewältigung, oder die Betonung nationalen Selbstbewusstseins, die Vergewisserung des großartigen kulturellen Erbes und die Identifikation mit der wechselvollen Geschichte, ist der politisch-pädagogischen Debatte hierzulande nicht fremd. Die besonders inkriminierten Äußerungen etwa eines Höcke zur ‚Moralkeule Auschwitz‘ sind von Leuten wie Strauß oder Augstein abgeschrieben. Und die nationale Stoßrichtung deckt sich im Grunde mit Merkels Anliegen, Deutschland als eine der Welt zugewandte und damit zur Weltführung prädestinierte Nation zu präsentieren, die sich wegen ihres prinzipiellen Verantwortungsbewusstseins und ihrer tief greifenden Läuterung von keinem mehr etwas nachsagen lassen muss; die im Gegenteil alles Recht der Welt hat, moralisch aufzutrumpfen und auf dem Globus nach dem Rechten zu sehen.
Am Grad der Offenheit für fremde nationale Belange, am konkreten Umgang mit befreundeten oder angefeindeten Nationen, an der Zuständigkeitserklärung Deutschlands für internationale Ordnungsaufgaben wie Flucht und Migration entzündet sich dann der Streit zwischen der etablierten politischen Klasse und den aufstrebenden Kräften vom rechten Rand, die das Prinzip „Germany first“ gegen eine machtvergessene Führung auffahren wollen und dabei in einen fundamentalistischen Ton verfallen. Dabei scheint ihnen, wenn man den Einschätzungen der professionellen Politikbeobachter Glauben schenken darf, nach dem Euro nun auch das heiße Thema der deutschen Flüchtlingspolitik abhanden gekommen zu sein – so dass sie sich auf die Suche nach einem neuen Wahlkampfschlager begeben müssen. Möglicher Weise sind hier der Kampf gegen die „Ehe für alle“ oder jetzt gegen die linke Gefahr Ersatzthemen. Diese stammen aber, wie gesagt, nicht aus dem Gegenentwurf eines Programms, das nach kultureller Hegemonie strebt. Gerade bei der Hetze gegen linksextreme Chaoten und Krawallmacher, die den Frieden des Gemeinwesens bedrohen und die den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft erforderlich machen, sind die entscheidenden Positionen schon von der offiziellen Politik besetzt.
Die Spezialität der AfD besteht darin, das Meinungskartell der „Altparteien“ bloßzustellen: Das Stattfinden von politischer Bildung, die staatlich gefördert wird, gilt ihr per se als Beweis, dass eine Manipulation des Publikums erfolgt. Dabei ist es natürlich nicht zu bestreiten, dass ein staatliches Interesse an Steuerung der pädagogischer Arbeit besteht, nämlich an einer Immunisierung gegen Systemkritik. Gegen die hat die AfD nichts, ihr geht es um die Bebilderung des Topos vom „politischen Kartell“. Von dem erhält sie dann postwendend den Vorwurf der Manipulation und Indoktrination zurück und wird ins undemokratische Abseits gestellt. Selbstverständlich teilt die AfD Ausschluss- oder Ausgrenzungsstrategien sofort, wenn sie „gegen links“ gehen – was immer das Etikett konkret heißen mag. Streichung von Zuschüssen oder ihre Umwidmung für Projekte, die der nationalen Sache dienen, sind dann probate Mittel, wie ihre zahlreichen landespolitischen Aktivitäten (gegen Gedenkstätten, antirassistische Programme, Begegnungsmaßnahmen, Flüchtlingshilfe, Förderung von Initiativen, Einrichtungen politischer Jugend- oder Erwachsenenbildung etc.) dokumentieren. Wenn also die angekündigten und diskutierten Maßnahmen einer Extremismusbekämpfung, die nicht mehr „einäugig“ nur auf die rechte Gefahr blickt, in die Tat umgesetzt werden, wird das kein Werk einer Querfront sein, sondern Ausdruck des herrschenden Geistes der Republik.
Literatur
- Harald Bergsdorf/Rudolf van Hüllen, Linksextrem – Deutschlands unterschätzte Gefahr? Zwischen Brandanschlag und Bundestagsmandat. Paderborn u.a. 2011.
- Ulrich Dovermann (Hg.), Linksextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1135. Bonn 2011.
- Thomas Grumke/Rudolf van Hüllen, Der Verfassungsschutz – Grundlagen. Gegenwart. Perspektiven? Opladen u.a. 2016.
- Gerhard Hirscher/Eckhard Jesse (Hg.), Extremismus in Deutschland – Schwerpunkte, Vergleiche, Perspektiven. Extremismus und Demokratie, Band 26. Baden-Baden 2013.
- Freerk Huisken, Mobilisierung in deutschen Schulen gegen Linksextremismus: Eigentlich überflüssig? In: Susanne Feustel u.a. (Hg.), Verfassungsfeinde – Wie die Hüter von Denk- und Gewaltmonopolen mit dem „Linksextremismus“ umgehen. Hamburg 2012, S. 57-70.
- Wolfgang Kastrup/Helmut Kellershohn, Kulturkampf von rechts – AfD, Pegida und die Neue Rechte. Münster 2016.
- Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt – Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977. 5. Aufl. Frankfurt/M. 2011.
- Armin Pfahl-Traughber, Linksextremismus in Deutschland – Eine kritische Bestandsaufnahme. Wiesbaden 2014. Auch als Band 1569 in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen.
- Michael Roick, Die DKP und die demokratischen Parteien 1968-1984. Paderborn u.a. 2006.
- Thilo Sarrazin, Der neue Tugendterror – Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. München 2014.
- Johannes Schillo, Antimarxismus heute. In: J.S. (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Hamburg 2015, S. 87-129.
- Johannes Schillo, Für einen schwarzrotgoldenen Schlussstrich – AfD und politische Bildung. In: Außerschulische Bildung, Nr. 2, 2017a, S. 51-57, online: http://www.adbildungsstaetten.de/content/zeitschrift-ausserschulische-bildung-ausgabe-2-2017.
- Johannes Schillo, Alternative politische Bildung für Deutschland. Auswege-Magazin, 16. Juni 2017b, online: http://www.magazin-auswege.de/tag/schillo/.
- Klaus Schroeder/Monika Deutz-Schroeder, Gegen Staat und Kapital – für die Revolution! Linksextremismus in Deutschland – eine empirische Studie. Frankfurt/M. u.a. 2015.
- Klaus Schroeder/Monika Deutz-Schroeder, Linksextreme Einstellungen und Feindbilder – Befragungen, Statistiken und Analysen. Frankfurt/M. u.a. 2016.
- Stiftung Zeitbild (Hg.), Demokratie stärken – Linksextremismus verhindern. Zeitbild Wissen, 53. Jg., München 2011.
„Marx is back“, Vol. 4
Die Marx-Renaissance, die gegenwärtig vor allem das Feuilleton beschäftigt, ist natürlich, wie sich das für den modernen Meinungsbetrieb gehört, plural gestaltet. Es gibt viele Zugänge, Aspekte, Blickwinkel, mit denen man sich dem Klassiker nähern kann und soll. Das Ergebnis ist allerdings recht einsinnig. Dazu ein weitere Folge der IVA-Redaktion.
Selbstverständlich reihen sich nicht alle Statements und Veröffentlichungen in den Mainstream ein, der in den ersten Folgen der IVA-Reihe „Marx is back“ (Vol. 1-3) Thema war. Es gibt aus der linken Szene hierzulande und anderswo sowie von Seiten kritischer Wissenschaft und Bildung Beiträge, die sich bemühen, die Kritik der politischen Ökonomie wiederaufleben zu lassen und in Verbindung mit verschiedenen Projekten oder Programmen zu bringen (siehe z.B. Müller 2015, Schillo 2015, Krätke 2017, Bischoff u.a. 2017) – doch das wäre ein eigenes Kapitel. Die Haupttendenz des Jubiläums hat damit nichts zu tun, lässt sich davon auch nicht beirren, veranstaltet vielmehr einen sehr speziellen Personenkult samt allerlei feuilletonistischer und sonstiger Eskapaden, kommerzielle Interessen inbegriffen.
Das „Marx-Business“
Kurioser Weise ist gerade die FAZ, das Organ des Marktfundamentalismus, darauf verfallen, bei dem gegenwärtig anlaufenden Jubiläumstrubel ein „Marx-Business“ zu entlarven. Hinter den Aktivitäten stünde ein „millionenschweres Geschäft“ vom Trierer Stadtmarketing über Londoner Fremdenführer bis zur VR China, wo die Feiern Staats- und Parteisache sind – nicht zu vergessen die europäische Filmförderung mit ihrem Bio-Pic „Der junge Marx“ oder das Amsterdamer Marx-Archiv, denen öffentliche Mittel zufließen (Pennekamp u.a. 2017). Nachdem der FAZ-Leser erfahren hat, wie viele Millionen Bund, Land und Stadt in die „Große Landesausstellung“ 2018 in Trier stecken, heißt dann das überraschende Fazit: „In China läuft das Marx-Business staatlich gelenkt. In Deutschland funktioniert es kurz vor dem großen runden Geburtstag ganz von selbst.“ Dabei wird speziell am Fall China aufgedeckt – „Ein Etikettenschwindel, von dem jeder weiß“ (ebd.) –, dass es der chinesischen KP gar nicht um Kapitalismuskritik geht, sondern um die Feier des eigenen Ladens. Unerhört!
Die FAZ kümmert sich zugleich darum, dass das Marx-Jubiläum nicht falsch verstanden wird, dass also kein Zuspruch zu den theoretischen Leistungen des Mannes aufkommt, der den Kapitalismus in Grund und Boden kritisiert hat. Wenn an dem alten Rheinländer etwas festzuhalten sei, dann sollen es seine humanistischen Aufwallungen sein oder seine Rolle in der europäischen Geistes- und Sozialgeschichte, seine Anregungen für spätere Erklärer des komplexen marktwirtschaftlichen Geschehens, auch gewisse hellsichtige Prognosen zur Globalisierung, die deutsche Wirtschaftsjournalisten bereits zum 150. Jubiläum des „Kommunistischen Manifests“ entdeckt haben wollten (vgl. Held 1998). In der Kategorie der Gescheiterten war Marx demnach ein ganz Großer – und der Glanz dieser berühmten, wenn auch dubiosen Persönlichkeit strahlt natürlich auf das Land und die Stadt ab, die ihn hervorgebracht haben, ergänzt um ein paar europäische Metropolen, in denen er sich umständehalber aufhalten musste und die deshalb mitfeiern dürfen.
Damit diese Feier dem heutigen, weltoffenen Deutschland mit seiner unvergleichlichen sozialen Marktwirtschaft zugutekommt und nicht einer verqueren Theorie, müssen einige Klarstellungen erfolgen. Dazu heißt es einleitend im FAZ-Artikel übers „Marx-Business“: „Während Marx als finale Wendung einen Siegeszug des Proletariats prophezeite, hat die Weltgeschichte einen ganz anderen Plan verfolgt und dem Kapitalismus den ultimativen Sieg beschert.“ (Pennekamp u.a. 2017) Dies ist auch der Tenor anderer Beiträge, die die FAZ zum Sommer 2017 veröffentlichte: „Der falsche Prophet“ von Philip Plickert und „Kathedrale des Kapitals“ von Stephan Finsterbusch, Co-Autor des „Business“-Artikels. Die Autoren stellen triumphierend und im Stil eines Dementis fest, dass Marx mit seinen Prophezeiungen völlig daneben gelegen habe. Der Versuch, mit seinem wissenschaftlichen Hauptwerk „wortgewaltig zu belegen, warum der Kapitalismus zwangsläufig gegen die Wand fahren werde“ (Plickert 2017), sei kläglich gescheitert. Der Kollege aus dem Wirtschaftsteil weiß auch warum: Das Buch steckt voller Fehler, und als „es vor 150 Jahren erschien, hat es kaum jemand verstanden“ (Finsterbusch 2017).
Wie so oft, ist auch hier das Dementi verräterisch. Die Verteidiger der Marktwirtschaft, die sich von deren ultimativem Sieg so überzeugt zeigen, haben im Grunde sehr gut verstanden, worauf das Buch hinausläuft, und sie wissen auch, dass das heute wie damals gar nicht so unverständlich ist. Es liefert nämlich – die Funktionsweise dieses Systems einmal näher betrachtet – massenhaft Gründe, die Dienstbarkeit der Menschheit für die Kapitalverwertung aufzukündigen. Zwar lassen sich überall Reformen anbringen – in den historischen Kapiteln über den Arbeitstag oder die Industrie geht das „Kapital“ ja ausführlich darauf ein –, aber das ändert nichts an der trostlosen Rolle, die die vom Lohn abhängigen Menschen darin spielen. Natürlich kann man festhalten, dass Marx das Buch in der Hoffnung geschrieben hat, diese Weise des Wirtschaftens werde ein Ende finden. Und er hat sich in der Internationale tatkräftig dafür eingesetzt, dass das bald geschieht.
Das Buch ist aber keine Untergangsprognose. Ganz im Gegenteil, es zeigt, minutiös und in systematischer Abfolge, wie der Kapitalismus funktioniert. Das ist sein Inhalt und nicht die Vision einer besseren Welt, mit der sich die utopischen Sozialisten seinerzeit beschäftigten und die moderne Weltverbesserungsideen („Eine andere Welt ist möglich“) beflügelt. Wegen seiner Konzentration auf die ökonomische Realität gibt es ja immer wieder, wie jetzt in der FAZ, den Vorwurf, Marx hätte sich auf die Analyse der Übel fixiert und so gut wie nichts darüber zu sagen gehabt, „wie Kommunismus praktisch funktionieren sollte“ (Plickert 2017). Als ob man in der FAZ auf eine praxisnahe Bauanleitung gewartet hätte, um sich in Sachen Kapitalismus pro oder contra zu positionieren!
Die „ungelösten Schwachstellen“
Bei solchen Debatten wird man natürlich immer wieder zurück auf die These von den „ungelösten Schwachstellen“ (Werner Plumpe) verwiesen, die sich im Marxschen Opus finden ließen und die es insgesamt als Erklärung der (heutigen) kapitalistischen Realität disqualifizierten (vgl. „Marx is back“, Vol. 3). Das bereits vorgestellte Heft der Bundeszentrale für politische Bildung (Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017) hat dieses Theorieversagen exemplarisch vorgeführt. Auch die FAZ bezieht sich in ihren Beiträgen maßgeblich auf die dort vorgetragene Kritik von Hans-Werner Sinn oder Ulrike Herrmann. Im Wesentlichen werden vier Argumente angeführt, die hier kurz benannt und dann überprüft werden sollen.
- Marx hat im „Kapital“ den Untergang des Kapitalismus vorausgesagt und sich damit grundsätzlich geirrt. Marx „setzt darauf, dass seine Theorie die immanenten Destabilisierungstendenzen des Kapitalismus richtig identifiziert hat. Vermutlich wollte er damit der Arbeiterbewegung eine Anleitung geben, um die Geburtswehen der neuen Gesellschaft abzukürzen… Der Kapitalismus hat sich bis heute als äußerst überlebensfähig erwiesen… Es ist an der Zeit, das Vertrauen auf einen geschichtsphilosophischen Automatismus aufzugeben.“ (Quante 2017, 9)
- Marx geht von der „Verelendung“ des Proletariats aus, die nicht eingetreten ist. Vielmehr hat eine allgemeine Wohlstandsmehrung stattgefunden, wobei die moderne „Konsumgesellschaft“ ihre eigenen, von Marx nicht vorausgesehenen Probleme aufweist. „Die Arbeiter sind nicht verelendet“. (Herrmann 2017, 19) „Für Kritiker ist es bis heute ein Spaß, dass Marx die totale Verarmung prognostizierte. So höhnte der Nobelpreisträger Paul Samuelson: ‚Man sehe sich die Arbeiter mit ihren Autos und Mikrowellenherden doch an – besonders verelendet sehen sie nicht aus…‘ Der Durchbruch zur modernen Wohlstandsgesellschaft begann erst kurz vor Marx’ Tod. Ab etwa 1880 stiegen die Reallöhne deutlich an, was vor allem den Gewerkschaften zu verdanken war. Es entwickelte sich eine neue Massenkaufkraft, die den Kapitalismus nochmals veränderte. Es entstand die Konsumgesellschaft… Marx konnte noch nicht wissen, dass sich eine breite Mittelschicht entwickeln würde.“ (Herrmann 2017, 19)
- Die Marxsche Erklärung der Ausbeutung ist nicht haltbar, da schon die Arbeitswerttheorie schwere Mängel enthält. „Zu Marx’ größten wissenschaftlichen Fehlleistungen gehört die Arbeitswerttheorie…, denn erstens sind die Löhne nur eine von vielen Kostenkomponenten einer Firma und zweitens sind Preise grundsätzlich Knappheitspreise, die ihren Wert auch von den Präferenzen und der gegenseitigen Konkurrenz der Nachfrager herleiten.“ (Sinn 2017, 24) „Marx wusste, dass seine Mehrwerttheorie eine zentrale Schwäche hatte – was vielleicht der Grund ist, warum er Band zwei und drei des ‚Kapitals‘ nie beendet hatte. Er kämpfte nämlich mit dem ‚Transformationsproblem‘, wie es heute heißt. Marx konnte nicht erklären, wie sich der Wert einer Ware in ihren Preis übersetzt. Zwischen der Tiefenstruktur der Werte und der Oberfläche der Preise schien es keine zwingende Verbindung zu geben. Dieses ‚Transformationsproblem‘ entstand, weil im modernen Kapitalismus nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Maschinen eingesetzt werden. Doch Marx’ Mehrwerttheorie ging davon aus, dass nur die menschliche Arbeit Werte schafft… Kapitalisten kalkulieren letztlich simpel, wie auch Marx feststellte: Sie berechnen ihre Produktionskosten – und schlagen einen Gewinn obendrauf. So ergibt sich dann der Preis, den sie auf dem Markt erzielen wollen. Aber wo bleibt da der Mehrwert? Darauf hatte Marx keine Antwort.“ (Herrmann 2017, 19/20)
- Die moderne Geldwirtschaft und die Akkumulation, wie sie sich mit Hilfe und im Bereich des Finanzkapitals vollzieht, kann Marx nicht erklären. Marx hat „letztlich nicht verstanden, wie Geld funktioniert. Er blieb in einem Sumpf von Widersprüchen stecken, weil er irrtümlich glaubte, dass auch das Geld eine Art Ware sei. Daraus folgte für ihn dann umstandslos, dass die Arbeitswertlehre auch für das Geld gelten müsse… Diese Idee konnte plausibel erscheinen, solange Geld vor allem aus Gold oder Silber bestand… Marx stand vor dem Rätsel, warum auch die Geldscheine wertvoll waren. Er erkannte nicht, dass Geld eine soziale Konvention ist… Da Marx jedoch glaubte, dass Geld gleich Gold sei, konnte er nie schlüssig erklären, wie die Kreditvergabe funktioniert.“ (Herrmann 2017, 21)
Ad 1: Es stimmt, „der Kapitalismus hat sich als deutlich langlebiger erwiesen, als Marx es je für möglich gehalten hätte“ (Herrmann 2017, 18f); Marx hat sich in bestimmten Erwartungen getäuscht. Nur unterschlägt dieses Besserwissen der Nachgeborenen zwei fundamentale Tatbestände und offenbart sich damit als ziemliche Dummheit: Erstens ist die Kritik der politischen Ökonomie keine Prognose (s.o.), sondern eine Analyse der Funktionsweise des Kapitalismus, und zwar in praktischer Absicht. Sie wollte der Arbeiterbewegung – so hat es Marx formuliert und so wurde es damals verstanden – auf wissenschaftlicher Basis die Gründe liefern, warum nur die Abschaffung dieser Wirtschaftsweise eine zufriedenstellende Antwort auf die „soziale Frage“ gibt. Und das Unternehmen wäre von vorneherein ein Widersinn gewesen, wenn Marx, wie unterstellt, an einen „Automatismus“ geglaubt hätte. Zweitens hat sich der Kapitalismus überhaupt nicht als „äußerst überlebensfähig“ erwiesen. Eine Generation nach dem Tod von Marx und Engels schafften ihn die Bolschewiki ab und praktizierten ein Dreivierteljahrhundert lang – für Jahrzehnte in der Hälfte des Globus – eine andere Art des Wirtschaftens, die die führende Partei dann selber zwecks weiterer Machtentfaltung ad acta legte. Man mag vom realen Sozialismus halten, was man will: Ein Zusammenbruch, wie er dem Weltkapitalismus 2007/08 bevorstand, als man laut offiziellen Ansagen in den Abgrund blickte, war dieses Ende nicht, sondern ein politischer Beschluss, der auch anders hätte ausfallen können. Die – vom westlichen Schuldenstand aus gesehen – lächerliche Staatsverschuldung im Osten war jedenfalls kein Sachzwang zum Systemabbruch.
Ad 2: Es ist erstaunlich, welche Ignoranz eine gestandene Wirtschaftsjournalistin wie Herrmann an den Tag legt – nicht nur im Blick auf Faktenlage und öffentlichen Diskussionsstand Anno Domini 2017, sondern auch hinsichtlich der Marxschen Theorie. Diese ging gerade nicht von einer beständigen Senkung der Arbeitslöhne oder einer analogen absoluten Armutstendenz aus. Michael Heinrich hat im Marx-Handbuch die einschlägige Theorie, das im 23. Kapitel des ersten Bandes entwickelte „Allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“, resümiert, die „keineswegs auf eine absolute Verelendung der Arbeiterklasse“ abstelle, „sondern auf eine Verschlechterung der Lage, die unabhängig von der ‚Zahlung‘ ist“ (Quante/Schweikard 2016, S. 343). Ein Treppenwitz ist auch, dass Herrmann gegenüber Marx, dem Mitbegründer der internationalen Gewerkschaftsbewegung, die Erkenntnis ins Feld führt, dass Gewerkschaften Lohnerhöhungen durchsetzen können. Hätte Herrmann das Buch von Thomas Piketty über das „Kapital im 21. Jahrhundert“ (2014), das sie beiläufig zitiert, wirklich studiert, wäre sie zudem mit dem Hohn von Samuelson auf die Marxschen Prognosen – die ja, siehe oben, überhaupt nicht den Gehalt der Analyse ausmachen – anders umgegangen. Piketty hat mit einer Überfülle an Details gezeigt, dass die Sonderkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg vom Mainstream der Wirtschaftswissenschaft systematisch zu einem Gemälde allgemeiner, gleichmäßiger Wohlstandsmehrung verfälscht wurde und dass demgegenüber die Marxsche Akkumulationstheorie empirisch im Recht ist. Der Beitrag über „Piketty und die neuere Armutsforschung“ im Sammelband von Johannes Schillo (2015, 191ff) hat das noch einmal minutiös aufgeschlüsselt, auch die marxistische Debatte über Verelendung rekapituliert und zugleich deren aktuelle öffentliche Thematisierung – von den Armutsberichten der Regierung bis zum fachlichen Diskurs in Erziehungs- oder Sozialwissenschaft – vorgestellt. Vom neuen US-Präsidenten bis zu französischen Soziologen hat ja seit dem Siegeszug der Globalisierung alle Welt das „Prekariat“ (also den von Marx so genannten „Pauperismus“), eine verarmte oder abgehängte Arbeiterklasse wiederentdeckt. Selbstverständlich „gehören zum deutschen Alltag“ heute, wie der Spiegel (19/2017) schreibt, „Arme, die Abfalleimer durchforsten, und Kinder, die ohne Frühstück zur Schule gehen“. Und wenn ein deutsches Fernsehteam aus dem amerikanischen Rust Belt berichtet, dann bekommt man arme „Arbeiter mit Autos und Mikrowellenherden“ als Sinnbild einer Verelendung gezeigt, die an die Dritte Welt erinnert und die dort für Milliarden Menschen sowieso als Selbstverständlichkeit gilt.
Ad 3: Auch bei der – traditionsreichen – Zurückweisung der Arbeitswerttheorie erstaunt zunächst die pure Ignoranz gegenüber den Marxschen Schriften. Was z.B. Herrmann als „Transformationsproblem“ einführt, ist Teil des Argumentationsgangs im „Kapital“. Marx will ja gerade vom Produktionsprozess im Allgemeinen, den er im ersten Band abhandelt, zum Gesamtprozess gelangen, wo dann die Erwirtschaftung des Profits erklärt wird, wie er sich in Unternehmergewinn, Zins und Grundrente aufspaltet. Dabei ist natürlich Thema, dass der Unternehmer kein Wertgesetz kennt und auch nicht zur Leitschnur seines Handelns macht. Für ihn wirft sein gesamtes Kapital den Profit ab. Wenn sein Standpunkt zur Sprache kommt – so schon im ersten Band bei der relativen Mehrwertproduktion –, spricht Marx daher vom „Extraprofit“, was Herrmann auf den Kopf stellt (Herrmann 2017, 18). Dass Marx „keine Antwort“ auf solche Fragen gehabt hätte, ist ein Zerrbild seiner Erklärung. Die Fehlermeldungen bedienen sich einfach einzelner – bewusst? – missverstandener Teile der Theorie, um sie gegeneinander auszuspielen und sich dann als Entdecker der eigentlichen Problemlage aufzuspielen. Eine einfache Übung ist es natürlich auch, die Marxschen Theorie dadurch abzuqualifizieren, dass man ihr kategorisch entgegenhält, sie stimme nicht – im Gegensatz zur subjektiven Werttheorie, die stimmt! Letztere gilt heutzutage eben etwas, die Marxsche nicht. Sinn liefert (anders als Kollege Plumpe) sogar zwei „Argumente“ nach, sie lauten: „Was hat beispielsweise der Preis eines Gemäldes von Rembrandt mit dem Lohn des Meisters zu tun? Was hat der Preis des Erdöls mit dem Lohn der Arbeiter am Bohrloch zu tun? Nichts, oder so gut wie nichts.“ (Sinn 2017, 18) Im ersten Fall soll eine Ausnahmesphäre, die mit der Normalität kapitalistischer Warenproduktion nichts zu tun hat, etwas über den Alltag des Warentauschs aussagen (selbst der Terminus „Lohn“ ist hier Fehl am Platz – und so viel weiß auch ein Gerhard Richter, der den Kunstmarkt selber nicht versteht, dass er keinen Lohn für seine Arbeit erhält). Im zweiten Fall soll Dasselbe eine andere Sondersphäre leisten, die auch kein Beispiel kapitalistischer Akkumulation ist, sondern sich aus der imperialistischen Benutzung und Alimentierung „unterentwickelter“ Regionen ergibt. Hier hängt die konkrete Preisbildung letztlich von staatlichen Eingriffen (Energiesteuer etc.) ab, die dort anfallen, wo der Rohstoff als Ware in die individuelle und produktive Konsumtion eingeht. Aus dem Normalfall der Vernutzung von Lohnarbeit, die als „variables Kapital“ (Marx) dem Produktionsprozess zugeführt wird, kennt dagegen jeder die Forderung der Unternehmer, dass die Lohnkosten niedrig genug sein müssen, damit überhaupt ein rentables Geschäft zustandekommt. Dieser Logik der Ausbeutung begegnet die moderne Wirtschaftswissenschaft damit, dass sie sie einfach übergeht. Wie Fritz Reheis konstatiert, kommt in der bis „heute herrschenden Wirtschaftstheorie das Wort ‚Ausbeutung‘ nicht vor“ (Reheis 2016, 37).
Ad 4: Das besprochene Muster zeigt sich auch beim Thema Finanzwesen: Als erstes werden die Marxschen Schriften entstellt, dann kann man ihre Mangelhaftigkeit beklagen. Marx hat natürlich nicht das Geld mit Gold gleichgesetzt, sondern auf die Differenz größten Wert gelegt. Und er stand nicht vor dem Rätsel, warum auch Geldscheine wertvoll sein können. Mit der letzten Formulierung gibt Herrmann sogar zu erkennen, dass Marx die Ersetzung der Geldmaterie (die aus Edelmetallen oder sonstigen Wertgegenständen bestehen mag) durch an sich wertlose Repräsentanten aus Papier kannte. Und sie war Marx nicht nur bekannt, er hat sie zum Gegenstand seiner theoretischen Erörterungen gemacht, wie man im „Kapital“ von den Einleitungskapiteln des ersten Bandes bis zu den Abschnitten übers Geldkapital (in MEW 25) nachlesen kann. Dort, im dritten Band, findet man auch alles Grundlegende über die Kreditvergabe – so weit sie im 19. Jahrhundert fortgeschritten war. Die moderne Flutung der Märkte mit staatlichem Kreditgeld durch die EZB, die in Sinns Aufsatz (2017, 28) als Bruch mit dem (angeblich universell siegreichen) kapitalistischen System firmiert, konnte Marx natürlich nicht kennen. Aber gegen Herrmanns Diktum „Geld ist keine Ware“ (ebd., 20) hätte er schon im 19. Jahrhundert eingewandt, was auch wir als Zeitgenossen des 21. wissen: Jeder Devisen- oder Geldmarkt zeigt das Gegenteil.
So viel in der gebotenen Kürze. Man könnte die genannten Punkte der gängigen Marx-Widerlegung natürlich noch erweitern (etwa im Blick auf die methodischen, wissenschaftstheoretischen Einwände) oder durch die Liste der Verdienste ergänzen, die Marx zugute gehalten werden (vor allem: die Entdeckung der kapitalistischen Dynamik, der Wachstumsgesetze, des tendenziellen Falls der Profitrate, der Konzentrationsprozesse sowie der Determination des Bewusstseins durch das soziale Sein). Letztere gehen sachlich – ebenso wie die Vorwürfe – an Gehalt und Zielrichtung der Marxschen Kritik vorbei, nehmen diese für ganz andere Überlegungen in Anspruch und würdigen ihn bloß formell als einen „der innovativsten Theoretiker aller Zeiten“ (Herrmann 2017, 21).
Literatur
- Joachim Bischoff u.a., Vom Kapital lernen – Die Aktualität von Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie. Hamburg 2017.
- Stephan Finsterbusch, Kathedrale des Kapitals. In: FAZ, 5.7.2017.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Das kommunistische Manifest: Ein mangelhaftes Pamphlet – aber immer noch besser als sein moderner guter Ruf. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 1998, S. 159-190. Online: https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/kommunistische-manifest.
- Ulrike Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung – Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir heute von Smith, Marx und Keynes lernen können. Frankfurt/M. 2016.
- Ulrike Herrmann, „Das Kapital“ und seine Bedeutung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 17-22.
- Michael R. Krätke, Kritik der politischen Ökonomie heute – Zeitgenosse Marx. Hamburg 2017.
- Klaus Müller, Geld – von den Anfängen bis heute. Freiburg 2015.
- Johannes Pennekamp u.a., Das Marx-Business. In: Frankfurter Allgemeine Woche, Nr. 18, 2017.
- Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert. München 2014.
- Philip Plickert, Der falsche Prophet. In: FAZ, 30.6.2017.
- Werner Plumpe, „Dies ewig unfertige Ding“ – „Das Kapital“ und seine Entstehungsgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 10-16.
- Michael Quante, A Traveller’s Guide – Karl Marx’ Programm einer Kritik der politischen Ökonomie. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 4-9.
- Michael Quante/David P. Schweikard (Hg.), Marx-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2016.
- Fritz Reheis, Wo Marx Recht hat. (2011) 3. Aufl., Darmstadt 2016.
- Johannes Schillo (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie. Hamburg 2015.
- Hans-Werner Sinn, Was uns Marx heute noch zu sagen hat. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 23-28.
„Marx is back“, Vol. 3
Marx wird wieder für interessant befunden, weil er vieles kommen sah und man aus der heutigen Distanz – jubiläumshalber – ganz abgeklärt darauf zurückblicken kann. Unter Texte2017 gab es dazu bereits im April und Mai Informationen. Hier eine Fortsetzung der IVA-Redaktion.
Marx ist wieder in. Das Feuilleton interessiert sich brennend für die Kapitalismuskritik von Anno Dunnemals, die uns Nachgeborenen Verschiedenes zu denken geben soll. Da konnte auch die Suhrkamp-Kultur nicht abseits stehen und hat jetzt etwas Hochkulturelles zum Thema beigesteuert, nämlich einen Sammelband mit Blick auf die „internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit“. So lautet der Untertitel des von Heinrich Geiselberger herausgegebenen Buchs, das aktuelle ökonomische Fehlentwicklungen geißelt. In ihm kommen vor allem Autoren zu Wort, die sich auch beim Marx-Jubiläum zu Wort gemeldet haben. Aus offizieller Warte gilt solche Bedenklichkeit in Sachen Kapitalismus mittlerweile als vertretbar, aber auch als eine Haltung, die auf dem Sprung zum Dogmatismus steht. So konstatierte bzw. monierte die vom Deutschen Bundestag herausgegebene Wochenzeitung Das Parlament (Nr. 21-22, 2017), dass in Geiselbergers Publikation im Grunde „alle Mitwirkenden um einen Glaubenssatz herum(schreiben): Der Kapitalismus – in Form des ‚Neoliberalismus‘ – war, ist und bleibt die Geißel der Menschheit.“
Mit dem Stichwort „Neoliberalismus“ ist allerdings schon der Hinweis gegeben, dass hier nicht an die Kritik der politischen Ökonomie angeknüpft wird, wie sie Marx im „Kapital“ entwickelt hat. Es geht vielmehr um eine bedenkliche Tendenz, die sich in der Wirtschaftspolitik breit gemacht haben soll. „Dieses Buch will an die Globalisierungsdiskussion der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts anknüpfen und sie fortführen“, schreibt der Herausgeber im Vorwort (Geiselberger 2017, 13). Die Kritiker aus NGOs oder Wissenschaft hätten recht damit gehabt, dass „es sich um eine marktradikale Form der Globalisierung handelt“ (ebd., 12). Obwohl sie schon Ende des 20. Jahrhunderts vor den Folgen einer neoliberalen Globalisierung warnten, sei „eine Wiedereinbettung der entfesselten Ökonomie auf globaler Ebene“ (ebd., 11) nicht zustande gekommen. Fazit: Wir werden „Zeugen eines Zurückfallens hinter ein für unhintergehbar erachtetes Niveau der ‚Zivilisiertheit‘.“ (Ebd., 9) Heute soll also die gute alte Zeit vorbei sein, als die kapitalistische Akkumulationsmaschine noch rund lief, die Ausbeutung ins gesellschaftliche Leben eingebettet war (statt umgekehrt) und sich der Gegensatz von Kapital und Arbeit von seiner zivilisierten Seite zeigte.
Ein „neues“ Marx-Bild
Vor 50 Jahren, in eben dieser guten alten Zeit des rheinischen Kapitalismus, erschien der Jubiläumsband zum Hundertsten der Erstausgabe des „Kapital“ – „Folgen einer Theorie“ mit Beiträgen von Henri Lefèbvre, Ernest Mandel oder Alfred Schmidt – in der Edition Suhrkamp (Mohl 1967), worauf dann ebenda allerlei marxistische und marxologische Veröffentlichungen folgten. Die Aufnahme in die linke Literatur- und vornehmlich Wissenschaftsreihe schaffte sogar eine Publikation, die aus der legendären Marxistischen Gruppe (MG) stammte: Als Band 1149 erschien dort 1983 von Karl Held und Theo Ebel „Krieg und Frieden – Politische Ökonomie des Weltfriedens“. Danach war bei Suhrkamp allerdings Schluss mit solcher Verlebendigung der Marxschen Theorie. Wie die MG damals mitteilte (im Netz dokumentiert unter: http://dearchiv.de/php/dok.php?archiv=amg&brett=CHR228&fn=HABERMAS.C86&menu=wissen), machte Jürgen Habermas himself seinen Einfluss bei Suhrkamp geltend und unterband die bereits mit dem Verlag vereinbarte Veröffentlichung eines weiteren Buchs der beiden Autoren Held und Ebel über die Demokratie. So ging damals der ebenfalls legendäre „herrschaftsfreie Diskurs“!
Zum 150. Jubiläum des „Kapital“ ist jetzt nicht Suhrkamp tätig geworden, sondern die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Sie hat eine Ausgabe ihrer Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ, Nr. 19-20, 2017) der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie gewidmet (vgl. „Marx is back“, Vol. 2, IVA, Texte2017, bpb im Netz: http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/247643/das-kapital) und sich damit nahtlos in die gegenwärtige Marx-Renaissance eingereiht. Diese setzt ja nicht von vornherein auf Abwehr und Ausgrenzung, sondern votiert – im Unterschied zu früheren Zeiten – für ein bedingtes Geltenlassen der Marxschen Erkenntnisse und will dem verdrängten Klassiker eine gewisse Anerkennung, ja Rehabilitierung widerfahren lassen. In der Konsequenz läuft das tolerante Vorgehen jedoch auf eine Entschärfung der Kritik und eine Eskamotierung des Kritikcharakters der Marxschen Analyse überhaupt hinaus. Somit ist die neueste Renaissance – was den Ertrag betrifft – letztlich nicht von den früheren Absagen und Widerlegungen unterschieden. Neu ist der Weg, der zu dem Resultat führt: Marx wird vereinnahmt statt verdrängt.
Dass man Marx als einen zeitbedingten Diagnostiker sehen soll, der dem heutigen Problematisieren der globalisierten Marktwirtschaft gewisse Impulse zu geben vermag, ist das Zugeständnis, das gemacht wird, um den wieder ausgegrabenen Klassiker dann endgültig ad acta zu legen, d.h. ins Pantheon der großen Deutschen einzuordnen. Exemplarisch wird das im genannten APuZ-Heft deutlich, mit dem die Bundeszentrale zwar keine definitiven Lernziele für den Schulunterricht oder sonstige Bildungsbemühungen festlegt, aber schon eindeutige Vorgaben für die pädagogische Arbeit machen will. Das Heft ist nämlich, alles in allem, eine klare Zurückweisung der Marxschen Theorie, die voller Irrtümer, Fehlprognosen, theoretischer wie praktischer Sackgassen stecken soll.
Aus dem Rahmen fällt hier eigentlich nur der Beitrag von Dietmar Dath, wobei im vorliegenden Fall das redaktionelle Arrangement der Zeitschrift, die sonst den wissenschaftlichen Pluralismus gewissermaßen paradigmatisch vorexerziert, schon bemerkenswert ist. Normaler Weise lässt die bpb in ihren APuZ-Heften zum jeweiligen Thema Pro- und Contra-Standpunkte – damit meistens ein gewisses Spektrum von links bis rechts – zu Wort kommen, eventuell garniert mit mittleren oder exzentrischen Positionen. Das Pro vertritt im vorliegenden Heft streng genommen kein einziger Beitrag, der Text von Dath hat eine Lückenbüßerfunktion. Er ist nämlich nicht wirklich zur Sache geschrieben, sondern berichtet über persönliche Leseerfahrungen mit dem „Kapital“. Er geht bis auf die Schulzeit des Autors zurück, gleicht die eigene intellektuelle Lebensgeschichte mit anderen Biographien ab, speziell mit der von ehemaligen Kommunisten, die im Laufe der Zeit, hauptsächlich nach der Wende von 1989, umständehalber ihren Glauben an Marx verloren. So gehen Daths Schlussfolgerungen auch nicht auf die Ökonomiekritik ein, sondern plädieren für intellektuelle Redlichkeit: Statt sich Glaubensgewissheit zu verschaffen, sollte man sich darum bemühen, Erkenntnisse an der gesellschaftlichen Realität zu überprüfen…
Der Beitrag der Historikerin Beatrix Bouvier, von 2003 bis 2009 Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier, hat auch eine gewisse Sonderstellung in dem Heft. Er thematisiert nicht unmittelbar die Gültigkeit oder Obsoletheit der Marxschen Theorie, sondern wendet sich einem anderen Thema zu. Er stellt einen ästhetisch-medialen Aspekt in den Mittelpunkt, nämlich die überlieferte öffentlichkeitswirksame Konstruktion der „Marx-Ikone“ mit „Rauschebart“ und wildem Haarwuchs, die jeder kennt und wiedererkennt. Bouvier kann nachweisen, dass an der Bildgestaltung und Überlieferung – wer hätte das gedacht – Marx und Engels (sowie die Familie) beteiligt waren, da sie die Photographien in Auftrag bzw. an Freunde weiter gaben. Dabei muss natürlich auch der Personenkult im Ostblock mit kritischen Worten bedacht werden; der lokalpatriotische Kult des Karl-Marx-Hauses in Trier gilt dagegen als seriös.
Besonders ergiebig ist die Medienanalyse nicht. Sie steuert dann aber doch einen entscheidenden Punkt zum Thema Aktualität der Marxschen Theorie bei. Sie informiert nämlich darüber, was von der großen Landesausstellung, die für den 200. Geburtstag 2018 in Trier vorbereitet wird, zu erwarten ist. Diese bedient sich laut Bouvier, „in ihrer Werbung und bei allen Logos des Wiedererkennungseffektes des allgegenwärtigen Bildes, auch wenn sie vom Inhalt her ein anderes, ein ‚neues‘ Marx-Bild vermitteln will.“ (Bouvier 2017, 35) Die Friedrich-Ebert-Stiftung, für die Bouvier tätig war, wird mit der Ausstellung nämlich ein Bild vermitteln, das Marx „vornehmlich im 19. Jahrhundert verortet und verständlich machen will, ohne zu ignorieren, was im 20. Jahrhundert geschehen ist und wofür Zusammenhänge mit seinen Ideen hergestellt wurden.“ (Ebd.) Die Jubiläumsaktion ist also ebenso dem Ziel untergeordnet, Marx als einen historisch beschränkten Theoretiker vorzustellen.
Das Marxsche Theorieversagen
Michael Quante, Mitherausgeber des neuen Marx-Handbuchs (Quante/Schweikard 2016), hat zum APuZ-Heft den Eröffnungsbeitrag beigesteuert; seine Rephilosophierung der Kapitalismuskritik war bereits in „Marx is back“, Vol. 2, Thema. Laut Quante lassen die Marxschen Schriften die Beurteilung der kapitalistischen Weise des Wirtschaftens letztlich offen (vgl. Quante 2017, 9). Es müsse erst noch – eine Aufgabe für die heutige Wissenschaftlergemeinde! – ein fester philosophischer Grund geschaffen werden, den Marx leider nicht mitgeliefert, dessen Notwendigkeit er vielleicht übersehen habe, weil ihm sein eigenes theoretisches Programm nicht recht klar geworden sei. Was bei Quantes Rückblick impliziert ist, wird dann bei Werner Plumpe, Hans-Werner Sinn, Ulrike Herrmann und Norman Paech explizit Thema: Die Marxsche Theorie strotzt nur so von Fehlern. Bestenfalls sei der Lektüre des „Kapitals“ – etwa anhand ausgewählter Stellen, was Dath auf gewisse Weise bestätigt, wenn er Detailerkenntnisse für wichtiger hält als einen imaginären „Riesendurchblick“ (Dath 2017, 30) – ein anregender Charakter zu bescheinigen.
Sinn und Paech nehmen Marx dabei als Stichwortgeber für ihre eigene Konzepte einer marktwirtschaftlichen Steuerung oder einer „Postwachstumsökonomik“ in Anspruch, erkennen ihn also als einen in die Irre gegangenen Vorläufer ihrer eigenen Bemühungen an. Die vier sachhaltigen Argumente, die das Heft der Bundeszentrale präsentiert, sollen hier nur kurz genannt werden. (Eine Auseinandersetzung mit solchen und anderen Marx-Widerlegungen folgt wahrscheinlich demnächst auf der IVA-Website.) Erstens: Marx habe im „Kapital“ den Untergang des Kapitalismus vorausgesagt und sich damit grundsätzlich geirrt. Er habe darauf gesetzt, „dass seine Theorie die immanenten Destabilisierungstendenzen des Kapitalismus richtig identifiziert…“ Aber: „Der Kapitalismus hat sich bis heute als äußerst überlebensfähig erwiesen… Es ist an der Zeit, das Vertrauen auf einen geschichtsphilosophischen Automatismus aufzugeben.“ (Quante 2017, 9). Zweitens: Marx gehe von der „Verelendung“ des Proletariats aus, die nicht eingetreten sei. Vielmehr habe eine allgemeine Wohlstandsmehrung stattgefunden, wobei die moderne „Konsumgesellschaft“ ihre eigenen, von Marx nicht vorausgesehenen Probleme aufweise. „Die Arbeiter sind nicht verelendet“. (Herrmann 2017, 19) Drittens: Die Marxsche Erklärung der Ausbeutung sei nicht haltbar, da schon die Arbeitswerttheorie schwere Mängel enthalte. „Zu Marx’ größten wissenschaftlichen Fehlleistungen gehört die Arbeitswerttheorie…, denn erstens sind die Löhne nur eine von vielen Kostenkomponenten einer Firma und zweitens sind Preise grundsätzlich Knappheitspreise, die ihren Wert auch von den Präferenzen und der gegenseitigen Konkurrenz der Nachfrager herleiten.“ (Sinn 2017, 24) Viertens: Die moderne Geldwirtschaft und die Akkumulation, wie sie sich mit Hilfe und im Bereich des Finanzkapitals vollzieht, könne Marx nicht erklären. Marx habe „letztlich nicht verstanden, wie Geld funktioniert. Er blieb in einem Sumpf von Widersprüchen stecken, weil er irrtümlich glaubte, dass auch das Geld eine Art Ware sei… Marx stand vor dem Rätsel, warum auch die Geldscheine wertvoll waren. Er erkannte nicht, dass Geld eine soziale Konvention ist… Da Marx jedoch glaubte, dass Geld gleich Gold sei, konnte er nie schlüssig erklären, wie die Kreditvergabe funktioniert.“ (Herrmann 2017, 21)
Zwar trifft keiner der hier erhobenen Vorwürfe zu, doch in solchen Würdigungen – vor allem etwa bei sich kritisch verstehenden Journalisten wie Matthias Greffrath (2017) oder Ulrike Herrmann (2016, 2017) – schwingt immer noch eine gewisse Anerkennung der theoretischen Aufbereitung ökonomischer Probleme mit. Die Marx-Lektüre soll z.B. einen reinigenden Effekt haben, danach laufe man „gleichsam mit einem kritischen Geist, einem gewaschenen Gehirn herum“ (Greffrath 2017, 120). Oder: „Immerhin, die ‚Kapital‘-Lektüre hilft dabei …, wenigstens im Denken nicht unter unseren Möglichkeiten zu bleiben.“ (Ebd.) Wie gesagt, das ist eine kümmerliche Art, die Marxsche Theorie zur Kenntnis zu nehmen, und der gewiefte Journalist Greffrath lässt auch die Gelegenheit nicht aus, in seinem Lob der Marx-Lektüre einen Anklang an den alten antikommunistischen Topos von der „Gehirnwäsche“ unterzubringen. Aber all das toppt der Historiker Plumpe – übrigens auch eine ehemaliger Kommunist („Politisch organisierte Plumpe sich bis 1989 in der DKP“, heißt es in seinem Wikipedia-Eintrag), wohl mit derselben Glaubenshaltung, die Dath in seinem Beitrag aufspießt und in ihrem trostlosen Opportunismus kenntlich macht. Bei Plumpe erfährt Marx eine selten kompromisslose, plumpe Abfuhr. Der Historiker wendet sich der biographischen Nachforschung zur „Kapital“-Entstehungsgeschichte zu und kommt zu dem Schluss, dass hier ein tendenziell größenwahnsinniger Autor mit dem Anspruch einer Gesamterklärung angetreten und wegen der Fehlkonzeption seiner Analyse gescheitert sei. Immerhin habe Marx das Scheitern durch die Nicht-Veröffentlichung von Band zwei und drei des „Kapital“ im Grunde selber eingestanden; die eigentliche Dogmatisierung sei dann durch die Nachfolger erfolgt.
„Nicht die Krankheit hinderte Marx an der Arbeit, sondern die theoretischen und konzeptionellen Probleme erwiesen sich als unlösbar… Die wissenschaftliche Kritik ist sich in der Tat einig, dass ‚Das Kapital‘ ungelöste Schwachstellen besitzt, und zwar einerseits in der Arbeitswert- beziehungsweise Arbeitsmengenlehre und dem davon ausgehenden Transformationsproblem, sodann im Verelendungskonzept und in der Bevölkerungstheorie, schließlich auch im Bereich des ‚Gesetzes‘ vom tendenziellen Fall der Profitrate, um nur die drei prominentesten Bereiche zu nennen. Die insofern maßgebliche Kritik von Joseph Schumpeter wird von der modernen Forschung zumeist geteilt…“ (Plumpe 2017, 16) Das Verfahren ist ganz billig. Erstens rekapituliert Plumpe die bekannten Äußerungen von Marx und Engels – vorwiegend aus ihrem Briefwechsel – über den mühseligen Prozess, der zur Veröffentlichung des „Kapital“ führte, interessiert sich aber für keins der debattierten theoretischen Probleme und die daraus resultierenden Verzögerungen, sondern deduziert daraus einen fiesen Charakter des Autors Marx. Der habe seinen Freund Engels ewig hingehalten und hinters Licht geführt, um ihn sich weiter als Sponsor seiner verkrachten Existenz zu erhalten. Zweitens beruft sich Plumpe für das Verdikt „ungelöste Schwachstellen“ – übrigens eine unsinnige Formulierung – schlichtweg auf die Autorität Schumpeter (Näheres zu dessen Kritik in: „Marx is back“, Vol. 1, IVA, Texte2017). Der wird man ja wohl nicht widersprechen! Merke: Wer außerhalb der Wissenschaftlergemeinde steht und nicht deren Anerkennung besitzt, hat sich nicht nur persönlich, sondern auch wissenschaftlich diskreditiert.
So zeigt die Bundeszentrale heute letztlich doch wieder mit einem bekenntnisstarken Autor, der selber erst nach jugendlichen Verirrungen im Zuge seiner Karriereplanung zu Kreuze gekrochen ist, klare Kante gegen den Marxismus – wie zu den besten Zeiten des Kalten Krieges, als die Behörde mit ihrem „Handbuch des Weltkommunismus“ das Publikum gegen die üblen Charaktere und totalitären Versuchungen des Bolschewismus immunisieren wollte.
Literatur
- Beatrix Bouvier, Karl Marx: Bildnis und Ikone. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 34-40.
- Dietmar Dath, Hinschauen statt glauben – Ein Erfahrungsbericht aus der Langstrecken-Marxlektüre. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 29-33.
- Heinrich Geiselberger (Hg.), Die große Regression – Eine internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit. Berlin 2017.
- Matthias Greffrath, Der Mehrwert von Marx – Zur anhaltenden Aktualität des „Kapital“. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 6, 2017, S. 109-120.
- Karl Held/Theo Ebel, Krieg und Frieden – Politische Ökonomie des Weltfriedens. Frankfurt/M. 1983.
- Ulrike Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung – Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir heute von Smith, Marx und Keynes lernen können. Frankfurt/M. 2016.
- Ulrike Herrmann, „Das Kapital“ und seine Bedeutung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 17-22.
- Ernst Theodor Mohl u.a., Folgen einer Theorie – Essays über ‚Das Kapital‘ von Karl Marx. Frankfurt/M. 1967.
- Niko Paech, Postwachstumsökonomik – Wachstumskritische Alternativen zu Karl Marx. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 41-46.
- Werner Plumpe, „Dies ewig unfertige Ding“ – „Das Kapital“ und seine Entstehungsgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 10-16.
- Michael Quante, A Traveller’s Guide – Karl Marx’ Programm einer Kritik der politischen Ökonomie. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 4-9.
- Michael Quante/David P. Schweikard (Hg.), Marx-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2016.
- Hans-Werner Sinn, Was uns Marx heute noch zu sagen hat. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 23-28.
Juni
Pädagogik gegen rechts, ächz
Gegen rechts geht der demokratische Staat meist ausgrenzend vor, auch wenn Bemühungen der Bildung und Aufklärung gefragt sind. Eine neue Arbeitshilfe von Gloël/Gützlaff/Weber stellt das in Frage, kritisiert den pädagogischen Mainstream und bietet selber einen Argumentationsleitfaden. Dazu ein Kommentar von Johannes Schillo.
Die „Bewältigung“ des historischen Faschismus und die Immunisierung der Bevölkerung gegen seine „Anfänge“, denen es in der heutigen Demokratie dauernd zu „wehren“ gilt, sind als wichtige pädagogische Aufgabe anerkannt. Zwar geht der demokratische Staat mit Vorliebe ausgrenzend und repressiv gegen das Gemisch aus Rechtsextremismus, -radikalismus und -populismus vor (vgl. Gutte/Huisken 2007, 44ff; Huisken 2012a, 18ff), wobei er sich freilich – siehe den Fall NSU – in seiner staatsschützerischen Aufmerksamkeit für diese Szene maßvoll zeigt und nicht gleich aus jeder Mücke einen Elefanten, sprich aus einer bewaffneten Mördertruppe eine rechtsterroristische Vereinigung macht. Aber der Bedarf reicht eindeutig darüber hinaus, pädagogischer Einsatz in den verschiedenen Abteilungen in und außerhalb der Schule ist gefragt.
Dazu gibt es im Folgenden einige Anmerkungen, verbunden mit einer Information zu der aktualisierten Neuausgabe „Gegen Rechts argumentieren lernen“ von Rolf Gloël, Kathrin Gützlaff und Jack Weber, die im Juni bei VSA (Hamburg, 3. Auflage 2017) erschienen ist.
Extremismusbekämpfung
Die Abwehr des (Neo-)Faschismus hat in pädagogischer Hinsicht zunächst ihren festen Platz im Schulunterricht. Bei allen Unterschieden, die vom jeweiligen Personal oder Material herrühren mögen, gibt es eine Leitlinie: Der Faschismus wird – neben dem Kommunismus – als eine Variante totalitärer Herrschaft dargestellt, und seine aktuell identifizierten Bestrebungen gehören in die Kategorie Extremismus, unter die auch vieles Andere (vom Salafismus bis zum Marxismus) fällt. Die diversen extremistischen Strömungen, die, ernst genommen, lauter unterschiedliche bis gegensätzliche Positionen vertreten, soll nämlich ein gemeinsames Ziel verbinden: die Zerstörung des demokratischen Verfassungsstaats. Faschismus ist, so betrachtet, seinem Wesenskern nach ein demokratiefeindliches Projekt. Wenn sich daher der Geschichts- oder Politikunterricht dem Aufstieg der NSDAP und der Durchsetzung der NS-Herrschaft widmet, wird dies unter dem Blickwinkel eines Betriebsunfalls der Republik – mangelnde Wachsamkeit und Abwehrbereitschaft, die heute glücklicher Weise beseitigt sind – ins Visier genommen.
In der Regel, schreibt Freerk Huisken in seiner Kritik des hiesigen Schulsystems, nimmt die Befassung mit dem Thema ihren Ausgang bei der Frage „Wie konnte es dazu kommen?“ (Huisken 2016, 353f). Die Frage ist nicht so unschuldig, wie sie klingt, nämlich kein banales Begehren nach Auskunft über den Werdegang des betreffenden Projekts. Sie wird unter der Voraussetzung gestellt, dass die „unfassbare“, letztlich im Holocaust gipfelnde Entwicklung eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Sie enthält, so Huisken (2016, ebd.), „bereits eine alles entscheidende Festlegung: Einem politischen Willen und Programm der Nation ist der Faschismus nicht entsprungen. Weil es die eigene Nation ist, deren Schandtaten man da auf Geheiß der Siegermächte seit 1945 in deutschen Schulen zwecks Einlösung der verordneten Buße besichtigt, steht eine objektive Betrachtung des Nationalsozialismus nicht zur Debatte. Das würde das eigene Nest nur über Gebühr beschmutzen. Er kann nur als moralische Entgleisung und Betriebsunfall der Geschichte angesehen werden, der sich dem Zusammentreffen unglücklicher Umstände verdankt, also in letzte Instanz von niemandem gewollt war. Mit einer Ausnahme: Hitler.“
Die Schule hat ihre klare Aufgabe darin, den Nachwuchs gegen Rechts und gegen Links (vgl. Huisken 2012b) zu immunisieren. Doch schon seit der Adenauerära gilt der Schulunterricht als nicht ausreichend, speziell seit den Hakenkreuzschmierereien Ende der 1950er Jahre wurden flankierende Maßnahmen an der pädagogischen Front ergriffen. So wurden zusätzlich außerschulische Programme aufgelegt. Jugend- und Sozialarbeit, berufliche Bildung und Verbandsarbeit, Jugend- und Erwachsenenbildung, Beratungs- und Betreuungsinitiativen, Aufklärungs- und Informationskampagnen wurden mit diversen Programmen („Jugend für Toleranz und Demokratie“, „Civitas“, „Xenos“, „Entimon“…) aus Bundes-, später auch aus EU-Mitteln initiiert und unterstützt. Ein eigenes „Demokratieförderungsgesetz“ ist in Arbeit und die Bundeszentrale für politische Bildung hat Materialien, Medien, Fortbildungsprogramme etc. entwickelt, wobei sie besonderen Wert darauf legt, Ansatz und Ergebnisse der Extremismusforschung didaktisch verbindlich zu machen. Der Kampf „gegen Rechts“ wurde und wird daher auf weite Strecken als eine Art Immunisierungs- oder Deprogrammierungsstrategie geführt, als eine Ausgrenzung, die mit staatlicher Hoheit über die Zulassung oder Zugehörigkeit zum Pluralismus verfügt.
Ungefestigte Persönlichkeiten stabilisieren?
Die entsprechenden Konsequenzen für Bildung und Aufklärung sind auf der IVA-Website (siehe Texte2016 und Texte2017) bereits mehrfach Thema gewesen. So der Sachverhalt, dass daraus bestimmte Definitionen des Problems und seiner pädagogischen Bearbeitung folgen (eine Übersicht nach der vorletzten Kampagne des „Kampfes gegen Rechts“ zu Beginn der 2000er Jahre findet sich bei Ahlheim 2005, zu neueren Ansätzen siehe Kohlstruck 2011). Als wichtigste Punkte sind zu nennen:
- Rechtsextremismus/Neofaschismus ist ein Fall von (männlicher) Gewaltbereitschaft und auf diverse charakterliche Defizite, bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel, zurückzuführen.
- Er ist primär ein Jugendproblem, resultiert aus einer Fehlentwicklung bzw. Ausnutzung der Schwierigkeiten, die speziell bei der Passage vom Jugend- ins Erwachsenenalter auftreten.
- Sozialpädagogische Ansätze, paradigmatisch die „Akzeptierende Jugendarbeit“, sind die adäquate Antwort darauf, da sie die Persönlichkeitsentwicklung bei den Zielgruppen stabilisieren statt mit der Betonung politischer Differenzen den Zugang zu erschweren.
- Das Leitbild der Zivilcourage ist eine entscheidende Orientierung für Jugendliche und Erwachsene, es führt zu einem – spontan abrufbaren – Habitus, der sich in Konfliktsituationen als Einsatz für die Demokratie bewährt.
- Die psychologische Sichtweise ist dem Problem angemessen: Sie erklärt die Anfälligkeit für rechte „Rattenfänger“ mit Theorien einer beschädigten Persönlichkeit, mit einer Sozialpsychologie des Vorurteils oder mit Steuerungsdefiziten bei Aggressivität.
- Konzepte eines Argumentationstrainings müssen sich daran orientieren: Der Diskurs mit rechten Positionen, mit „populistischen Vereinfachungen“ oder „Stammtischparolen“ ist eine Frage mehr oder weniger gelungener Durchsetzungsstrategien einer stabilen Persönlichkeit.
Im Einzelnen wären hier viele weitere Dinge aufzuführen, wobei die didaktischen und methodischen Festlegungen natürlich ihre Konjunkturen kennen. Im Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen hat etwa die „Betroffenheitspädagogik“ eine wichtige Rolle gespielt – sie ist inzwischen etabliert und, wegen Aussterbens der Zeitzeugen-Generation, wieder verstärkt gefragt (vgl. Ahlheim 2017; zur Kritik am pädagogischen Konzept vgl. „Ein KZ-Besuch – betroffen“ in: Gutte/Huisken 2007, 229ff). Gemeint ist hier die – betroffen machende – Konfrontation der Nachgeborenen mit den Gräueltaten des historischen Faschismus. Sie wird pädagogisch inszeniert, damit, wie ein Befürworter des Ansatzes formuliert, „das furchtbare Geschehen von damals unauslöschlich Teil unseres Bewusstseins“ wird (zit. nach Loidolt 2013, 23). Die über Medien oder Gedenkstättenbesuche bewirkte Begegnung mit der Vergangenheit soll den Nachwuchs gewissermaßen mit Antifaschismus imprägnieren, so dass er nicht mehr der Faszination des rechten Angebots erliegt. Eine allgemein anerkannte Position ist es daher, wenn der Jüdische Weltkongress fordert: „Jeder Schüler muss ein KZ besucht haben“ (Bild, 25.2.2017). Dagegen war in Deutschland jahrzehntelang Hitlers „Mein Kampf“ verboten, obwohl sich diese Programmschrift gerade als Material für die politische Bildung geeignet hätte (vgl. Henle 2010). Hier befürchteten die Verantwortlichen vielmehr, dass der Text auch bei den Nachgeborenen seine Faszination entfalten könnte.
KZ-Besuche im Sinne der genannten Betroffenheitspädagogik werden z.B. vom Verein March of Remembrance and Hope organisiert (Website: http://www.remembranceandhope.com/). Georg Loidolt hat in seiner Kritik an der Praxis der Vergangenheitsbewältigung dessen Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen exemplarisch aufgegriffen (Loidolt 2013, 27ff). Der Verein bietet für Schulklassen Führungen durch das KZ Auschwitz an. Zwecks Einfühlung in die Betroffenheit von rassistischer Verfolgung, wie sie den Juden damals widerfuhr, müssen die Jugendlichen Mäntel mit entsprechenden Markierungen und Hauben tragen, um die Besichtigung aus der Perspektive der Opfer zu erleben und auf diese Weise einen nachhaltigen Eindruck von deren Leid zu erhalten. Grausamkeit und Bösartigkeit des Faschismus sollen sich also bei den Jugendlichen „unauslöschlich“ einprägen, indem sie die Rolle der Opfer nachspielen. Aufklärung über die Motive und Begründungen der Täter wird so nicht geleistet. Deren Taten erscheinen nicht als Folge eines politisches Programms, sondern als Ausgeburt von Menschenfeindlichkeit.
Gegen die sich zu wappnen bzw. den Nachwuchs in Stellung zu bringen, erfordert eine spezielle Veranstaltung. Verständlicher Weise, denn die Auslöschung von Menschenleben ist in der heutigen Welt globaler Ordnungsstiftung eine Selbstverständlichkeit, ja oft ein Triumphgeheul wert, wenn es gegen die Bösen, gegen „Schurkenstaaten“, gegen Islamisten oder Terroristen geht, wenn z.B. die nahöstliche Wüste bombardiert wird, bis „der Sand glüht“ (US-Präsidentschaftskandidat Ted Cruz). Es ist also Unterscheidungsvermögen verlangt: Wenn russisches und syrisches Militär rücksichtslos die Millionenstadt Aleppo Tag für Tag bombardiert, um sie von Terroristen zu „befreien“, ist das eine humanitäre Katastrophe ersten Ranges, ja ein Kriegsverbrechen, über das die Medien in aller Ausführlichkeit berichten und bei dem sie, zusammen mit den politisch Verantwortlichen, den Tod „wunderschöner Babys“ (Präsident Trump) nicht mehr aushalten können. Wenn das US-Militär mit einem Haufen zweifelhafter Verbündeter Monate lang die Millionenstadt Mossul angreift, Tausende Lufteinsätze fliegt, Stadtteile von Milizionären „säubert“, dabei von NGO‘s eine humanitäre Katastrophe registrieren lässt, für die natürlich islamistische Terroristen verantwortlich sind, dann ist das ein Feldzug, von dem man ab und zu in der Zeitung liest, dessen Feldherren unsere Öffentlichkeit aber im Prinzip die Daumen drückt. Deshalb müssen Jugendliche heute lernen, dass bestimmte Leichenberge – so die jüdischen zur Zeit der NS-Herrschaft – nicht einfach mit Achselzucken zu übergehen sind, sondern einen Skandal erster Güte darstellen. Hier ist dann Identifikation mit den Opfern angesagt, z.B. dadurch, dass man sich als KZ-Häftling verkleidet.
Argumentieren gegen Überzeugungen!
Die Schwierigkeiten, die die Bildungsarbeit mit einer Kritik des Rechtstrends hat, macht exemplarisch ein neuer Sammelband von Björn Milbradt und Kollegen deutlich, der aus einer universitären Ringvorlesung gegen Rechtsextremismus hervorgegangen ist. Man müsse, heißt es hier, die repressiven gesellschaftlichen Potenziale der Rechtsentwicklung offen legen und der Reflexion zugänglich machen. „Die Grundlage hierfür muss insbesondere der Bildungssektor schaffen, der möglichst allen Menschen ein vertieftes Verständnis moderner Gesellschaften ermöglichen sollte“, schreiben die Herausgeber (Milbradt u.a. 2017, 10). Gleichzeitig resümieren sie die praxisorientierten Überlegungen dahingehend, „dass überzeugte Rechtsextreme durch Argumente nicht zu erreichen sind“ (ebd., 13). Diese paradoxe Position gibt den Konsens wieder, der auf weite Strecken die pädagogische Praxis bestimmt.
Es ist der Konsens, gegen den die neu erstellte Arbeitshilfe von Rolf Gloël, Kathrin Gützlaff und Jack Weber anschreibt. „Wer ‚gegen Rechts argumentieren‘ will, hat sich etwas vorgenommen, was über die Identifizierung rechter Standpunkte und das Reden über sie hinausgeht: Es geht diesem Buch darum, nicht einfach über, sondern gegen Rechts zu reden, d.h. zu argumentieren“, halten die Autoren in ihrer Einleitung fest (Gloel u.a. 2017, 12). Und mit einer weiteren Feststellung präzisieren sie ihre Gegenposition zum pädagogischen Mainstream: „Dass rechtes Denken dumm und schädlich ist, bedeutet nicht, dass es nicht seine eigene Logik hat: Oft ist es hilfreich, diese innere Logik rechten Denkens nachzuvollziehen – nicht um dafür Verständnis zu entwickeln, auch nicht um sich darüber zu erheben, sondern um sich über die Logik des Fehlers zu Argumenten gegen ihn vorzuarbeiten“ (ebd.).
Dazu geht das Buch erstens (Kapitel 1) auf das zu Grunde liegende politische bzw. politikwissenschaftliche Problem ein, d.h. auf den „Rechtsruck“ und seine Gründe, wie sie aus offiziellem Blickwinkel ins Visier genommen werden. Zu der Frage, warum sich Menschen rechten politischen Vorstellungen, Parteien und Organisationen anschließen, werden fünf gängige Erklärungen („Angst“, „Soziale Unzufriedenheit“, „Einfache Lösungen“, „Unzufriedenheit mit den Eliten“, „Populismus und Rattenfängerei“) mit entsprechenden Gegenthesen der Autoren geboten. In einem zweiten Schritt wird thematisiert, wie die etablierte Politik auf den Rechtsruck reagiert. Dabei kommen auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen etablierten und rechten Parteien zur Sprache.
In seinem Hauptteil (in den Kapiteln 2 bis 4) stellt das Buch zweitens ein konkretes Argumentationskonzept vor, das die Bereiche Nationalismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit umfasst. Dabei sind die Kapitel so konzipiert, dass sie jeweils für sich stehen und in entsprechende Bildungsmaßnahmen eingebaut werden können. In die dritte Auflage wurden natürlich die neueren Entwicklungen seit den Protesten gegen Merkels Flüchtlingspolitik einbezogen. So würdigen die Autoren neben den „zeitlosen“ Beispielen rechten Denkens und den einschlägigen Gegenargumenten die aktuellen Fassungen von Nationalismus und Rassismus. Insbesondere werden Stellungnahmen von Politikern der AfD, z.B. solche, die für öffentliches Aufsehen gesorgt haben, daraufhin untersucht, worin rechte Positionen heute bestehen und worin sie sich vom politischen Mainstream unterscheiden bzw. mit ihm übereinstimmen. So liegt mit der dritten Auflage eine aktualisierte, in Teilen vollständig erneuerte Fassung der Bemühung vor, „gegen Rechts“ ein argumentatives Konzept zu entwickeln. Dabei sind die Texte mit vielen Materialien, Infoboxen, Abbildungen, Karikaturen etc. versehen, also leser- und nutzerfreundlich gestaltet.
Das letzte (5.) Kapitel kommt drittens noch einmal zum Ausgangspunkt zurück. Es bilanziert und diskutiert die Schwierigkeiten der pädagogischen Arbeit in einem Überblick zu den „Wegen und Holzwegen politischer Bildung gegen Rechts“ (Autor: Malte Thran). Ein erster Punkt ist hier das Verhältnis von Diskriminierung und Sprache, das gerade in der rassismuskritischen Bildung eine Rolle spielt. Thran hält fest, dass Sprachkritik ein Auftakt zur Kritik der entsprechenden Auffassungen sein kann. „Die gängige Sprachkritik leistet das aber gerade nicht“, heißt sein Fazit (ebd., 169). Er verweist darauf, dass auch hier, wo der (öffentliche) Diskurs zum Thema gemacht wird, der politische Inhalt leicht aus dem Blickfeld gerät, weil die Form der Äußerung in den Vordergrund rückt: „Indem nach diskriminierenden Termini gesucht und ihre Nutzung unterbunden werden soll, wird die abwertende Wortwahl zu einem maßgeblichen Feld der politischen Betätigung erklärt, der Sprachgebrauch wird korrigiert. Die in als abwertend klassifizierten Kategorien wie ‚Behinderte‘ oder dem N-Wort angewandten Maßstäbe sowie die Gründe, nach denen Menschen (gruppenbezogen) abgewertet werden, geraten bei einer auf bloße Sprachkorrektur zielenden Kritik in den Hintergrund.“ (Ebd.) Des Weiteren geht es um Ansätze, die in der außerschulischen Bildung eine Rolle spielen (Besuche von Gedenkstätten, Konfrontation mit Zeitzeugen, Erzeugen von Betroffenheit).
Einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, so lautet der Schluss des Buchs, muss es darum gehen, „die notwendigen Verbindungen und Übergänge zwischen (heutigem wie damaligem) Nationalismus und Rassismus einerseits und menschenverachtender Gewalt andererseits darzustellen und zu erklären“. (Ebd., 183) Mit der Erzeugung von Betroffenheit – siehe oben – ist es nicht getan! Bleibt anzumerken, dass das Buch natürlich nicht nur für die pädagogische Praxis relevant ist, sondern auch als ein Einführung in das Thema „Rechtsruck“ gelesen werden kann. Auf weiterführende Literatur – z.B. auf die oben erwähnten Texte von Huisken – wird verwiesen.
Literatur
- Klaus Ahlheim, Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. In: Wolfgang Sander (Hg.), Handbuch politische Jugendbildung, Schwalbach/Ts. 2005, S. 379-391.
- Klaus Ahlheim, Erinnern als Chance – auch gegen Rechtsextremismus? Die Vielfalt der Erinnerungsorte ist eine Chance für wirksame politische Bildung. In: Erwachsenenbildung, Nr. 2, 2017, S. 64-66.
- Rolf Gloël/Kathrin Gützlaff, Gegen Rechts argumentieren lernen. 1. Aufl., Hamburg 2005 (2. Aufl., 2010).
- Rolf Gloël/Kathrin Gützlaff/Jack Weber, Gegen Rechts argumentieren lernen. Aktualisierte Neuausgabe. Hamburg 2017.
- Rolf Gutte/Freerk Huisken, Alles bewältigt, nichts begriffen! Nationalsozialismus im Unterricht – Eine Kritik der antifaschistischen Erziehung. Hamburg 2007.
- Manfred Henle, „Mein Kampf“ – ein Plädoyer für die Lektüre. In: Praxis Politische Bildung, Nr. 3, 2010, S. 210-218.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012a.
- Freerk Huisken, Mobilisierung in deutschen Schulen gegen Linksextremismus: Eigentlich überflüssig? In: Susanne Feustel u.a. (Hg.), Verfassungsfeinde – Wie die Hüter von Denk- und Gewaltmonopolen mit dem „Linksextremismus“ umgehen. Hamburg 2012b, S. 57-70.
- Freerk Huisken, Erziehung im Kapitalismus – Von den Grundlügen der Pädagogik und dem unbestreitbaren Nutzen der bürgerlichen Lehranstalten. Aktualisierte und ergänzte Neuausgabe. Hamburg 2016.
- Michael Kohlstruck, Bildung „gegen rechts“. In: Benno Hafeneger (Hg.), Handbuch Außerschulische Jugendbildung. Schwalbach/Ts. 2011, S. 307-324.
- Georg Loidolt, Vom Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Wien 2013, Vertrieb über: www.amazon.de.
- Björn Milbradt u.a. (Hg.), Ruck nach rechts? Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und die Frage nach Gegenstrategien. Opladen u.a. 2017.
Trump – eine Witzfigur?
Der US-Präsident hat, daheim und auswärts, eine ausnehmend schlechte Presse. Und bis auf seine Anhänger misstraut ihm fast alle Welt. Nur: Schlechte Meinungen über eine Politiker sind etwas anderes als eine Beurteilung der Politik – ein banaler, aber entscheidender Unterschied, auf dem die neue Analyse des Gegenstandpunkts besteht. Dazu im Folgenden eine Information der IVA-Redaktion.
Der neue US-Präsident, der jetzt seit einem halben Jahr im Amt ist und seinen politischen Gestaltungswillen ausgiebig unter Beweis stellt, hat sowohl im Inland als auch im Verkehr mit anderen Machthabern für ziemlichen Aufruhr gesorgt:
- Erstens mit den politischen Maßnahmen, die er ankündigt und ergreift – zuletzt natürlich mit seinen Auftritten bei NATO-Gremien, bei der EU und beim G7-Treffen sowie mit seiner Ankündigung von Anfang Juni, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen werden.
- Zweitens mit seiner speziellen Art, sich immerzu auf das amerikanische Volk als die Instanz zu berufen, in deren Namen und für die er sein hohes Amt ausübt. Damit hat er sich den Titel „Populist“ eingehandelt – er sei ein Volksverführer, der den Leuten nach dem Munde redet, um an die Macht zu kommen, und sie dann auf nationalistische Abwege führt.
- Drittens mit seinem präsidialen Politikstil, also auf Grund seines speziellen Umgangs mit der heimischen Bürokratie und Justiz (die er angreift und auf Linie bringen will), mit den Medien (die er bekämpft und umgeht), aber auch mit Fakten (die er erfindet).
Über all das gibt es hierzulande lauter negative Urteile. Trump gilt, außer bei den Rechten (so etwa bei der AfD, die ihm zur Amtsübernahme ein „hoffnungsvolles“ Glückwunschtelegramm schickte), als Fehlbesetzung – wahlweise als gefährlich, destruktiv, egomanisch, als Phrasendrescher, Lügner oder alles zusammen. Im deutschen Staatsfernsehen kommen Psychiater zu Wort, die ihn als psychisch krank einstufen (ARD, „Hart, aber fair“, 22.5.2017), und nach seiner ersten Rundreise mit Stationen in Europa kommentiert der Spiegel (21/2017): „Das mächtigste Kind der Welt. Donald Trump ist nicht dazu in der Lage, Präsident der USA zu sein. Er ist es intellektuell nicht: Er versteht die eigenen Aufgaben und die Bedeutung seines Amtes nicht… Und moralisch ist er es sowieso nicht: Trump ist ein hundertfach überführter Lügner, Rassist, Betrüger… Die USA haben eine Witzfigur zu ihrem Präsidenten und sich selbst von dieser Witzfigur abhängig gemacht.“ Trump gilt also nach Charakter und Fähigkeit als völlig ungeeignet für das hohe Amt, in das ihn das US-Volk – entsprechend den heimischen Regeln der Mehrheitsbildung – gewählt hat. Die europäische und die deutsche Öffentlichkeit bestreiten dem Mann rundum die Eignung für die hohe Politik. Nach ihren vorgestellten Maßstäben ist er politikunfähig, hat es nicht verdient, dass man ihn zum mächtigsten Mann der Welt wählte, und umgekehrt soll Amerika, dieses großartige Land, einen solchen Chef nicht verdient haben. Durch ihn sei Amerikas „globale Führungsrolle“ beschädigt, ja mit der letzten klimapolitischen Entscheidung eigentlich verspielt: „Im Grunde dankt er ab.“ (FAZ, 3.6.2017)
Analyse eines Politikwechsels
Die neue Ausgabe der Politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt (2/17), die gerade erschienen ist (Website: http://www.gegenstandpunkt.com/), bietet eine ausführliche Analyse des amerikanischen Politikwechsels, der ja nicht nur das Inland, sondern die politischen Verhältnisse buchstäblich bis in den letzten Erdenwinkel hinein betrifft. Die Analyse wendet sich entschieden gegen die Tour, Trump zu einer Unperson und sein politisches Wirken damit als eine einzige Ansammlung von Fehlgriffen zu erklären. Die Verachtung der Person, die das Amt demokratisch erobert hat, lebt ja von der Hochachtung vor einer vorgestellten, eigentlichen Verantwortung der US-Macht, gibt also vor allem Auskunft über den Standpunkt des Begutachters, der in der praktizierten Politik seine Vorstellungen von der Rolle einer Weltführungsmacht nicht wiederfinden kann. Bei den politisch Verantwortlichen in Berlin oder Brüssel liegt natürlich auf der Hand, was sie an dem „undemokratischen Populisten“ im Weißen Haus, der sein Volk verführt oder betrügt, so sehr stört. Ihre Sorge gilt weniger dem amerikanischen Volk als ihrem europäischen Staatenbündnis, das Trump als konkurrierendes ökonomisches wie politisches Machtprojekt und Vehikel einer deutschen Führungsmacht bekämpfen will – und das auch in aller, fast schon undiplomatischen Offenheit ausspricht. Diese Konkurrenzlage macht die aktuelle GS-Ausgabe übrigens im Eröffnungsbeitrag „Deutschlands Leitlinie für Europas Völker“ eigens zum Thema. Der Beitrag beschäftigt sich mit den Sorgen, die den Europäern der erkennbar radikale Wille Trumps bereitet, Amerikas Macht zur Korrektur der „bad deals“ der Vergangenheit einzusetzen. Damit, so der GS, desavouiert sich aus dem Blickwinkel eines deutscheuropäischen Führungsanspruchs der gewählte Präsident als un-verantwortlicher Machthaber und soll hinreichend auf den Begriff gebracht sein – als Zerstörer einer guten, nämlich „unserer“ bisherigen Weltordnung.
Der Gegenstandpunkt handelt das neue US-Regime in zwei Beiträgen ab. Erstens wird unter der Überschrift „Donald Trump und sein Volk – zu ihrem Glück vereint“ (Decker 2017a) die innere Situation der USA zum Thema gemacht. Ausgangspunkt ist die Besonderheit des aktuellen Amtswechsels, der sich eben nicht als normaler demokratischer Vorgang versteht, sondern einen Bruch mit der bisherigen Politik – mit dem von Trump unablässig angefeindeten „Establishment“ – will, also einen wirklichen Politikwechsel anstrebt und dafür antinationale Kräfte identifiziert, denen der Prozess zu machen sei. Diese Kräfte gibt es für Trump oben und unten in der amerikanischen Gesellschaft: Politiker die den Ausverkauf des Landes betreiben, während sie in die eigene Tasche wirtschaften, und Migranten, Kriminelle, Terroristen sowie sonstige Individuen, die nicht willens, berechtigt oder fähig sind, ihren Beitrag zum harten amerikanischen Erwerbsleben zu leisten. Dessen Eigentümlichkeiten erklärt der Artikel ausführlich und beantwortet damit auch die Frage, wie es kommen kann, dass sich ein stinkreicher Immobilienhändler mit dem hart arbeitenden Volk, speziell mit der Not der Arbeitslosen im amerikanischen „Rust Belt“, identifiziert – und dass ihm das auch noch millionenfach abgekauft wird. Decker und Co. nehmen das nicht zum Anlass, die üblichen Dementis zu liefern (à la „das kann doch nicht die Wahrheit sein…“), sondern untersuchen die Art und Weise, wie sich hier Führung und Volk zusammenschließen. Dabei kommen die amerikanischen Besonderheiten zur Sprache – gerade im Unterschied zum europäischen, sozialstaatlich betreuten Kapitalismus (ebd., 41f) –, aber auch die speziell von Linken gewälzte Frage, ob man es hier mit einem neuen (Übergang zum) Faschismus zu tun hat (ebd., 46f).
Zweitens gibt es den Text „Donald Trump und die Welt“ (Decker 2017b), der sich zunächst mit Trumps Anspruch an die kapitalistische Weltwirtschaft – „Jobs for the American People“ – befasst und die gar nicht neue Leitlinie „Die Welt ist Mittel für den Reichtum der USA“ (ebd., 50) thematisiert – eine Leitlinie, die heutzutage allerdings auf einer veränderten Grundlage, nämlich der seit Jahren stattfindenden internationalen „Krisenkonkurrenz“ (ebd., 53f), proklamiert und implementiert wird. Das führt im nächsten Schritt zu Trumps Absage an die bisherige, gerade durch das Machtwort der USA installierte Weltordnung: „I’m going to rip up these bad trade deals and we’re going to make really good ones“ (ebd., 55). Drittens und letztens ist die Rückbesinnung auf das amerikanische Machtwort Thema – Trumps Auftrag an die Super-Gewalt Amerikas: „Wir müssen endlich wieder Kriege gewinnen!“ (ebd., 66). Dabei kommen auch die ersten Militäreinsätze und größeren diplomatischen Vorstöße der US-Regierung zur Sprache. Der Schluss heißt: „Trump kündigt die transatlantische Kumpanei und damit die Garantie für den Zustand namens ‚Weltfrieden‘, der Amerikas Bedürfnissen nicht mehr genügt“ (ebd., 74).
Zwischen Hoffen und Bangen
Auch für Linke, denen mehr oder weniger geläufig ist, dass der amerikanische Präsident die politische Gewalt einer kapitalistischen Weltmacht repräsentiert, kann das Aufklärung bieten. Denn die einschlägigen Debatten kreisen hier meist um andere Fragen als darum, was die neue Regierung will und unternimmt. Eher geht es um die Sorge, was da alles noch kommen mag und möglich werden könnte. Speziell steht in Frage, wie viel Macht die staatliche Sphäre überhaupt gegenüber der Wirtschaft besitzt und was sie sich deshalb leisten kann. Die Analyse der US-Politik erfährt hier also eine eigentümliche Verschiebung. Es geht um eine Verhältnisbestimmung, eine Gewichtung der beiden Größen Politik und Ökonomie; das Programm des Machthabers interessiert weniger, die von ihm ausgelösten Reaktionen, die möglichen Widerstände oder die Einschätzungen zum weiteren Verlauf dafür umso mehr. Das lässt sich dann leicht dahingehend verlängern, dass man erst einmal abwarten müsse, was aus den angekündigten Maßnahmen wird – und ob sich der neue Mann im Weißen Haus überhaupt auf Dauer halten kann. Dies war ja allgemein der Tenor der Berichterstattung nach dem überraschenden Wahlsieg des politischen Außenseiters und wird auch aktuell, etwa nach den Ermittlungen in Sachen Trump-Putin-Connection oder der Auslieferung eines hirngeschädigten Amerikaners aus nordkoreanischer Haft, wieder vorgebracht.
In einer deutschen Fernseh-Talk-Show Ende 2016 gab sich Oskar Lafontaine – der in Hillary Clinton die eigentliche Kriegstreiberin und „Terroristin“ ausgemacht hatte und deshalb selber einer gewissen Trump-Nähe verdächtigt wurde – recht abgeklärt: „Ich höre immer: Der amerikanische Präsident ist der mächtigste Mann der Welt. Dabei hat die Wirtschaft die amerikanische Politik fest im Griff, sodass der Präsident nur wenig verändern kann.“ (www.noz.de, 10.11.2016). Für Trumps resolutes Auftreten gegenüber großen Unternehmen fand Lafontaine Anfang 2017 im deutschen Fernsehen dann sogar lobende Worte, obwohl der Vorgang mit seiner ursprünglichen Diagnose gar nicht zusammen passte. „Es imponiert mir, dass ein Politiker vor Wirtschaftsunternehmen nicht kuscht“ (www.welt.de, 31.1.2017), äußerte Lafontaine in einer Talk-Runde und handelte sich damit entschiedenen Widerspruch sowie ein weiteres Mal den Verdacht ein, er sei selber ein unverbesserlicher Populist. Auch Autoren, die die „faschistoiden Züge“ des neuen Präsidenten hervorheben, befassen sich mit ähnlichen Einschätzungsfragen. So schreibt Thomas Hecker von der Kommunistischen Plattform der Linken Ende Mai, als Trump schon Monate im Amt ist: „Noch lässt sich das alles im einzelnen nicht einschätzen. Als sicher kann dennoch angenommen werden, dass hinter den Kulissen Kämpfe stattfinden. Welche Kapitalfraktion sich durchsetzen wird, ist die spannende Frage.“ (Hecker 2017, 13)
Es ist schon seltsam, wie linke Kreise sich in die öffentliche Debatte einklinken und dass z.B. die Mitteilung ‚Amerikas Kapitalismus geht trotz allem Aufruhr seinen gewohnten Gang‘ wie eine Beruhigung klingen soll. Exemplarisch führte das eine Kontroverse in der Zeitschrift Konkret vor, in der zunächst Herausgeber Hermann Gremliza zum Frühjahr 2017 anhand einiger Entscheidungen der neuen US-Regierung (Zurückstufung des Chefberaters Stephen Bannon, parlamentarische Blockade des ersten Gesetzesentwurfs zur Abschaffung von Obamacare…) festhielt, Trump, „der mächtigste Hampelmann der Welt“ (Gremliza 2017, 9), habe die Signale des Großkapitals verstanden – er werde jetzt auch nur business as usual machen. In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift konterte darauf Lars Quadfasel, nachdem sich die betreffenden Entscheidungen nicht mehr so eindeutig als Zurücknahme der ursprünglichen radikalen Ankündigungen interpretieren ließen: Die optimistische Diagnose Gremlizas habe sich so nicht bestätigt – „leider“, wie er eigens betonte, denn „als vernünftiger Mensch kann man nur hoffen, dass er mit ihr recht behält“ (Quadfasel 2017, 18).
Ist Trump also, wie Quadfasel formuliert, „in allererster Linie der Laufbursche des Kapitals“ (ebd.) oder nicht? Das soll das eigentliche Problem sein, das in der Kontroverse herausgestellt wird – wie gesagt als Frage, deren Beantwortung dann auch zu klären vermöge, „wie begründet die Hoffnung ist, dass ‚das Kapitalinteresse‘ es schon richten wird“ (ebd.). Quadfasel macht einige Anläufe, die von ihm in Anführungszeichen gesetzte Größe „Kapitalinteresse“ zu untersuchen. Er hält die These vom business as usual, das die Politik schon zur Räson bringen werde, für nicht angebracht. Denn „das“ nationale Kapitalinteresse gebe es nicht, sondern nur einzelne Kapitalisten mit ihren jeweiligen Interessenlagen, die sich gegenseitig behinderten, während der Staat der ideelle Gesamtkapitalist sei etc. Das wird aber nicht weiter verfolgt, statt dessen entdeckt der Autor in der These vom Laufburschen des Kapitalinteresses einen „unverkennbaren affirmativen Zug“: „Die abgeklärte Haltung wandelt sich unter der Hand zur frohen Botschaft: Furchtbarer, als es jetzt ist, kann es auch unter Trump und Konsorten nicht werden.“ (Ebd., 19)
Mit dem Rekurs auf die Haltung, die man einnehmen soll, ist das aufgeworfene theoretische Problem erledigt. Einerseits soll an der These vom Laufburschen und Hampelmann etwas dran sein: Ja, die Profitinteressen der Wirtschaft sind es, die den Gang der Dinge bestimmen und der Politik die Maßgaben präsentieren. Andererseits gehe die Politik nicht in dieser Bestimmung auf. Sie erweise sich dann doch, wenn man über die weitere Entwicklung spekuliert, als relativ selbständig, zumindest in einer Hinsicht: Sie kann – ein Hinweis auf den historischen Faschismus genügt – die schlimmen Verhältnisse noch schlimmer machen. Von der Politik im Kapitalismus ist also nichts Gutes zu erwarten, aber die ganze Aufmerksamkeit soll sich jetzt auf die Abstufungen im Schlimmen richten, sie werden zum entscheidenden Punkt: „Solange keine andere Alternative im Angebot ist als wieder einmal Armageddon, solange bleibt die winzige Differenz im Herrschaftspersonal zugleich die entscheidende: ob die Betreffenden wenigstens noch ein müdes Lippenbekenntnis zur zivilisatorischen Mission des Kapitals abgeben oder sich offen zur Barbarei bekennen.“ (Ebd.) Das ist schon eine Meisterleistung linken Opportunismus: Nicht nur wird die ganze Frage nach Inhalt und Grund der neuen amerikanischen Politik in das Problem der Begutachtung von Wahlalternativen überführt, sondern der Wähler, hier: der abgeklärte Linke mit Durchblick, soll sich schon damit zufrieden geben, dass ihm ein „Lippenbekenntnis“ von den Herrschenden geliefert wird, selbst wenn es bloß ein „müdes“ ist. Das heißt, mit einer Lüge, und zwar mit einer billig dahingesagten, soll man sich als Linker befriedigt sehen, damit die Hoffnung auf nicht ganz so schlimme Zeiten irgendwie Nahrung findet!
Den Gedanken kennt man im Grunde aus linken Debatten: Gewählt wird immer das kleinere Übel. Das Bedürfnis, Wählbarkeit im präsentierten Angebot zu finden oder zu erfinden, ist dabei leitend. Ob es nun in zynischer Offenheit ausgesprochen wird oder nicht – im Abwägen der Möglichkeiten der Herrschaft und der linken Wahloptionen erschöpft sich ein Großteil der sich kritisch verstehenden Analysen der aktuellen US-Präsidentschaft. Da sehen die einen in der Wahl Trumps „nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen: nämlich die Möglichkeit, eine neue ‚neue Linke‘ zu schaffen“ (Fraser 2017, 76), während die anderen in dieser Hoffnung eine „fatale Genugtuung von links“ (Kurz-Scherf 2017, 84) erkennen und für eine bewährte Bündnispolitik „in kultureller Vielfalt“ (ebd., 90) und ohne Rückkehr zu einem radikalen Antikapitalismus votieren. Das alles hat nicht mehr viel mit einem Blick auf das aktuelle Programm der Führungsmacht Amerika zu tun. Es ist bestenfalls – das aber ungewollt – eine Aufklärung darüber, was Wahlen sind. In ihnen treten Wahlkämpfer an, die den Menschen alles Mögliche versprechen, das aber alle Welt als Wahlversprechen kennt. Und wie man jetzt in erstaunlicher Offenheit erfährt: als bloßes Versprechen kennen soll. Wahlkampf ist das eine, Regieren das andere – diese Lektion sollte der moderne Staatsbürger, so die öffentliche Aufklärung, doch gelernt haben. Bis zu den jüngsten Entscheidungen in Sachen Klimapolitik wundern sich die Fachleute ja öffentlich darüber (vgl. den Kommentar in der FAZ, 3.6.2017), dass der US-Präsident tatsächlich das praktiziert, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Demgegenüber soll eine aufgeklärte staatsbürgerliche Haltung darin bestehen, dass man von den Wahloptionen nichts erwartet und mit einer Kalkulation von Möglichkeiten, die sich vom Inhalt der angebotenen Alternativen freimachen, selbstbewusst zur Wahlurne schreitet.
Literatur
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Ein Sieg des ‚Populismus‘ im Herzen der Demokratie: Donald Trump und sein Volk – zu ihrem Glück vereint. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2017a, S. 37-47.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Donald Trump und die Welt. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2017b, S. 48-78.
- Nancy Fraser, Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2017, S. 71-76.
- Hermann L. Gremliza, Der Lehrling. In: Konkret, Nr. 5, 2017, S. 9.
- Thomas Hecker, Faschistoide Züge – Die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist Ausdruck verschärfter Widersprüche. Die Bundesrepublik nutzt die Situation für ihre eigenen Bestrebungen zur Aufrüstung. In: Junge Welt, 24.4.2017, S. 12-13.
- Lars Quadfasel, Quo vadis, cui bono? Wie verhält sich das Interesse des US-Kapitals zur politischen Agenda Trumps? In: Konkret, Nr. 6, 2017, S. 18-19.
- Ingrid Kurz-Scherf, Marx contra Trump? Versuch einer feministischen Orientierung in gespenstischen Zeiten. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 5, 2017, S. 83-90.
Kollabierender Kapitalismus?
Künden die aktuellen Krisensymptome von der Apokalypse, die der Kapitalismus unaufhaltsam herbeiführt? Leben wir gar schon im Postkapitalismus? Solche Fragen werden zum Zehnjährigen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise aufgeworfen. Dazu ein Kommentar der IVA-Redaktion.
2017 feiert die große Finanz- und Wirtschaftskrise ihr zehnjähriges Jubiläum und Diagnosen aus der Linken bescheinigen der Krise zunehmend einen finalen Charakter. „Schon hat, was als Wirtschaftskrise begann, sich zu einer Gesellschaftskrise ausgewachsen“, stellt der englische Journalist Paul Mason fest (2016a, 47) und konstatiert gleichzeitig, wir seien bereits in die Ära des „Postkapitalismus“ eingetreten. Daher will er mit seinen – von vielen Medien aufgegriffenen – Einlassungen den Nachweis führen, „warum es kein utopischer Traum mehr ist, den Kapitalismus zu ersetzen, warum das gegenwärtige System bereits die Grundformen einer postkapitalistischen Wirtschaft enthält und wie diese Strukturen rasch weiterentwickelt werden könnten.“ (Mason 2016b, 12)
„Sind die aktuellen Krisensymptome die apokalyptischen Reiter, die das Ende des Kapitalismus ankündigen?“ fragen Joachim Bischoff und Klaus Steinitz in ihrem neuen Buch „Götterdämmerung des Kapitalismus?“ (Bischoff/Steinitz 2016, 7). Die Begründung klingt etwas trivial: „Der Kapitalismus hat vor Jahrhunderten im Niedergang des Feudalismus seinen Anfang genommen, es ist also nicht überraschend, wenn er auch ein Ende findet.“ (Ebd., 13) Ähnlich wie bei Mason heißt die Konsequenz jedenfalls: Alle Anstrengungen müssen sich jetzt auf ein Modell für den Übergang richten, der natürlich schrittweise zu gehen hat, denn die Verabschiedung des Kapitalismus, die eigentlich auf der Tagesordnung steht, ist der Menschheit noch fremd, daher nur über vorsichtige Reparaturmaßnahmen am bestehenden System zu erreichen. „Zunächst sollten wir die Globalisierung retten, indem wir den Neoliberalismus beseitigen. Anschließend retten wir den Planeten – und ersparen uns Wirren und Ungleichheit –, indem wir den Kapitalismus überwinden.“ (Mason 2016b, 11) Tja, first we take Manhatten, then we take Berlin – to change the system from within…
Ergibt sich ein solcher „finaler“ oder „letaler“ Krisencharakter auch aus den Erkenntnissen der marxistischen Theorie, also aus einer politökonomischen Analyse, die den (Über-)Akkumulationsprozess des Kapitals erklärt und sich nicht im Einsammeln düsterer Prognosen der marktwirtschaftlichen Akteure und der kulturkritischen Experten ihres Überbaus erschöpft? Elmar Altvater hat dies schon vor dem Ausbruch der Finanzkrise in einer Publikation bejaht (vgl. Altvater 2005), Freerk Huisken hat eine derartige Endzeitdiagnose bestritten (vgl. Huisken 2006, 2010). Natürlich ist es nicht zu leugnen, dass auch Jahre nach Ausbruch der amerikanischen „Hypothekenkrise“ immer noch und verschärft der „Weltkapitalismus im Krisenmodus“ läuft, wie die Vierteljahresschrift Gegenstandpunkt in einer ausführlichen Krisenanalyse Ende 2016 festhielt (vgl. Decker 2016). Bedeutet das aber ein Kollabieren des Kapitals, die „finale Krise der Weltwirtschaft“, die z.B. Tomasz Konicz in seinem Buch über den „Kapital-Kollaps“ (Konicz 2016) konstatiert?
Ende des fossilen Kapitalismus
Seit den Thesen des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ (Meadows u.a. 1972) existiert eine Tradition der Warnungen vor übertriebenem Wachstumsoptimismus und vor dem Setzen auf krisenfreie Geschäftsausdehnung. Altvater hatte solche Warnungen aufgenommen, wollte sich aber zugleich von den bekannten Endzeit- und Katastrophenszenarien abgrenzen, indem er sich mit Marx auf die politökonomischen Bewegungsgesetze bezog. Der Kapitalismus stoße an seine Grenzen, so seine zentrale These, da er die Endlichkeit des fossilen Energieträgers Öl ignoriere. Die „Grenzen der Natur stehen im Gegensatz zur unbegrenzten (selbst-referenziellen) Akkumulationsdynamik des globalen Kapitalismus…” (Altvater 2005, 14). Geradezu blind treibe daher das „fossile Energieregime” sich und die Menschheit ins Verderben – wenn nicht rechtzeitig der Umstieg auf einen neuen ökonomischen Weg erfolge, der mit der Nutzung erneuerbarer Energien im Grunde schon zur Verfügung stehe. Es zeichne sich ein neuer „Klassenkampf” ab, und zwar zwischen dem konservativen „fossilen Energieregime” und den Anhängern der „solidarischen Solargesellschaft”, die den Kapitalismus – „so wie wir ihn kennen” – durch eine „moralische Ökonomie“, basierend auf dem „erneuerbaren Energieregime”, ersetzen wollten (ebd.).
Die Haltbarkeit einer solchen politökonomischen Argumentation, die der doppeldeutigen Vision vom Ende der Kapitalherrschaft und vom Vorschein einer neuen Wirtschaftsweise zu Grunde liegt, hatte seinerzeit Huisken in Frage gestellt. Der zum Ende des Kapitalismus treibende Widerspruch zwischen der „Endlichkeit des fossilen Energieträgers Öl” – die gelegentlich auch mit den „Grenzen der Natur” oder gar mit der „Endlichkeit der Erde” gleichgesetzt werde – und der maßlosen Akkumulationsdynamik sei eher ein philosophisches Konstrukt als eine ökonomische Erklärung. „Man könnte z.B. darauf verweisen, dass die ‚Endlichkeit‘ nicht mit dem nahen ‚Ende‘, also der ‚Erschöpfung‘ von Öl-, Gas- oder Kohleressourcen zu verwechseln ist; dass diese Ressourcen selbst dann ‚endlich‘ sind, wenn sie irgendwann nicht mehr gebraucht werden, etwa wenn sie durch andere Energieträger ersetzt worden sind; und dass ihre ‚Endlichkeit‘ nichts über ihre Tauglichkeit als Ressource der ‚maßlosen Akkumulationsdynamik‘ kapitalistischer Betriebe aussagt. Die haben sich längst auch aller anderen ‚zukunftsträchtigen, erneuerbaren Energien‘ bemächtigt, leiden überhaupt nicht unter dem Einsatz neuer, energiesparender Technologien, machen manchmal sogar bessere Geschäfte mit ‚künstlich‘ verknappter Energiezufuhr – so dass ja mittlerweile die Vision eines ‚grünen Kapitalismus’ als Ausweg aus der weltweiten Krise gilt.“ (Huisken 2010, 225)
Huisken ging in seiner Kritik ausführlich darauf ein, wie der „grüne Kapitalismus“ als Wachstumssphäre von der Wirtschaft, aber auch von der Politik ausgemacht und in Beschlag genommen wird, also gar nicht als Gegenentwurf einer solidarischen bzw. moralischen Ökonomie dienen kann – eine Aufklärung, die heute, zehn Jahre und eine Krisenerfahrung später, vielleicht fürs Publikum nicht mehr so dringlich ist, da sie zumindest in linken Kreisen Allgemeingut zu sein scheint (siehe z.B. Paech 2017, der seine „Postwachstumsökonomik“ gerade im Gegensatz zum Konzept des „grünen Kapitalismus“ entwickelt). Wichtiger für die aktuellen Fragen sind dagegen Huiskens Überlegungen zur Konkurrenz der Kapitale, die bei Altvater als neuartiger, vom System nicht mehr verkraftbarer Gegensatz zwischen altem und neuem Energieregime vorstellig gemacht wird. Huisken weist darauf hin, dass es sich um gängige Konkurrenzpraktiken handelt. Das Deuten auf die Verschärfung des Wettstreits mache „den jeder Konkurrenz innewohnenden Gegensatz argumentlos zu einem Sprengsatz, der gar über Untergang oder Fortexistenz mindestens des Kapitalismus, wenn nicht gar ‚der Menschheit‘ entscheiden soll.“ (Huisken 2010, 226)
Entsubstantialisierung des Kapitals
Auch Konicz beginnt seine Analyse mit einem Verweis auf die einschlägige Tradition der Weltuntergangsprognosen. Er zitiert eine NASA-Studie (!) von 2014, die ermittelt habe, „dass die ‚industrielle Zivilisation‘ auf einen ‚irreversiblen Kollaps‘ zusteuere, der in den kommenden Dekaden unausweichlich eintreten werde, sollten der Raubbau an den natürlichen Ressourcen und die zunehmend ungleiche Vermögensverteilung nicht überwunden werden“ (Konicz 2016, 7). Und er fügt dem hinzu: „Wer wollte dieser Erkenntnis widersprechen?“ (Ebd.) Konicz jedenfalls nicht, er will mit seinem Buch „aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen der Wertkritik … möglichst allgemeinverständlich die Ursachen der gegenwärtigen Krise und ihres Verlaufs erläutern. Die zentrale These des Buches ist, dass der Kapitalismus an seinen Widersprüchen zugrunde gehen wird und damit die menschliche Zivilisation mit in den Abgrund zu reißen droht.“ (Ebd., 8)
Die Publikation von Konicz stammt aus der „wertkritischen“ Richtung, die vor allem mit dem Namen Robert Kurz („Schwarzbuch Kapitalismus“, 1999) verbunden ist. Sie knüpft, wie der Titel bereits andeutet, an Debatten an, die unter dem Titel „Zusammenbruchstheorie“ eine marxistische Traditionslinie darstellen. Zentral für die politökonomische Argumentation sind bei Konicz das 4. und 5. Kapitel über die „innere“ und „äußere Schranke des Kapitals“. Sie gehen auf die Ableitung der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten in den drei Bänden des „Kapital“ ein und beziehen sich auf das berühmte „Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate“, das Marx im dritten Band (MEW 25, 221ff) formulierte. Das Gesetz, das eine Tendenz benennt, die aber zugleich auf „entgegenwirkenden Ursachen“ stößt, besagt im Prinzip Folgendes: Das Kapital, dessen Verwertung von der Anwendung eingekaufter Arbeitskraft lebt, also nie genug von ihr bekommen kann, minimiert zugleich deren Rolle als Produktionsfaktor im Rahmen der konkurrenzbedingten Produktivkraftsteigerung und beschneidet somit – als Tendenz – die Profiterwirtschaftung. Der hier zu Grunde liegende Widerspruch zwischen intendierter Steigerung der Rendite beim eingesetzten Kapital und der Verringerung des Mehrwerts, der die Substanz der Rendite bildet, hat schon zu einigen theoretischen Kontroversen geführt. Die Konsequenz, dass die Wachstumsraten allgemein sinken oder, wie Unternehmer klagen, die Investition in einen Arbeitsplatz immer teurer wird, ist dabei nicht strittig. Und auch die Volkswirtschaftslehre kennt das Problem als Trend zur „steigenden Kapitalintensität der Produktion“ (Konicz 2016, 111). Die Fassung des systemimmanenten Widerspruchs, wie Konicz sie liefert, geht darüber aber hinaus; er spricht von einer „Entsubstantialisierung des Kapitals“ (ebd.).
Ein Weiteres kommt hinzu: Bei diesem ökonomischen Sachverhalt nimmt Konicz‘ Krisendiagnose nur ihren Ausgangspunkt, um dann im Blick auf die Umwelt das „Kapital als Weltvernichtungsmaschine“ (ebd., 129) zu identifizieren oder die Unfähigkeit keynesianischer bzw. neoliberaler Wirtschaftspolitik zur Lösung der zu Grunde liegenden Widersprüche aufzuzeigen. Und der Befund wird so verallgemeinert, dass dem Leser ein geradezu universelles Endzeitszenario unterbreitet wird. Das sieht vielerlei, z.B. die Kulturindustrie, die bei Adorno und Horkheimer selber schon als spätkapitalistisches Zerfallsprodukt der ehemaligen Hochkultur figurierte, „in der Krise“ (ebd., 153). „Es ist, wie es ist“, sei die klassische kulturindustrielle Losung, „der in die Massenmedien eingewobene Subtext“, gewesen, formuliert Konicz im Anschluss an die Kritische Theorie (ebd., 154). Doch jetzt, in der finalen Krise, erscheine dieses Prinzip der Affirmation geradezu als Ausdruck einer guten alten Zeit – etwa im Sinne des Goethe-Worts: „Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.“ Die Signatur des neuesten Zerfalls findet Konicz dagegen – ausgerechnet – in einer der erfreulichsten, fantasievollsten Innovationen des digitalen Kapitalismus: „Das Computerspiel als avanciertestes kulturindustrielles Produkt geht aber weiter. Das resignative ‚Es ist, wie es ist‘ wandelt sich dort in ein begeistertes ‚Es ist geil, wie es ist‘… Das entscheidende Moment ist hier die Aktivität des Spielers, die in schroffem Gegensatz zur Passivität der Konsumenten der klassischen kulturindustriellen Produkte steht.“ (Ebd., 154f) Hier wird deutlich: Mit diesem Untergangsszenario gerät man in tiefe kulturpessimistische Gewässer. Sicher sein kann man sich dabei einer zweifelhaften Unterstützung, nämlich der des Feuilletons, das – nicht erst seit Spenglers „Untergang des Abendlandes“ – mit Vorliebe Niedergangs- und Verfallserscheinungen dramatisiert.
Konicz‘ These von der „Entsubstantialisierung des Kapitals“ (ebd., 111) ist von Kurz übernommen. Bei dem heißt es z.B.: „Seit den 80er Jahren brachte die dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik eine neue Qualität der Rationalisierung hervor, von der menschliche Arbeitskraft in einem bisher nie da gewesenen Ausmaß entwertet wird. Die reale ‚Substanz‘ der Verwertung von Kapital schmilzt ab, und neue Industrien mit der Potenz eines selbsttragenden Wachstums sind ausgeblieben.“ (Kurz 2013, 51) Georg Schuster hat im Auswege-Magazin in drei Beiträgen (2017a-c) die Thesen der finalen Krise und des Anbruchs eines Postkapitalismus auf den Prüfstand gestellt. Was er zu Kurz bemerkt, trifft dabei genau das Problem solcher Endzeittheorien, die sich auf die Marxschen Erkenntnisse zum Fall der Profitrate und zur systemimmanenten Krisentendenz stützen (vgl. Schuster 2017a, 6f; 2017b, 9ff). Schuster diskutiert auch ausführlich die Thesen vom allmählichen Hinüberwachsen in eine neue, postkapitalistische Ökonomie, das heutzutage durch die Informations- und Kommunikationstechnologie – die noch bei Altvater bemühten erneuerbaren Energie haben als Hoffnungsträger weitgehend ausgedient – auf den Weg gebracht werden soll.
Das Gesetz vom tendenziellen Fall, das in den neueren Marx-Würdigungen teilweise als großartige, für die Wirtschaftspolitik relevante Entdeckung eingestuft wird (vgl. Sinn 2017, 25f), hält, wie erwähnt, fest, dass die industriellen Umwälzungen, die Rationalisierungen und Produktivitätssteigerungen, die Produktion so gestalten, dass die Ausbeutung auf Basis von immer weniger wertschaffender Arbeit stattfindet – eine Tendenz, die Kurz dem Kapitalismus korrekter Weise auf jeder Entwicklungsstufe attestiert. Solange ihr historisch die Expansion der Ausbeutung auf neue Produktionszweige und Märkte entgegenwirke, komme der Kapitalismus über diesen Punkt hinweg. Final und tödlich verlaufe der Widerspruch jedoch gegenwärtig, da solche Geschäftsfelder nicht zur Verfügung stünden. Die digitale Revolution eröffne zwar neue Möglichkeiten der Beschäftigung. Ihr Siegeszug durch alle Produktionszweige hindurch eliminiere aber mehr Arbeitskraft als sie neu rekrutiere und verhindere damit gleichzeitig jede Umkehr zu soliden Wachstumsbedingungen. Kurz meint also zeigen zu können – und Konicz folgt ihm in dieser Argumentation –, dass der Kapitalismus historisch am Ende seiner Widersprüche angekommen ist, die Marx begrifflich analysiert hat.
In seinen Beiträgen im Auswege-Magazin hat Schuster die neueren Endzeitvisionen sortiert und das Entscheidende dazu gesagt. Dazu gehört an erster Stelle, dass Marx mit den politökonomischen Bestimmungen keine Prognose zum weiteren Wirtschaftsgeschehen geliefert hat und auch nicht liefern wollte. Marx ging es um die Argumente, die gegen das System sprechen und die er den Arbeitern nahe bringen sowie dem Bürgertum als „Wurfgeschoss“ an den Kopf schleudern wollte. Daraus ein Haltbarkeitsdatum des Kapitalismus abzuleiten, ist ein unhaltbares Unterfangen – nicht nur, weil Marx, wie bemerkt, zum tendenziellen Fall gleich die entgegen wirkenden Ursachen benannte, sondern auch wegen der politischen Betreuung der Konkurrenz, die durch die ökonomische Gesetzmäßigkeit, mittlerweile bis in den letzten Erdenwinkel hinein, entfacht und zugespitzt wird. Schuster erinnert die Wertkritiker daran, dass – wie gegenwärtig gerade „Brexit“ oder „America first“ zeigen – „politische Konsequenzen aus ökonomischen Mängelanzeigen gezogen werden.“ (Schuster 2017a, 7) Der Kapitalismus unterliegt eben der „Kontrolle von Regierungen und Supermächten“, die ins Getriebe eingreifen und den Verlauf entscheidend modifizieren, während die politischen Mächte bei den Vertretern des Postkapitalismus als hilflose Zuschauer erscheinen (vgl. Mason 2016b, 14).
Bei Kurz oder Konicz bezieht sich das Endzeitszenario noch auf Widersprüche, die aus den politökonomischen Gesetzen resultieren, und es zielt auch auf die Notwendigkeit, einen Bruch mit der kapitalistischen Rechnungsweise zu vollziehen. Bei neueren Konzepten – so bei der „Postwachtsumsökonomik, wie sie Niko Paech vertritt – gerät dies ganz aus dem Blick. Zwar schließt Paech an die Marxsche Kritik des Kapitalismus an (bzw. an das, was er dafür hält), entdeckt dann aber in deren sozialistischer Konsequenz, die Produktivkräfte für die Bedürfnisse der Produzenten einzusetzen, denselben Wachstumsimperativ, der die Natur überfordere. So avancieren bei ihm die Konsumenten zur neuen herrschenden Klasse, deren Zwecksetzung des „Immer mehr!“ erst durch eine Umwälzung der modernen „Konsumgesellschaft“ aus der Welt geschaffen werden müsste. „Wird diese Prämisse [= der Wachstumsimperativ] verworfen und der empirische Befund berücksichtigt, dass die Mehrheit der in modernen Konsumgesellschaften lebenden Individuen materiell über ihre Verhältnisse lebt, bleibt als logische Konsequenz nur die Reduktion ökonomischer Ansprüche.“ (Paech 2017, 44)
Erstaunliche Weise soll diese Konsequenz aber keine politische Qualität haben, sondern nur den Lebensstil der Einzelnen betreffen. Gegen Planwirtschaft spricht sich Paech kategorisch aus. Sein Konzept einer Postwachstumsökonomik will die Rechnungsweisen der Marktwirtschaft mit den Größen Lohn, Preis, Gewinn, Kredit etc. in Kraft lassen, auch nicht groß „von oben“ umsteuern. Es berücksichtigt, „dass kollektive Institutionen – zumindest unter demokratischen Bedingungen – prinzipiell nicht befähigt sind, die überlebenswichtig gewordene Selbstbegrenzung durchzusetzen. Statt schicksalsergeben auf einen politisch oder revolutionär herbeigeführten Systemwandel zu warten,“ will die Postwachstumsökonomik begründen, warum die genannte Reduktion der Ansprüche „zunächst autonom und dezentral zu entwickelnde postwachstumstaugliche Lebensführungen und Unternehmensmodelle voraussetzt, die als – materielle und damit bewährte – Blaupausen für ein Leben ohne Wachstum tauglich sind.“ (Ebd. 46) Wirklich ein interessantes Angebot: Man kann sich von der Endzeitvision im höchsten, nämlich universellen Maße gruseln und gleichzeitig beruhigen lassen, da letztlich – wenn sich jeder konsummäßig am Riemen reißt – nichts geändert werden braucht, wir vielmehr schrittweise in eine Wirtschaftsweise hineinwachsen, die endlich die Naturgesetze respektiert statt dauernd gegen sie zu verstoßen.
Literatur
- Elmar Altvater, Das Ende des Kapitalismus – wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik. Münster 2005 (liegt mittlerweile in 7. Auflage 2011 vor).
- Joachim Bischoff/Klaus Steinitz, Götterdämmerung des Kapitalismus? Hamburg 2016.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Im Jahr 9 nach Amerikas „Hypothekenkrise“ – Weltkapitalismus im Krisenmodus. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2016, S. 71-107.
- Dennis Meadows u.a., Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart 1972.
- Freerk Huisken, Wieder ein Menschheitsretter (Rez. zu Altvater 2005). Mai 2006. Online: http://www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Freerk Huisken, Endzeitkapitalismus? (Rez. zu Altvater, 6. Aufl. 2009). In: Praxis Politische Bildung, Nr. 3, 2010, S. 225-227.
- Tomasz Konicz, Kapitalkollaps – Die finale Krise der Weltwirtschaft. Hamburg 2016.
- Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus - Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Frankfurt/M. 1999.
- Robert Kurz, Der Tod des Kapitalismus. Hamburg 2013.
- Paul Mason, Nach dem Kapitalismus?! Democracy Lecture 2016. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 5, 2016a, S. 45-59.
- Paul Mason, Postkapitalismus – Grundrisse einer kommenden Ökonomie. Berlin 2016b.
- Niko Paech, Postwachstumsökonomik – Wachstumskritische Alternativen zu Karl Marx. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 41-46.
- Georg Schuster, Bücher für die Flughafenbuchhandlung? Und weitere Fragen: „Postkapitalismus“, „Ende des Eigentums“ und „kollaboratives Gemeingut“ (Teil 1). In: Auswege-Magazin (www.magazin-auswege.de), April 2017a, mittlerweile mit Teil 2 und 3 (s.u.) als Beitrag zusammengefasst unter: http://www.magazin-auswege.de/2017/05/von-wegen-postkapitalismus/.
- Georg Schuster, Von wegen: „Postkapitalismus“ (Teil 2). In: Auswege, April 2017b.
- Georg Schuster, Von wegen: „Postkapitalismus“ (Teil 3). In: Auswege, Mai 2017c.
- Hans-Werner Sinn, Was uns Marx heute noch zu sagen hat. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19-20, 2017, S. 23-28.
Religiöser Antikapitalismus
Religiöse Autoritäten wie Martin Luther oder Papst Franziskus gelten heutzutage – was bereits in zwei IVA-Texten 2016 Thema war – als Kronzeugen der Kapitalismuskritik. Dazu ein weiterer Beitrag der IVA-Redaktion.
„Der Kapitalismus sonnt sich nach dem Ende des Sowjetkommunismus als Sieger in allen vergangenen und zukünftigen Ideologie-Streiten. Und dann schreibt Papst Franziskus eine neue Enzyklika…“, woraufhin „die Welt“ aufhorcht und die Schönfärberei der herrschenden Wirtschaftsweise einen Dämpfer erhält (George 2017, 9). Das behauptet Ernst-Ulrich von Weizsäcker im Geleitwort eines Sammelbandes, der als Reaktion der Wissenschaftlergemeinde auf die Umweltenzyklika „Laudato Si‘“ entstanden ist, und bekräftigt so noch einmal die dem Papst von verschiedenen Seiten zugeschriebene Rolle des konsequentesten Kapitalismuskritikers der Gegenwart. Dass dies – gelinde gesagt – eine Übertreibung ist, war schon in der Auseinandersetzung mit dem Franziskus-Buch „Diese Wirtschaft tötet“ von Franz Segbers und Simon Wiesgickl Thema (siehe den IVA-Blogeintrag „Oh Gott, katholische Kapitalismuskritik“, 2016). Zu einer theoretisch begründeten Absage an den Kapitalismus, etwa zur Kritik der politischen Ökonomie und zum wissenschaftlichen Sozialismus, hält Franziskus jedenfalls deutliche Distanz, und dem letztjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos ließ er folgendes Lob der Marktwirtschaft zukommen: „Ich habe oft gesagt und wiederhole es jetzt gerne, dass die Unternehmertätigkeit 'eine edle Berufung darstellt und darauf ausgerichtet ist, Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle zu verbessern', besonders 'wenn sie versteht, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen ein unausweichlicher Teil ihres Dienstes am Gemeinwohl ist' (Laudato si’, 129).“ (Radio Vatikan 2016)
Da 2017 Luther-Jahr ist, gibt es analoge Bestrebungen, Martin Luther für eine Verurteilung der globalisierten Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts in Anspruch zu nehmen. Theologieprofessor Ulrich Duchrow hat zum evangelischen Kirchentag 2017 den Band „Mit Luther, Marx & Papst den Kapitalismus überwinden“ angekündigt. Dem Autor zufolge muss die kapitalistische Zivilisation, deren Vorformen vor fast 3000 Jahren begonnen haben sollen, so schnell wie möglich überwunden werden. Denn – siehe das Papst-Wort „Diese Wirtschaft tötet“ – sie zerstöre das Leben und – siehe „Laudato si’“ – die natürlichen Lebensgrundlagen. Nötig seien jetzt kritisch-konstruktive Gegenkräfte und -konzeptionen. Anstöße dazu ließen sich vor allem seit 500 Jahren in der direkten Auseinandersetzung mit den Etappen des sich durchsetzenden Kapitalismus finden. Martin Luther gilt Duchrow dafür als Gewährsmann, die Veröffentlichung des „Kapital“ 1867 als ein weiterer wichtiger Schritt. Und seit Ende des 20. Jahrhunderts soll die christliche Ökumene, also das Konglomerat der sich auf Jesus berufenden Konfessionen und Sekten, konsequent auf einem Weg sein, der an der Überwindung des Kapitalismus arbeitet. Die Bemühungen hätten 2013 ihren vorläufigen Höhepunkt mit den Dokumenten des Ökumenischen Rats der Kirchen erreicht (Auszüge sind abgedruckt in: Segbers/Wiesgickl 2015). Sie rückten die „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ ins Zentrum, und der Apostolische Brief „Evangelii gaudium“ des Bergoglio-Papstes habe dies als ökumenischen – ja interreligiösen – Konsens bestätigt.
Verdrängte Kapitalismuskritik?
Die gegenwärtigen Jubiläumsveranstaltungen zu Luther und Marx sieht Duchrow kritisch. Es würden zwar allerlei Dinge in Erinnerung gerufen, aber letztlich „beide – der kapitalismuskritische Luther und der von Deutschland ins Exil getriebene Entzauberer des allmächtigen Kapitals – hartnäckig verdrängt, wenn nicht tabuisiert.“ (Duchrow 2017, 10) Dem kann man zustimmen. Der Mainstream der Rückblicke, speziell die Marx-Renaissance, ist nicht darauf angelegt, über die heute als einzig vernünftig anerkannte marktwirtschaftliche Ordnung Kritisches zu verbreiten. Duchrow fährt fort: „Aber einer, Papst Franziskus, nennt zwar die Namen nicht, spricht und handelt aber exakt im Sinn der Tabuisierten – weil er nicht nur nachhaltig für die unsichtbar gemachten Menschen (und die Schöpfung) eintritt, sondern auch tiefgründig in seinen Schreiben und Enzykliken die kapitalistischen Ursachen der Katastrophen des herrschenden Systems analysiert und darüber aufklärt. So ermutigt er uns, neu auf Luther und Marx zu schauen, um vielleicht die Legitimationskrise des Kapitalismus zu verschärfen und Perspektiven für eine neue Kultur zu entdecken, in der zukünftiges Leben in Würde eine Chance hat.“ (Ebd.) Damit wird eine Reihe von Fragen aufgeworfen:
- Welche Kritik am (Früh-)Kapitalismus hat Luther seinerzeit vertreten und unters Volk gebracht? Ist er wirklich „für die Menschen“ eingetreten?
- Wie steht es mit der Nähe von Luther und Marx, und welche Kritik des Kapitalismus hat der Letztere auf den Weg gebracht? Ist tatsächlich „Marx als Theologe“ (Duchrow 2017, 102) zu würdigen?
- Wie ist die Wirtschaftskritik des Bergoglio-Papstes beschaffen? Analysiert er, wie behauptet, „tiefgründig die kapitalistischen Ursachen der Katastrophen des herrschenden Systems“? Existiert eine „Legitimationskrise“ des Kapitalismus und kann man sie unter Berufung auf den Vatikan verschärfen?
Zur Beantwortung dieser Fragen sollen im Folgenden einige Hinweise gegeben werden, den alten und jetzt wieder neu in Erscheinung tretenden religiösen Antikapitalismus betreffend. Bei Bedarf wird die Debatte fortgesetzt.
Von Luther zu Marx
Dass Luther im 16. Jahrhundert kritische Worte über den sich durchsetzenden Kapitalismus verlor, ist nicht zu bestreiten Auch Marx hat das im „Kapital“ vermerkt. Dem im Einzelnen nachzugehen, wäre ein historisches Kapitel. Duchrow betont selber, dass diese Traditionslinie heute keine Rolle mehr spiele, da sie „hartnäckig verdrängt“ worden sei. Dass der gegenwärtig amtierende Papst als Wirtschaftskritiker auftritt, ist auch nicht zu bestreiten. Freerk Huisken hat dies in seiner Gegenrede Nr. 33, die in linken kirchlichen Kreisen auf Widerspruch stieß, ausdrücklich bestätigt (Huisken 2014). Es stellt sich nur die Frage, wie diese Wirtschaftskritik begründet wird und worauf sie zielt. Dass Marx – wie Duchrow betont – Luther als einen Vorläufer der modernen politischen Ökonomie betrachtete, stimmt ebenfalls. In den „Grundrissen“ (Marx o.J., 891) heißt es, Luther sei „der älteste deutsche Nationalökonom“. Dass das eine Wertschätzung oder eine Nähe der beiden Denker zum Ausdruck bringen soll, ist allerdings mehr als zweifelhaft.
Es wird nämlich unterschlagen, dass Marx den Reformator keineswegs als Wegbereiter einer materialistischen Kritik sah, sondern sich mit deutlichen Worten gegen dessen Verdienste wandte. In seinen Bemerkungen zur Religionskritik, in der Einleitung „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, konstatierte Marx, Deutschland sei nicht auf der Höhe der Zeit – d.h. der politischen und ökonomischen Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft, wie sie sich in Frankreich und England vollzogen hatte. Deutschlands „revolutionäre Vergangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die Reformation“ (MEW 1, 385), hält Marx fest und fährt fort: „Luther hat … die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat.“ (Ebd., 386) Und das Resümee lautete: „Damals scheiterte der Bauernkrieg, die radikalste Tatsache der deutschen Geschichte, an der Theologie“ (ebd., 386), nämlich an Luther, der sich im Unterschied zu Thomas Münzer, gegen die Sache der aufständischen Bauern stellte und die Fürsten zur blutigsten Repression aufrief. Man muss Ernst Blochs Idealisierung Münzers als erster deutscher Kommunist nicht teilen – „Münzer erscheint von hier ab“, nach seinem Bruch mit Luther 1523, „wesentlich als klassenbewusster, revolutionärer, chiliastischer Kommunist“ (Bloch 1975, 25) –, aber seine Charakterisierung Luthers als jämmerlicher Opportunist und Verräter der Bauern (ebd., 36f) überzeugt eher als Duchrows Loblied.
Das Urteil Blochs über Luther steht übrigens in der Tradition der Arbeiterbewegung. Der junge Friedrich Engels bemerkte, Luthers Pamphlet gegen die Aufständischen sei „mit solcher Gehässigkeit, ja mit einer solchen fanatischen Wut gegen das Volk geschrieben, daß es für immer ein Makel auf Luthers Charakterbild sein wird; es zeigt, daß er, der seine Laufbahn als Mann des Volkes begonnen hatte, nun ganz im Dienste seiner Unterdrücker stand“ (MEW 1, 489). Engels hielt zudem fest, dass Münzers Aufruf zum Aufstand „natürlich voll des religiösen und abergläubischen Unsinns seiner Zeit war“ (ebd.). Gleichwohl wies Engels auf die Pionierrolle des revolutionären Predigers und Luther-Antagonisten für die „Sozialreform“ hin, die in Deutschland mit den Bauernkriegen begonnen und bis zum Frühsozialisten Wilhelm Weitling dann eine Jahrhunderte lange Pause eingelegt habe. Münzer habe eine Kritik des Privateigentums und das Ziel einer „Eigentumsgemeinschaft“ formuliert – lauter Lehren, die nichts anderes waren „als logische Schlüsse aus der Bibel und aus Luthers eigenen Schriften“ (ebd.). Marx zitiert in seinem Aufsatz „Zur Judenfrage“ ebenfalls zustimmend Münzers Kritik am Privateigentum – bezeichnender Weise nach der Schrift, die gegen Luther gerichtet war (MEW 1, 375).
Diese Aussagen mögen deutlich machen, dass von einer innigen, geistigen Verbindung zwischen Luther und Marx nicht die Rede sein kann. Es stimmt natürlich, dass Luther Kritik am Frühkapitalismus geübt hat – wie die katholische Kirche oder der Islam auch. „Wie soll das immer mögen göttlich und recht zugehen, daß ein Mann in so kurzer Zeit reich werde, daß er Könige und Kaiser auskaufen möchte?“, schrieb Luther in seiner Streitschrift „Von Kaufhandlung und Wucher“ (1524) und fuhr fort: „Könige und Fürsten sollten hier dreinsehen und nach gestrengem Recht solches wehren. Aber ich höre, sie haben Kopf und Teil daran, und es geht nach dem Spruch Jesaiä 1,23: ‚Deine Fürsten sind der Diebe Gesellen geworden‘. Dieweil lassen sie die Diebe hängen, die einen Gulden oder einen halben gestohlen haben, und hantieren mit denen, die alle Welt berauben und stehlen mehr denn alle anderen, daß ja das Sprichwort wahr bleibt: Große Diebe hängen die kleinen Diebe.“ (Luthers Werke, zitiert nach: http://diepaideia.blogspot.de/2012/07/martin-luther-und-die.html) Marx hat solche Aussagen im „Kapital“ zitiert, zugleich aber deren historisch-moralischen Charakter herausgestellt, der sie von seiner Kritik der politischen Ökonomie unterscheidet. Von daher lässt sich die Behauptung nicht halten, Marx habe „in Luther und seiner ‚naiven Polterei‘ gegen das wucherische Zinsnehmen einen Vorläufer und Verbündeten“ gesehen (Lotter 2017).
Die Kirche als Teil des Feudalsystem stand in Opposition zur Geldwirtschaft; im christlichen Mittelalter galt das Zinsverbot, die Ächtung des „Wuchers“. Auch Luther nahm diesen Standpunkt ein, er akzeptierte, wie Marx im „Kapital“ festhält (MEW 23, 149), das Geld als Kauf-, aber nicht als Zahlungsmittel. Zinsen zu nehmen war für ihn und seine klerikalen Zeitgenossen unsittlich; dass Werte aus sich heraus einen Wertzuwachs schaffen, modern gesprochen: dass Geld arbeitet, galt als Verstoß gegen die gottgewollte Ordnung, die den Geldeigentümern solche weit reichenden Aneignungsrechte verwehrte. Wobei anzumerken ist, dass sich diese ethische Position durchaus mit der Verfügung über Sklaven oder Leibeigene und der Aneignung ihrer Arbeitsleistung vertrug, dass diese Wirtschaftsethik also nicht in einer Äquivalenz-Vorstellung begründet war, sondern gleichzeitig die gottgewollte Verfügung der Herrschaft über das gesellschaftliche Mehrprodukt absegnete. Die sich entfaltenden Geldwirtschaft wurde durch diese ethische Norm auch nicht behindert – was schon allein dadurch gewährleistet war, dass Luther sein Zinsverbot nicht absolut verstand, sondern mit allerlei Ausnahmen versah (vgl. Lotter 2017). Von der scholastischen Sittenlehre des Hochmittelalters bis zur Entstehung der modernen katholischen Soziallehre im 19. Jahrhundert fand dann ein „Prozess der christlichen Akkommodation an den aufkommenden Kapitalismus“ (Fleischmann 2010, 203) statt.
Die kirchliche Lehre machte im Lauf der Jahrhunderte explizit ihren Frieden mit wirtschaftlichen Verhältnissen, die den ursprünglichen religiösen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit zuwider liefen. 1830 wurde auf katholischer Seite die Verurteilung der Zinseinkünfte sang- und klanglos aus dem Verkehr gezogen, nachdem noch 1745 Papst Benedikt XIV. in seiner Enzyklika „Vix pervenit“ das totale Zinsverbot bekräftigt hatte. Damit wurde auch der Grundstein dafür gelegt, dass sich die katholische Soziallehre ab dem Ende des 19. Jahrhundert, ab der Sozialenzyklika „Rerum novarum“ von 1891, zur ideologischen Stütze von Marktwirtschaft & Privateigentum aufschwang und im Kampf gegen die entstehende Arbeiterbewegung ihr Hauptbetätigungsfeld fand – eine Entwicklung, die durchaus ihre Konjunkturen kannte, mit der Apotheose des Marktes in Ratzingers Enzyklika „Caritas in veritate“ (2009) ihren Höhepunkt fand und seit der neuesten großen Krise mit Papst Franziskus wieder eine andere Wendung erhält.
Christoph Fleischmann hat in seinem historischen Abriss zur religiös-moralischen Begleitung des Prozesses, der zur Durchsetzung des Kapitalismus im christlichen Abendland führte, die Anpassung der Kirchen nachgezeichnet (vgl. Fleischmann 2010). In seinem Rückblick auf die Reformation „Gottes Güter für alle“ (Fleischmann 2017) spricht er jetzt ebenfalls von einer „verdrängten Lehre der Reformation“. Damit ist aber nicht wie bei Duchrow, der sich auf Fleischmann beruft, die moderne Verdrängung eines antikapitalistischen Luther gemeint, sondern die zwiespältige Haltung des Reformators selbst. Der habe im Kampf gegen die römisch-päpstlich organisierte Kirche die Gläubigen zwar von der Macht einer Anstalt emanzipiert, die sich als Besitzer und Verwalter der Gnadengüter aufführte, aber die irdische Konsequenz daraus dann doch nicht gezogen; vielmehr habe er seine eigene Einsicht verdrängt: „Die naheliegende ökonomische Konsequenz aus Luthers Ablasskritik wäre – und ist bis heute – ja die Frage, wer mit welchen Gründen auf die materiellen Ressourcen ein Preisschild kleben darf? Wenn Gottes Güte allen Menschen umsonst zugänglich ist, warum dann nicht auch Gottes Güter – zumindest soweit sie lebensnotwendige Güter betreffen?“ (Ebd., 49)
Die Antwort weiß übrigens auch Fleischmann: Luther bekräftigte wegen der menschlichen Sündennatur die absolute Notwendigkeit der Herrschenden, die Untertanen in ihre Schranken zu weisen und natürlich im Notfall – siehe das Vorgehen gegen die aufständischen Bauern – brutal zu knechten oder zu strafen. Dass hier ein Widerspruch vorliegen soll, kann man einem religiösen Weltbild schwerlich vorwerfen. Es hat seine eigenen Logik, die nicht von den Bedürfnissen der Menschen ausgeht, sondern davon, dass Gottes Wille geschehe. Wenn „Gottes Güte“ allen zugänglich wird, dann ist das eben kein Beginn einer Emanzipation, die nur noch auf die gesellschaftliche Ebene, auf die irdischen Güter, ausgedehnt werden müsste. Es ist vielmehr – siehe die Marxsche Formuliereung von der Verwandlung der Laien in Pfaffen – die Verallgemeinerung und Zuspitzung des religiösen Untertanenstandpunkts. Der Mensch ist der Sünder, der der göttlichen Gnade bedarf. Dass er damit ein Recht hätte, etwas in Anspruch zu nehmen, muss einer frommen Gesinnung als abwegig erscheinen. Insofern ist es nur konsequent, dass sich die evangelische Kirche seit 500 Jahren an diese Linie gehalten hat, also Luther und nicht Münzer gefolgt ist.
Und heute?
Verunsichert sind die Kirchen heute angesichts der politischen und ökonomischen Entwicklung des Weltkapitalismus in der Tat. Was katholischer- oder evangelischerseits aus Bischofskonferenz oder EKD etwa zum neuen Rechtstrend in Deutschland verlautet, klingt wie eine Korrektur früherer Fehler. Dass sich etwa die katholische Kirche wieder – wie im 20. Jahrhundert mit ihren beiden großen Päpsten Pius XI. und Pius XII. – als Wegbereiter und Stabilisator des Faschismus erweisen wird (vgl. Schillo 2017), scheint ausgeschlossen. Und was die Ökonomie betrifft, ist die glasklare Position des Antisozialismus und der Heiligsprechung des Privateigentums schon länger zurückgenommen. Kardinal Reinhard Marx, der fürs Soziale zuständige Mann der katholischen Bischofskonferenz, wandte sich bereits 2008, nach dem Ausbruch der großen Finanzkrise, in einem posthumen Brief an den „lieben Namensvetter“ Karl. Darin schwankte er – in aller christlichen Demut – zwischen dem Triumph über die unhaltbaren Prognosen seines toten Kontrahenten, der jetzt im Jenseits eines Besseren belehrt werde, und dem nagenden Zweifel, ob an der verrufenen, materialistischen und (wie man heute immer wieder hört) „hellsichtigen“ Theorie nicht doch etwas dran sein könnte. In dem Brief hieß es:
„Ich schreibe Ihnen, weil mir in letzter Zeit die Frage keine Ruhe lässt, ob es am Ende des 20. Jahrhunderts, als der ‚kapitalistische Westen‘ im Kampf der Systeme den Sieg über den ‚kommunistischen Osten‘ errungen hatte, nicht doch zu früh war, endgültig den Stab über Sie und Ihre ökonomischen Theorien zu brechen. Es sah zwar in der Tat in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ganz so aus, als ob Sie sich geirrt hätten. Die durch das Tarifsystem, die Arbeitnehmermitbestimmung und das ganze Sozial- und Arbeitsrecht zu einer Erwerbsbürgergesellschaft gewandelte kapitalistische Industriegesellschaft hatte die Arbeiter von ausgebeuteten Opfern des marktwirtschaftlichen Systems zu Teilhabern an dessen Erfolgen gemacht. Wohlstand für alle schien möglich. Unter diesen Verhältnissen hatte sich, um Habermas zu zitieren, ‚der designierte Träger einer künftigen sozialistischen Revolution, das Proletariat, als Proletariat aufgelöst‘ (1971). Inzwischen werden wir aber darüber belehrt, dass diese integrierte Erwerbsbürgergesellschaft des 20. Jahrhunderts der historische Ausnahmefall gewesen sei, von dem wir Abschied nehmen müssten. Und das sagen uns nicht etwa die Ihnen und Ihren Theorien verbliebenen Anhänger, sondern das sagen uns manche Wirtschaftsexperten und Politiker. Deren Botschaft lautet: Die heimeligen Zeiten des nationalen Wohlfahrtsstaates sind angesichts der wirtschaftlichen Globalisierung zu Ende und kommen auch niemals wieder.“ (Marx 2008, 16)
In dem Brief heißt es weiter: „Sie, Herr Marx, haben vorhergesagt, dass die Menschen sich das, was ihnen verweigert wird, irgendwann nehmen werden. Noch ist es freilich nicht so weit; die von Ihnen prophezeite Revolution des Proletariats lässt weiter auf sich warten. Aber der Kapitalismus steht in unseren Tagen erkennbar unter Rechtfertigungsdruck, vielleicht so sehr unter Rechtfertigungsdruck wie in den letzten hundert Jahren nicht mehr.“(Ebd., 26) Ist das Antikapitalismus, wurzelnd in der kirchlichen Tradition? Der zuständige Kardinal tut jedenfalls alles, um dieses Missverständnis zu zerstreuen. Er setzt sich entschieden dafür ein, den Rechtfertigungsdruck herunterzufahren: „Der sozialreformerische Ansatz, den Kapitalismus zu ‚zähmen‘ und ihn durch ordnungspolitische Rahmensetzung zur Sozialen Marktwirtschaft hin weiterzuentwickeln, war der einzig richtige Weg, und dieser Weg ist auch heute ohne vernünftige Alternative.“ (Ebd., 31) Man mag die Macht der Kirche bezweifeln, zur politischen und ökonomischen Gestaltung der Welt heute Wesentliches beizutragen. Aber eines muss man ihr lassen: Im Rechtfertigen kennt sie sich aus!
Literatur
- Ernst Bloch, Thomas Münzer – Als Theologe der Revolution. Frankfurt/M. 1972.
- Ulrich Duchrow, Mit Luther, Marx & Papst den Kapitalismus überwinden. Hamburg 2017 (zit. nach der Vorabveröffentlichung auf der VSA-Verlagsseite: http://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/mit-luther-marx-papst-den-kapitalismus-ueberwinden/).
- Friedrich Engels, Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent (1843). In: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin 1974 (zit. als MEW 1).
- Christoph Fleischmann, Gewinn in alle Ewigkeit – Kapitalismus als Religion. Zürich 2010.
- Christoph Fleischmann, Gottes Güter für alle – Die verdrängte Lehre der Reformation. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 5, 2017, S. 41-49.
- Wolfgang George (Hg.), Laudato Si‘ – Wissenschaftler antworten auf die Enzyklika von Papst Franziskus. Gießen 2017.
- Freerk Huisken, Der Papst als Kapitalismuskritiker: Unfehlbar? In: Online-Magazin Auswege, 24.1.2014, http://www.magazin-auswege.de/data/2014/01/Huisken_Gegenrede33_Der-Papst_als_Kapitalismuskritiker.pdf.
- Konrad Lotter, „Wider den Wucher zu predigen“. In: Junge Welt, 20./21. 5. 2017.
- Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung/Zur Judenfrage. In: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin 1974 (zit. als MEW 1).
- Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Frankfurt/Wien o.J.
- Reinhard Marx, Das Kapital – Ein Plädoyer für den Menschen. München 2008. (Der Brief an Karl Marx online: http://www.theeuropean.de/reinhard-kardinal-marx/11704-marx-schreibt-an-marx-ein-posthumer-briefwechsel.)
- Radio Vatikan, Papstbotschaft an Weltwirtschaftsforum in Davos. 20.1.2016. Online: http://de.radiovaticana.va/news/2016/01/20/papstbotschaft_an_weltwirtschaftsforum_in_davos/1202312
- Johannes Schillo, Kirche und Faschismus. In: Erwachsenenbildung, Nr. 1, 2017, S. 46-47.
- Franz Segbers/Simon Wiesgickl (Hg.), „Diese Wirtschaft tötet“ (Papst Franziskus) – Kirchen gemeinsam gegen Kapitalismus. Hamburg 2015.
Mai
„Marx is back“, Vol. 2
Zur jüngsten Marx-Renaissance, die die Öffentlichkeit beschäftigt (150 Jahre „Kapital“, 200. Geburtstag…), gab es bei IVA im April 2017 bereits eine Information. Hier eine Fortsetzung der IVA-Redaktion mit Hinweisen zu aktuellen Materialien.
Noch vor 50 Jahren war Marx in der Bundesrepublik ein totales Tabuthema. Staatliche Agenturen wie die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die die Bevölkerung gegen das „Gift“ des Marxismus-Leninismus immunisieren sollten, kümmerten sich darum, dass keiner auf falsche Ideen kam. Antikommunismus war Staatsdoktrin (vgl. Hentges 2013, Schillo 2015), die Absage an Marx (und Engels) dabei ein Unterpunkt. Während des Kalten Kriegs galt Marx im Westen als Begründer eines dogmatischen philosophischen Systems, dessen Konsequenzen sich in Theorie und Praxis als „extrem monistisch“ und „extrem totalitär“ erwiesen (Bocheński/Niemeyer 1958, 13f). So hieß es im „Handbuch des Weltkommunismus“, einem opulenten antikommunistischen Standardwerk, das die Bundeszentrale erstellen und jahrzehntelang in der Bildungsarbeit und bei sonstigen Meinungsbildnern verbreiten ließ. Die bpb war 1955 im Rahmen ihrer Neuorientierung, wie Gudrun Hentges in ihrer Studie „Staat und politische Bildung“ (2013) dargelegt hat, auf eine konsequente antikommunistische Feindbildpflege – im Blick auf „Forschung“, „Multiplikatoren“ und „Breitenarbeit“ – eingeschworen worden. Dazu gehörte an vorderster Stelle die Erarbeitung eines einschlägigen Handbuchs (Hentges 2013, 344f). Beauftragt wurde damit der polnische Ordenspriester Joseph Bocheński, der schon im KPD-Verbotsprozess ein Gutachten im Sinne des Innenministeriums geliefert hatte. Bocheński verstand die Aufgabe als Form „des geistigen Kampfes“, der „bedeutend zu intensivieren sei“, und zwar im Blick auf „die Abwehr – möglicherweise sogar den Angriff“ (ebd., 345, FN 4).
Anno Domini 2017 ist alles anders. Zum 150. Jubiläum der Erstausgabe des „Kapital“, Band 1, vermeldet die Bundeszentrale auf ihrer Website (Adresse siehe unten): „Nachdem Marx mit dem Ende der Sowjetunion 1991 ‚in der Praxis‘ widerlegt zu sein schien, erlebte sein Werk mit dem Beginn der globalen Finanzkrise eine Renaissance: Warum leben Marx und sein Werk durch die Jahrhunderte fort?“ Und sie stellt die Ausgabe Nr. 19-20 ihrer Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)“ kurz und bündig unter die Überschrift „Das Kapital“. Dazu heißt es im Editorial: „150 Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes von Marx’ Hauptwerk ‚Das Kapital‘ besteht immer noch großes Interesse an seinen Schriften sowie daran, sie zu verstehen und in Lesekreisen über ihre ‚richtige‘ Auslegung zu diskutieren.“ Die Publikation der bpb will zu der Frage Stellung nehmen, was das Publikum „in Krisenzeiten“ wie den heutigen von einer tausendseitigen ökonomischen Studie zu erwarten hat, „deren Lesart umstritten ist und deren Lektüre Jahre beanspruchen kann“.
Marx für „Kurzreisende“
Michael Quante, Mitherausgeber des neuen „Marx-Handbuchs“ (vgl. IVA-Redaktion, „Marx is back“, Vol. 1, Texte2017), hat zu dem APuZ-Heft den Eröffnungsbeitrag beigesteuert. Er soll einen „Traveller’s Guide“, also einen Reiseführer durch das schwierige Gelände der Marxschen Ökonomiekritik bieten. Dazu im Folgenden einige erste Bemerkungen. (Weitere Beiträge des Heftes befassen sich mit der komplizierten Entstehungsgeschichte des „Kapital“; mit Gesetzmäßigkeiten wie Konzentration und Zentralisation, die in der gegenwärtigen kapitalistischen Marktwirtschaft eine Rolle spielen, wozu u.a. ein Aufsatz von Hans-Werner Sinn nachgedruckt wird; mit Erfahrungen aus einer „Langstrecken-Marxlektüre“ von Dietmar Dath; mit der „Ikone“ Marx, d.h. der öffentlichen Inszenierung seines Bildnisses; sowie abschließend mit wachstumskritischen Alternativen zur Marxschen Theorie.)
Im „Marx-Handbuch“ hatten Quante und sein Mitherausgeber David P. Schweikard bereits deutlich gemacht, worin „die ungebrochene Aktualität des Denkens von Karl Marx“ (Quante/Schweikard 2016, V) bestehen soll: Bei ihnen wird „das Werk von Karl Marx … als primär philosophisches Programm aufgefasst“ (ebd.). Es wird also nicht mehr – was die beiden Herausgeber nach dem Ende des realen Sozialismus als eine Befreiung empfinden – „in den Dienst politischer Zielsetzungen gestellt“ (ebd.). Es wird vielmehr in den Dienst der Belebung und Erneuerung des Philosophiebetriebs gestellt, wo es vielleicht gar nicht hingehört, wie auch das Handbuch zu erkennen gibt. Immerhin hat ja Michael Heinrich im Hauptteil des Handbuchs ausführlich dargelegt, wie sich Marx aus seinen philosophischen Anfängen heraus- und zur Ökonomiekritik hinarbeitete (ebd., 71ff). Und der Teil A des Handbuchs „Philosophische Schriften“ (Autor: Andreas Vieth) tut sich erkennbar und explizit schwer, Marx einfach als (dialektischen) Philosophen zu präsentieren. So gibt es eingangs die kryptischen Sätze: „Philosophie ist für Marx ein im praktischen Denken geformtes, in Notwendigkeit systematisch zusammenhängendes Ganzes (eine Gedankentotalität, die im Bewusstsein des Wissenschaftlers konkret geworden ist). Aber es gibt keine schriftlich überlieferte, bloß um Marxens Bewusstsein verarmte Schrift von ihm.“ (Ebd., 31) Doch die Ungereimtheiten der theoretischen Aufbereitung machen nichts. So geht eben Pluralismus in der bürgerlichen Wissenschaft und die Herausgeber fühlen sich verpflichtet, „diese Pluralität auch in unserem Handbuch abzubilden“ (ebd., V).
Quante will in seinem APuZ-Beitrag für „Kurzreisende“ einige „zentrale Theoriebausteine“ präsentieren und konzentriert sich dazu auf die Kritik der politischen Ökonomie, hält aber gleich fest: „Sie ist eine kritische Sozialphilosophie und keine ökonomische Theorie im Sinne einer empirischen Einzelwissenschaft. Entgegen einem bis heute weit verbreiteten Missverständnis gilt es, den genuin philosophischen Charakter der marxschen Konzeption zu erkennen und anzuerkennen“ (Quante 2017, 4). Dazu bietet Quante eine Reihe von Zitaten aus dem „Kapital“, vor allem aus den Vor- und Nachworten und aus der Warenanalyse, wobei natürlich das Fetischismus-Problem (vgl. MEW 23, 86f), das bereits für einige philosophische Verrätselungen gesorgt hat, nicht fehlen darf. Zu Quantes Referat wäre Verschiedenes zu sagen. Es ist dabei auch eine Reihe von Fehlern unterlaufen – so etwa, wenn der Tauschwert bzw. der Wert als „intersubjektive Geltungsdimension“ gefasst wird oder „drei Stunden Backarbeit“ in „zwei Stunden Tischlerarbeit“ ihr Äquivalent finden sollen (Quante 2017, 6). Wichtig ist aber die Hauptargumentationslinie: Weil Marx, wie auch Heinrich in seinem politökonomischen Abriss (allerdings mit ganz anderer Zielrichtung) festhält, keine moralische Kritik am Fehlverhalten der einzelnen Akteure geliefert hat, soll in seiner Schrift aus philosophischer Perspektive überhaupt keine Kritik mehr – jedenfalls keine normativ-ethisch abgesicherte – auffindbar sein.
Eins ist Quante klar: „Die Kritik der politischen Ökonomie von Marx ist keine Gerechtigkeitstheorie.“ (Ebd., 9) Das heißt, die kapitalistische Produktionsweise ist nicht damit zu kritisieren, dass man ihr das Ideal der Gerechtigkeit entgegen hält. Dem ist zuzustimmen. Solchen Idealen macht Marx gerade den Prozess, indem er zeigt, wie sie zur kapitalistischen Warenproduktion dazugehören. Für den Marx-Experten ist damit aber eine neues Problem entstanden. An der schäbigen Rolle der Ware Arbeitskraft und an der Absurdität des Systems, die Marx in ihrem notwendigen Zusammenhang analysiert, soll sich gar nichts Kritisches mehr festhalten lassen Das Urteil über diese Weise des Wirtschaftens soll damit noch offen sein, es braucht einen festen philosophischen Grund, den Marx leider nicht mitgeliefert, dessen Notwendigkeit er vielleicht übersehen hat, weil ihm sein eigenes theoretisches Programm nicht recht klar geworden ist. Daraus folgt: „Wenn man diese Gesellschaftsformation aus ethischer Sicht kritisieren will, muss man andere ethische Normen und Werte als Maßstab heranziehen. Diese aber legt Marx in seiner Kritik nicht offen.“ (Ebd.) Die Leerstelle kann die Philosophie füllen, logischer Weise, denn ohne deren Anspruch würde man sie nicht entdecken. Die Interpretation des Materials passt also – wie sollte es anders sein – mit der Prämisse zusammen.
Marx als Mensch
Der Inszenierung des Jubiläums entsprechend müssen natürlich auch die biographischen Hinter- und Abgründe gewürdigt werden. Die meisten Veröffentlichungen bringen einen Abriss des Lebens mit allen Höhen und Tiefen, Schwachheiten und Stärken des Jubilars. Z.B. hält es Ingrid Artus in ihrer Einführungsschrift (siehe „Marx is back, Vol. 1“) für notwendig, dem Leser auch den Menschen Marx vorzustellen, und zwar deshalb, weil das „menschliche Denken wesentlich geprägt ist von den materiellen Produktionsbedingungen seiner Zeit“. (Artus 2014, 7f) Mit dieser Bemerkung bezieht sich die Politikwissenschaftlerin auf Marx selbst, der in der „Deutschen Ideologie“ (MEW 4) oder im berühmten Vorwort „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ (MEW 13) den Zusammenhang von gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein thematisiert hatte. Demzufolge müsse man festhalten, so die Autorin, „dass der Mensch im wesentlichen durch seine Produktionsbedingungen geprägt sei“ (Artus u.a. 2014, 14). Das gelte auch für den Klassiker der Kapitalismuskritik: „Ein Verständnis seiner Ideen“ sei „ohne Kenntnis der Biographie von Karl Marx und des Zeitgeistes, der ihn beeinflusste, nicht möglich“ (ebd., 8).
Es ist indes äußerst gewagt, sich für die Entscheidung zum biographischen Vorgehen auf Marx zu berufen. Marx, der sich mit Adam Smith, David Ricardo und zahllosen anderen Theoretikern aus Ökonomie oder Philosophie auseinandersetzte, verzichtete z.B. darauf, den Leser mit der Lebensgeschichte der Betreffenden zu behelligen. Es stimmt natürlich, Marx schrieb in dem erwähnten Vorwort: „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ (MEW 13, 9) Diese Feststellung ist aber keine erkenntnistheoretische oder wissenssoziologische Aussage über die soziale Bedingtheit und Begrenztheit des Denkens schlechthin – geschweige denn ein Fingerzeig zum richtigen, nämlich biographischen Zugang zu theoretischen Leistungen –, sondern die Charakterisierung des notwendig falschen Bewusstseins. Wie sollte auch die Theorie von Marx Ausdruck seines sozialen Seins, also seiner Einbindung in die neu entstandene Gesellschaftsformation namens Kapitalismus, sein, wo doch bei den Zeitgenossen von der „Vulgärökonomie“, die er mit Hohn und Spott bedachte, dasselbe Sein einen ganz anderen, entgegengesetzten theoretischen Ausdruck fand? Marx thematisiert in dem genannten Vorwort nicht eine Determination des Bewusstseins, sondern resümiert seinen eigenen politökonomischen Forschungsprozess und dessen „allgemeines Resultat“: die Einsicht in den Entwicklungsgang von Gesellschaftsformen, in denen die Menschen ihren ökonomischen Zusammenhang nicht bewusst planen und gestalten, wo ihre Ideen also nicht die Wahrheit ihrer Praxis sind. Der Kapitalismus sei die letzte Stufe dieser Reihe; er ermögliche es, die bisher bestehenden „Antagonismen“ abzuschaffen; mit dieser Gesellschaftsformation schließe „daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab“ (ebd.). Demnach wird, wenn die Marxsche Erwartung eines Systemwechsels in Erfüllung geht, die Menschheit ihre Produktionsverhältnisse mit Wille und Bewusstsein prägen statt umgekehrt.
In ihrem einleitenden Beitrag zu dem genannten Sammelband bietet Artus ein Porträt von Marx, das Stationen von Leben und Werk Revue passieren lässt und sich auch dem Privat-, z.B. Familienleben des Theoretikers zuwendet. Die Autorin hat dazu keine eigenen Forschungen angestellt, sie bezieht sich u.a. auf Eva Weissweilers Biographie der Lieblingstochter von Marx (Weissweiler 2002) und behandelt dieses Buch als seriöse Auskunftsquelle. Das ist erstaunlich! Die Biographie „Tussy Marx“ ist erkennbar gegen Marx als Person geschrieben. Sie will, so die Ankündigung des Klappentextes, „eine Fülle unbekannter Details aus dem Leben und Wirken von Karl Marx – etwa über seinen wütenden Antisemitismus“ liefern. Neben der „Judenfrage“ ist die „Frauenfrage“ der zweite große Angriffspunkt. Wie der Untertitel vom „Drama der Vatertochter“ bereits erkennen lässt, ist es der Vater, der der Tochter das Leben schwer macht. Ein Glück für Marx, dass die Biographin in Edward Aveling, dem späteren Partner von Eleanor, genannt „Tussy“, einen üblen Kerl gefunden hat, der das Leben von Marxens jüngster Tochter ruinierte und sie in den Selbstmord trieb (vielleicht sogar dabei seine Hand mit im Spiel hatte). So trifft den Vater nicht die volle Schuld, wenn es um das – letztendlich – verpfuschte Leben einer großartigen Frau geht.
Mit der Entscheidung zur Biographie ist klargestellt, dass die Marxsche Theorie für sich genommen nicht interessiert. Es interessiert die persönliche Aufführung. Es geht um einen Blick auf die Privatsphäre, auf den Familienmenschen, den „übermächtigen“ Vater – und zwar durch das Porträt der Tochter hindurch, dieser „begabten und unglücklichen Frau“ (Klappentext). Mehr braucht man eigentlich über ein solches Unterfangen nicht zu wissen. Es führt logischer Weise zu Klatsch und Tratsch: Marx war auch nur ein Familienvater aus dem 19. Jahrhundert – mit dem Rattenschwanz von Problemen, die eine verkrachte bürgerliche Existenz mit sich bringt. Aber zur theoretischen Leistung von Marx soll das Buch trotzdem Einsichten beisteuern: Seine Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen war so komplex, dass noch nicht einmal die Tochter sie verstand (Weissweiler 2002, 180f), vielmehr ein Leben lang an dem konsequent materialistischen Standpunkt ihres Vaters litt, der sich von den völkischen und religiösen Überlieferungen seiner Vorfahren losgesagt hatte – ein Leiden, das natürlich unbewusst war und erst durch geschickte Interpretationen der Biographin herauspräpariert sowie durch die bekannten Zerrbilder des Marxismus (die z.B. in der Totalitarismustheorie durch Hannah Arendts These vom „linken Antisemitismus“ überliefert sind) bestätigt werden muss.
Marxens Judentum ist aber auch für andere Erklärungen gut. Fritz Erik Hoevels, selber Psychoanalytiker, präsentiert eine psychoanalytische Erklärung, zu der er richtigerweise feststellt, dass ein solches Verfahren „die ganze Lehre in … subjektiven Antrieben aufzulösen versucht, was natürlich abwegig ist“ (Hoevels 2009, 69). Gemeint ist hier Günter Schulte (1992), demzufolge „gewisse unbewusste Antriebe in Marx, welche aus dessen Kindheit stammen müssen (besonders das schreckliche Trauma der real erlittenen Beschneidung)“ für das Verständnis des Kapitalismuskritikers unerlässlich sind. Hoevels findet das, obwohl er es besser weiß, „scharfsinnig“ (Hoevels 2009, 69), und es veranlasst ihn, der mit seinem Buch eigentlich nur die Gültigkeit oder Fehlerhaftigkeit der in Rede stehenden Theorie behandeln wollte, dann doch dazu, selber „etwas Persönliches von Marx und Engels“ (so das sechste Kapitel seines Buchs) mitzuteilen. Irgendwie muss Marxens theoretischer Hauptantrieb, der Kampf gegen die ihn umgebende Lüge, eine „kindliche Vorgeschichte“ (ebd., 71) gehabt haben, letztlich wohl im Ödipuskomplex verankert gewesen sein…
Das Letzte
Übrigens, 2017 ist nicht nur Marx-, sondern auch Ludwig-Erhard-Jahr. Die Konrad-Adenauer-Stiftung informiert: „120. Geburtstag am 4. Februar, 40. Todestag am 5. Mai, sein Opus magnum ‚Wohlstand für Alle‘ erschien vor 60 Jahren, 70 Jahre sind seit der Gründung der ‚Sonderstelle Geld und Kredit‘ vergangen, die unter Erhards Vorsitz an einer neuen deutschen Währung mitarbeitete. Währungs- und Wirtschaftsreform 1948, das daraus folgende Wirtschaftswunder und die Verankerung der Sozialen Marktwirtschaft bleiben untrennbar mit seinem Namen verbunden.“
Ein Sonderheft der Stiftungs-Zeitschrift „Die Politische Meinung“ zum Erhard-Jubiläum (u.a. mit einem Beitrag von Finanzminister Schäuble) ist seit dem 5. Mai 2017 erhältlich. Online: http://www.kas.de/wf/de/34.6/. Erhards Buch „Wohlstand für Alle“ (1. Auflage, Düsseldorf 1957) ist online bei der Ludwig-Erhard-Stiftung greifbar: http://www.ludwig-erhard.de/wp-content/uploads/wohlstand_fuer_alle1.pdf.
Literatur
- Ingrid Artus u.a., Marx für SozialwissenschaftlerInnen – Eine Einführung. Wiesbaden 2014.
- Joseph M. Bocheński/Gerhart Niemeyer (Hg.), Handbuch des Weltkommunismus. Freiburg und München 1958.
- Gudrun Hentges, Staat und politische Bildung – Von der „Zentrale für Heimatdienst“ zur „Bundeszentrale für politische Bildung“. Wiesbaden 2013.
- Fritz Erik Hoevels, Wie unrecht hatte Marx wirklich? Band I: Gesellschaft und Wirtschaft. Freiburg 2009.
- Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859). Marx-Engels Werke, Band 13. Berlin 1981 (zit. als MEW 13).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx-Engels-Werke, Band 23, Berlin 1977 (zit. als MEW 23).
- Karl Marx/Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. Marx-Engels Werke, Band 3. Berlin 1974 (zit. als MEW 3).
- Michael Quante, A TRAVELLER’S GUIDE – Karl Marx’ Programm einer Kritik der politischen Ökonomie. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 19-20, 2017, S. 4-9.
- Michael Quante/David P. Schweikard (Hg.), Marx-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2016.
- Johannes Schillo, Antimarxismus heute. In: J.S. (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Hamburg 2015, S. 87-129.
- Günter Schulte, Kennen Sie Marx? Frankfurt/M. und New York 1992.
- Eva Weissweiler, Tussy Marx – Das Drama der Vatertochter. Eine Biographie. Köln 2002.
Materialien und Quellen
Marx-Jubiläum – https://marx200.org/: Die Website marx200.org ist ein Projekt von Rosa-Luxemburg-Stiftung und Helle Panke (Berliner Landesstiftung). Selbstdarstellung: „In den Jahren 2017 und 2018 gibt es gleich mehrere Jubiläen, deren Bedeutung für die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft kaum zu unterschätzen ist: ‚150 Jahre Das Kapital‘ im Herbst 2017, ‚170 Jahre Das kommunistische Manifest‘ im Februar 2018 sowie der 200. Geburtstag von Karl Marx im Mai 2018. Auch die Revolutionen vom Februar und Oktober 1917 in Russland und jene vom November 1918 in Deutschland jähren sich zum 100. Mal. Und noch ein weiteres Jubiläum reiht sich 2018 ein: Die ‚1968er‘ – 50 Jahre globaler Aufbruch. Viele Anlässe also, die zusammengenommen eine einmalige Gelegenheit bieten, um sich mit den Etappen einer ‚Kritik nach Marx‘, dem aktuellen Stand der Marx-Diskussion und der Gesellschaftskritik insgesamt auseinanderzusetzen. Aber auch, um diese Auseinandersetzung nach vorne zu wenden: Was sind die Aufgaben einer Kritik nach Marx heute?“
Wörterbuch des Marxismus – https://marx200.org/taxonomy/term/151: Anlässlich des 100. Todestag von Karl Marx 1983 wurde das Projekt Historisch Kritisches Wörterbuch des Marxismus (HKWM) ins Leben gerufen. Über 15 Bände und 1.500 Stichwortartikel hinweg werden von verschiedenen Autoren Begriffe des Marxismus definiert und erläutert. Erschienen sind bisher die Bände 1 bis 8/II, aus denen auf der Website einige der wichtigsten Stichwörter vorgestellt werden.
Marx in der DDR – http://marx200.org/blog/groesster-sohn-zwischen-unterhoeschen. Eine Serie von Tom Strohschneider, u.a. mit den Folgen: Marx in der DDR I – über die Schwierigkeiten des Zurückblickens, politische Legitimation durch Bilder und Debatten in der Nische; Marx in der DDR II – über den heiligen Karl, die Verwandlung einer Weltanschauung in ein Religionssurrogat und eine Feststellungsfestveranstaltung.
Karl-Marx-Haus Trier – http://www.fes.de/marx/index_gr.html. Leitbild: „Das Karl-Marx-Haus ist das einzige Museum in Deutschland zu Leben, Werk und Wirkung von Karl Marx… Heute ist es ein Ort der Information und der kritischen Auseinandersetzung sowohl in der Ausstellung wie in der Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Das Spektrum umfasst historische Fragestellungen ebenso wie aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen… Das Karl-Marx-Haus ist Teil der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ausgerichtet ist es an den Grundwerten der sozialen Demokratie und bietet parteiübergreifend Veranstaltungen zu sozialen und politischen Fragen. Das kleine kompetente Team arbeitet mit unterschiedlichen lokalen und regionalen Partnern zusammen. Es ist Ansprechpartner für Medien und Wissenschaft, eingebunden in die internationale wissenschaftliche Arbeit des Archivs der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (AdsD) und dessen Netzwerke.“ Anschrift: Brückenstraße 10, 54290 Trier. Öffnungszeiten: 1. April bis ca. 15. September: Montag bis Sonntag, 10:00 - 18:00 Uhr. Ca. 16. September 2017 bis 4. Mai 2018 wegen Umbaus geschlossen. (Am 5. Mai ist der Geburtstag von Karl Marx.)
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) – http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/247643/das-kapital. Die Bundeszentrale bringt am 8. Mai 2017 Nr. 19-20/2017 ihrer Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)“ heraus. Das Thema des Heftes lautet: „Das Kapital“. Die APuZ-Ausgabe (Bonn, 48 S., Bestellnummer: 7719) steht auf der Website zum Download zur Verfügung oder kann über die bpb (Adenauerallee 86, 53113 Bonn, E-Mail: info@bpb.de) im Printformat (als Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“) bezogen werden. Autoren der APuZ-Ausgabe zum „Kapital“ sind: Michael Quante, Werner Plumpe, Ulrike Herrmann, Hans-Werner Sinn, Dietmar Dath, Beatrix Bouvier und Niko Paech.
April
„Marx is back“, Vol. 1
Tja, er ist wieder da, wieder hier… Weil die Öffentlichkeit den Brauch der runden Jahreszahlen pflegt – 150 Jahre „Das Kapital“, nächstes Jahr der 200. Geburtstag –, kommt man an dem alten Rauschebart in Medien und Kulturbetrieb kaum noch vorbei. Zur jüngsten „Marx-Renaissance“ einige Hinweise der IVA-Redaktion.
Seit dem Ende des Adenauerstaats, als die bewegten Studenten die Klassiker der Kapitalismuskritik wiederentdeckten und man z.B. in der katholischen Soziallehre über eine „Marx-Renaissance“ diskutierte (Nell-Breuning 1969), reißen die Rückblicke nicht mehr ab. Medien, Buchmarkt und speziell das Feuilleton lassen sich das Thema nicht entgehen, aber auch im Bildungs- und Wissenschaftsbetrieb – vom Jubiläumsband der Edition Suhrkamp „Folgen einer Theorie“ (Mohl 1967) bis zum aktuellen Marx-Forum der Universität Oldenburg (Adresse siehe unten) – greift man den Anlass gerne auf. So kommt es zu einer merkwürdigen Aktualität, die, wie es im Auswege-Magazin heißt, „in allerlei Jubiläumsaktivitäten vom Trierer Lokalpatriotismus bis zur europäischen Filmförderung (Raoul Pecks Film ‚Der junge Marx‘) breit getreten wird“ (Schillo 2017, 1). Dazu gehört auch, dass sich „neue Ideen, oft solche mit ‚marxistischem‘ Hintergrund, in der volkswirtschaftlichen Publizistik der letzten Jahre enorm vermehr(en)“ (Schuster 2017, 2). Besonders seit der Abdankung des Ostblocks ist diese Wiederaneignung auf Touren gekommen, und so konnte man 1998 zum 150. Jubiläum des Kommunistischen Manifests in FAZ, Spiegel, Zeit, Handelsblatt etc. erstaunliche Lobpreisungen auf die hellsichtigen Dia- und Prognosen dieses einst verrufenen Textes lesen.
Die Zeitschrift Gegenstandpunkt (GS) hat anlässlich dieser letzten großen Feierstunde die Verrücktheiten der Retrospektiven aufs Korn genommen (vgl. Held 1998) und ihrem Kommentar gewissermaßen als Motto ein Zitat aus der Wirtschaftsredaktion der SZ vorangestellt: „Nun, da es einen ernstzunehmenden Marxismus nicht mehr gibt, besteht auch die Chance, vorurteilsfrei die Seiten des Marxschen Werkes zu betrachten, in denen er recht behielt.“ (Nikolaus Piper, SZ, 21.2.98) Dazu hieß es im GS-Artikel: „Mit der größten Selbstverständlichkeit legt dieser Vertreter der absolut überparteilichen und unabhängigen ‚vierten Gewalt‘ ein Bekenntnis zum parteilichen Denken im Dienste seiner Obrigkeit ab. Solange es eine real existierende Alternative zum wunderbaren System von Marktwirtschaft und Demokratie gab, hatte der in westlichen Redaktionen beheimatete kritische Sachverstand schlechterdings keine Chance zur vorurteilsfreien Analyse linken Schrifttums. Propaganda gegen linke Systemgegner war damals nunmal ein Gebot der Freiheit. Jetzt, wo der gefährliche Spuk vorbei ist, kann man das erstens gelassen zugeben und sich zweitens ganz unverkrampft der Frage zuwenden, was uns das ‚Gespenst‘ aus dem Kommunistischen Manifest heute noch zu sagen hat.“ (Held 1998, 159) Der umfangreiche Überblick des GS geht dann nicht nur auf die erstaunlichen Leistungen der medialen Aufbereitung ein – auf die Negierung des theoretischen Gehalts der hochgelobten Schrift, speziell ihres Kritikcharakters, zugunsten einer Würdigung ihrer angeblichen prognostischen Kraft –, sondern auch auf die Schwächen der alten Kampfschrift (deren Geburtsstunde Raoul Peck übrigens in seinem Film werkgetreu, aber in der Manier eines Bio-Picture nachgezeichnet hat).
Die entscheidenden Punkte zur bürgerlichen Marx-Renaissance kann man in dem genannten Artikel nachlesen, sie sind nicht veraltet. Im Folgenden soll es Hinweise auf Vorgänge oder Veröffentlichungen geben, die für eine Auseinandersetzung mit der verdrängten Theorie heute von Interesse sein dürften. Die Informationen werden bei Bedarf fortgesetzt.
Die Aktualität der Theorie
Aus dem IVA-Kreis war 2015 der Sammelband „Zurück zum Original“ (Schillo 2015) hervorgegangen, der sich darum bemühte, in dem – gerade nach der globalen Finanzkrise verstärkten – Kult um den interessante Klassiker Marx eine erste Sortierung vorzunehmen: nämlich danach, wo modische Bezugnahme (inklusive der nach wie vor angesagten Überwindung oder Widerlegung marxistischer Erkenntnisse) stattfindet und wo es Ansatzpunkte für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der in Erinnerung gebrachten Theorie, speziell mit der Kritik der politischen Ökonomie, gibt. Die Reaktionen auf das Buch in der wissenschaftlichen, vor allem „marxologischen“ Szene waren negativ. Dass man mit dem „Original“, also den drei Bänden des „Kapital“, ohne Weiteres theoretisch etwas anfangen könnte, galt hier als naiv, ja „stupide“ (so Konkret 4/17). Das ist verständlich in einem Betrieb, der das theoretische Erbe der Kapitalismuskritik als Steinbruch benutzen möchte, um fruchtbare Forschungsansätze zu generieren und daraus neuartige akademische Karrieren zu verfertigen. Positive Reaktionen gab es aus der außerschulischen Bildungsarbeit. So ist in der gewerkschaftlichen Bildung eine Reihe von Marx-Seminaren in Gang gekommen, die sich die Frage stellen, was man heute im Blick auf Ware, Geld und Kapital von dem alten Rheinländer lernen kann. Eine ausführliche Rezension des IVA-Sammelbandes in der Hamburger Lehrerzeitung der GEW (Bernhardt/Gospodarek 2017) ist jüngst noch einmal auf das Anliegen der Wiederaufnahme dieser wissenschaftlichen Tradition eingegangen. Sie skizziert entscheidende politökonomische Sachverhalte, bekräftigt die Notwendigkeit der Originallektüre – „Marx ist mit Marx zu verstehen“ (Schillo 2015, 82) –, spricht aber auch die Schwierigkeiten an, die der Annäherung an das umfangreiche theoretische Opus im Wege stehen.
Im Wissenschaftsbetrieb gibt es allerdings auch – hier und da – den Nachdruck darauf, dass die Kritik der politischen Ökonomie ernst zu nehmen und die von ihr gelieferten Erklärungen auf den aktuellen, krisenhaften Weltkapitalismus zu beziehen sind. So referiert Michael Heinrich im neuen Marx-Handbuch (Quante/Schweikard 2016, 71ff) den Argumentationsgang der drei Bände des „Kapital“, ohne dass dies mit der Relativierung versehen wird, hier habe man es mit einem speziellen Blickwinkel oder einer zeitbedingten, auf eingrenzbare Phänomene etwa eines Manchester-Kapitalismus ausgerichteten und darin befangenen Analyse zu tun. Heinrich stellt die Marxsche Theorie der Ausbeutung als grundlegende Erklärung der Rolle der Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise vor. Die Theorie sei wissenschaftlich korrekt und „genau so wenig moralisch gemeint wie die Rede von der Ausbeutung der Gebrauchswerte oder der Naturgesetze“ (ebd., S. 105). Sie ziele nicht auf persönliches (Fehl-)Verhalten der maßgeblichen Wirtschaftssubjekte, sondern darauf, dass sich die Menschen als „Charaktermasken“ den Notwendigkeiten der kapitalistischen Warenproduktion gemäß machen. Indem die Einzelnen dem sachlichen Zusammenhang der Waren- und Geldzirkulation folgen, reproduzieren sie – nachdem die historischen Voraussetzungen durch die „ursprüngliche Akkumulation“ (MEW 23, Kap. 24) geschaffen sind – beständig die Klassenteilung der Gesellschaft, d.h. die auch heute noch bestehende Scheidung in dienstbare Arbeitskraft und sich verwertendes Kapital. Der Verwertungsprozess hat, wie das Referat festhält, seinen Existenzgrund in der nützlichen Armut der arbeitenden Massen; er setzt deren Freisetzung und Ausschluss von den vorhandenen objektiven Produktionsbedingungen voraus. Heinrich ergänzt diese Einführung auch durch Anmerkungen zu einzelnen Grundbegriffen der Politökonomie (Wert, Mehrwert, Fetischismus, tendenzieller Fall der Profitrate, Krise…), die in der marxistischen Debatte für Kontroversen gesorgt haben (Quante/Schweikard 2016, 173ff).
Eins fällt jedoch gleich auf: Heinrichs Beiträge sind eher ein Fremdkörper in dem Handbuch. Dessen Intention ist es, wie die Herausgeber eingangs festhalten, „das Werk von Karl Marx … als primär philosophisches Programm“ aufzufassen (ebd., V). Solche Prämissen leisten sich die beiden verantwortlichen Wissenschaftler, übrigens Philosophen von Profession, in dem klaren Bewusstsein, dass sie sie an die Marxschen Texte herantragen – sie seien nämlich „in der Forschung umstritten und stimmen auch nur teilweise mit Marx‘ Selbstverständnis überein“ (ebd.). An dieser Deutung ändern auch Heinrichs Darlegungen dazu, wie sich Marx aus seinen philosophischen Anfängen heraus- und zur Ökonomiekritik hinarbeitete, nichts; auch nicht Schweikards Auskunft im biographischen Abriss zur Entwicklung des theoretischen Interesses von Marx, seitdem er sich dem Bund der Gerechten zugewandt hatte. Die Kritik der politischen Ökonomie, von Marx mit dem ersten Band des „Kapital“ vorgelegt, „liefert der Arbeiterbewegung ihre Grundlagenschrift“ (ebd., 18), weiß der sachkundige Biograph. Für das Handbuch aber ist klar, wie es zu Beginn der Werkanalyse (Autor: Andreas Vieth) heißt: „Marx war ein dialektischer Philosoph“ (ebd., 31). Der Autor muss dabei gleich einräumen, dass die Aussage, an seinem eigenen Bild von Dialektik gemessen, nicht haltbar ist, denn Marx als Philosoph sei in mehrfacher Hinsicht gescheitert. Erstens habe er seine Philosophie gar nicht wirklich ausgearbeitet, sondern im Dunkeln gelassen; seiner Position eigne eine „grundlegende Opazität“ (ebd.). Zweitens arteten seine „dialektischen Gespräche … vielfach in wüste Beschimpfungen seiner Gegner aus“ (ebd.). Fehlt nur noch der Hinweis auf die Marxschen Furunkel, die seiner Reizbarkeit angeblich zugrunde lagen. Aber solche Dinge werden dann anderer Stelle, wo man sich um die biographischen Hinter- und Abgründe kümmert, ausgiebig nachgetragen…
Die Einführung „für SozialwissenschaftlerInnen“ von der Politologin Ingrid Artus u.a. (2014) leistet sich einen ähnlichen Spagat. Auch diese Schrift zu Marx „reiht sich“, wie es in der Einleitung heißt, „ein in die Renaissance seiner Kritik der politischen Ökonomie“ (Artus 2014, 2). Eine solche Wiederaneignung sei wichtig, denn speziell in der Scientific Community habe man bis vor Kurzem den Marxismus „ins Reich der Legenden und der ‚unwissenschaftlichen‘, politisch normativen Theorien verbannt“ (ebd., 3). Gegen diese Exkommunikation wollen die Autoren und Autorinnen – vorwiegend aus der jüngeren Generation der Sozialwissenschaftler – anschreiben. Der Marxismus ziehe sich nicht auf eine „werturteilsfreie empirische Beschreibung“ (ebd.) der sozialen Welt zurück, halten sie fest und vermerken so die Distanz zum normalen akademischen Vorgehen. Praxisorientierung und eingreifendes Denken machten aber gerade eine theoretische Stärke aus – mit der Konsequenz, „dass die von Marx geprägten Begriffe und Ansätze unverzichtbar sind, um die kapitalistische Gesellschaft zu verstehen, in der wir leben“ (ebd., 4).
Dazu will die Einführungsschrift „weitgehend unstrittiges Grundlagenwissen“ präsentieren „und zugleich auf mögliche verschiedene Lesarten von Marx aufmerksam … machen“ (ebd.). Mit dem letzten Punkt deutet sich bereits an, dass es mit der Kenntnisnahme und Überprüfung einer Theorie nicht getan ist, sondern dass sich hermeneutische oder sonstige Probleme einer wissenschaftlichen Einordnung stellen. Auf der einen Seite konzentriert sich der Band zwar auf die Kritik der politischen Ökonomie. Zentral sind die drei Beiträge von Oliver Nachtwey, Alexandra Krause und Florian Butollo, die in die politökonomische Theorie einführen – ähnlich wie Heinrich das unternimmt, nur nicht von der Gliederung des „Kapital“ ausgehend, sondern jeweils von speziellen Themenstellungen (Lohnarbeit, Wachstum, Globalisierung). Auf der anderen Seite aber wird die Einführung ins Werk durch die philosophische Perspektive bestimmt. Der einleitende Beitrag von Claudius Vellay würdigt die Philosophie generell als unverzichtbare Suche nach „Antworten auf die allgemeinsten, die grundsätzlichsten Fragen, die sich die Menschen stellen“ (ebd., 29) und Marx (plus Engels) in diesem Zusammenhang gerade nicht als Kritiker, die der Suche nach der Bestimmung „des“ Menschen und den überzeitlichen Seinsgesetzen eine fundierte Absage erteilt haben. Vielmehr sollen sie dem traditionsreichen Unternehmen der Sinnsuche und -stiftung erst wieder neues Leben eingehaucht haben. Beide könnten „für sich beanspruchen, einen wichtigen Schritt vorwärts in der Geschichte der Philosophie gemacht zu haben.“ (Ebd., 29)
Ähnliche Relativierungen der ökonomischen Kritik findet man auch da, wo ausdrücklich darauf bestanden wird, dass Marx mit seiner Analyse Recht hatte (vgl. Altvater 2015, Reheis 2016). Die Hochschullehrer Elmar Altvater oder Fritz Reheis lassen eine solche Position etwa in ihren Einführungen erkennen. Beide geben einen orientierenden Einstieg in die Analyse des „Kapital“ und handeln von dieser Theorie als der entscheidenden Leistung, die heute wieder in Erinnerung gebracht werden sollte. Denn, so der Tenor, sie vermag eine triftige Erklärung zur Lage der globalisierten Marktwirtschaft beizusteuern. Beide Autoren folgen aber nicht – wie Heinrich in seinem Aufriss – dem Argumentationsgang der drei Bände, sondern machen nach wenigen Kapiteln den Absprung in andere Gefilde, nicht unbedingt in philosophische Problemstellungen, aber doch in übergeordnete Fragen der Wissenschafts- und Mentalitätsgeschichte, der Diagnosen universeller Krisen und Umbrüche, die die Ökosysteme, die Genderfrage, die Sinnstiftung, das „kulturelle“ oder „soziale Kapital“ betreffen. Bei Reheis ist die Theorie der Ausbeutung nur der Auftakt, um auf den eigentlichen Skandal, die Ausbreitung des Materialismus, zu sprechen zu kommen: „Es ist der Kapitalismus, der die Sinne des Menschen verarmen lässt und ihn auf einen einzigen Sinn hin ‚konditioniert‘ – den ‚Sinn des Habens‘.“ (Reheis 2016, 48) Altvater hält fest, dass die Kritik der politischen Ökonomie Wissenschaft ist „und zugleich“ Bestärkung der „Praxis der Gesellschaftsveränderung. Allerdings benötigt die gesellschaftsverändernde Praxis auch Zielvorstellungen, die sich nicht allein aus dem Analysierten ergeben… Es bedarf auch konkreter Utopien.“ (Altvater 2015, 13) Hier geht es also um den Status einer kritischen Wissenschaft, etwa um die Frage, wie sie sich im pluralistischen Betrieb positioniert. Ihr Involviertsein in oder Drängen auf gesellschaftliche Praxis soll ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden. Im Gegenteil, Praxisrelevanz ist wichtig, wie Altvater betont. Es müsse jedoch ein wechselseitiges Theorie-Praxis-Verhältnis geben: „Die Marxsche Theorie ist dabei besonders wichtig, aber sie ist nicht der alleinige Bezugspunkt.“ (Ebd., 17) „Marxismus im Plural“ (ebd., 95) – in Theorie und Praxis – ist die Konsequenz. „Ein ‚Masterplan‘ führt nicht nur nicht weiter, er führt in die Irre… Auch privates Eigentum hat in einer pluralen Ordnung des Eigentums seinen Platz“ (ebd., 130, 136).
Der Gegenstandpunkt hat in der Ausgabe 1/17 einen Aufsatz „150 Jahre ‚Das Kapital‘ und seine bürgerlichen Rezensenten“ (Decker 2017) veröffentlicht, der zwar nicht detailliert auf die aktuellen Debatten eingeht, der aber Aufschluss über die akademischen Schwierigkeiten mit der Kritik der politischen Ökonomie gibt – und damit auch klärt, warum der etablierte Wissenschaftsbetrieb das Attribut „bürgerlich“ verdient. Der Aufsatz befasst sich mit vier Klassikern der Marx-Widerlegung, die beginnend vor hundert Jahren die Weichen so stellten, dass die moderne Wissenschaft mit den Marxschen Erklärungen nichts anfangen kann. Als erstes wird Joseph Schumpeter als Vertreter der Wirtschaftswissenschaft mit seinem Verdikt über die „Wertlehre“ vorgestellt und kritisiert. Es folgt Max Weber mit seinen soziologischen Einwänden gegen den Befund der Klassengesellschaft. Drittens ist die Adaption – und Umdeutung – der Marxschen Ideologiekritik in der Wissenssoziologie á la Karl Mannheim Thema, viertens dann der wissenschaftstheoretische Frontalangriff Karl Poppers auf eine Sozialforschung, die nicht seine methodologischen Vorschriften befolgt.
Wie der Durchgang durch die exemplarischen Positionen zeigt, steht die aktuelle Marx-Rezeption „ganz in der Tradition des bürgerlichen wissenschaftlichen Betriebs, der es sich von Anbeginn nicht hat nehmen lassen, Marx unter dem Gesichtspunkt seiner Brauchbarkeit für Theorie und Praxis des kapitalistischen Ladens in Anspruch zu nehmen“ (ebd., 93). Über die Wissenschaftler heißt es: „Sie tun Marx die zweifelhafte Ehre an, Marx als einen der ihren zu nehmen“ (ebd., 94), d.h. prüfen ihn in ökonomischer Hinsicht darauf, ob sich mit seinem Wertgesetz Gleichgewichtsmodelle der Volkswirtschaft verbessern und Messgrößen daraus ableiten lassen; oder messen seine Erklärung der Klassen soziologisch an dem Ideal einer Beförderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. In beiden Fällen ist bei Marx eindeutiges Theorieversagen zu konstatieren. Die andere Variante, bei ihm begrenzte Einsichten und Befunde aufzufinden, ist aber auch nicht besser. Da wird aus der Kritik des notwendig falschen Bewusstseins ein interessanter Impuls, wissenssoziologisch die Funktionalität des gesellschaftlichen Seins fürs Bewusstsein (und umgekehrt) zu thematisieren, während Popper seine eigene methodologische Umdeutung von Theorie zu einem Instrument der Vorhersage zunächst in die Marxschen Schriften hineinliest, um dann dort eine mangelhafte Realisierung dieses Programms aufzudecken. Dabei hält er auch explizit als Vorwurf fest, dass die von ihm konstruierte und Marx unterschobene „historizistische Denkmethode“ bei denjenigen Unheil anrichte, „die die Sache der offenen Gesellschaft zu fördern wünschen“ (Popper, zit. nach ebd., 107). „Der Mann der Wissenschaft“, resümieren Decker und Co. (ebd.), „sieht sich hier plötzlich herausgefordert, aus sittlicher Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen zu sprechen, dem er den Ehrentitel ‚offene Gesellschaft‘ verleiht – womit er seine Hochachtung vor diesem Gemeinwesen ohne die geringsten wissenschaftlichen Skrupel zu dessen wesentlichem Merkmal erhebt!“ Bei Gelegenheit bekennen sich eben Marx-Experten aus dem bürgerlichen Betrieb – siehe oben das SZ-Zitat aus dem Jahr 1998 – offen zu ihrer Parteilichkeit für die kritisierte Produktionsweise und gegen den Kritiker Marx.
Wer übrigens eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie sucht oder sich überhaupt die Frage stellt, warum er etwas von Marx lesen sollte, kann dazu auf Vorträge von Freerk Huisken, ehemals Professor für Politische Ökonomie des Bildungswesens an der Universität Bremen, zugreifen. Huisken hat Anfang 2017 in der Universität Bielefeld einen Vortrag „150 Jahre ‚Das Kapital‘ von Karl Marx“ gehalten. Diese aktuelle Veranstaltung, die eine „etwas andere Einführung in die Kritik von Geld und Ware, Eigentum und Tausch“ bot, da sie nicht von den Marxschen Schriften, sondern von Grundsachverhalten des marktwirtschaftlichen Lebens ausging, ist zwar nicht im Netz dokumentiert. Doch dafür sind dort frühere Vorträge greifbar, z.B. zur Kritik an Geld und Ware unter: https://soundcloud.com/user-443222824/eigentum-ware-geld-und-tausch-freerk-huisken. Oder zu „Arbeit und Reichtum“ die „etwas andere Einführung in die Kritik des Kapitalismus“, die bei YouTube einsehbar ist: https://www.youtube.com/watch?v=pHOb9NN1qUc. Weitere einführende Vorträge zu Marx von Huisken, Decker u.a. finden sich auf der Dokumentationsseite von Argudiss (Rubrik: Arbeit und Kapital): https://www.argudiss.de/AuK.
Literatur
- Elmar Altvater, Marx neu entdecken – Das hellblaue Bändchen zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. 2. Aufl., Hamburg 2015.
- Ingrid Artus u.a., Marx für SozialwissenschaftlerInnen – Eine Einführung. Wiesbaden 2014.
- F. Bernhardt/R. Gospodarek, „Marx is back“ – zur Aktualität seiner Analysen. In: Hamburger Lehrerzeitung der GEW, Nr. 3-4, 2017, S. 47-49, online: https://www.gew-hamburg.de/sites/default/files/download/hlz/magazin_rezension_3-4-2017.pdf.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), 150 Jahre ‚Das Kapital‘ und seine bürgerlichen Rezensenten: Der Marxismus – zu Tode interpretiert, vereinnahmt, bekämpft. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2017, S. 93-109.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Das kommunistische Manifest – Ein mangelhaftes Pamphlet – aber immer noch besser als sein moderner guter Ruf. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 1998, S. 159-190. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/1998/2/gs19982159.html.
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx Engels Werke, Band 23, Berlin 1977 (zit. als MEW 23).
- Ernst Theodor Mohl u.a., Folgen einer Theorie – Essays über ‚Das Kapital‘ von Karl Marx. Frankfurt/M. 1967.
- Oswald von Nell-Breuning, Katholische Marx-Renaissance? In: O.v.N.-B., Auseinandersetzung mit Karl Marx, München 1969, S. 39-56.
- Michael Quante/David P. Schweikard (Hg.), Marx-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2016.
- Fritz Reheis, Wo Marx Recht hat. 3. Aufl., Darmstadt 2016.
- Johannes Schillo (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie. Hamburg 2015.
- Johannes Schillo, Marx ist wieder da! Zur Aktualität einer verdrängten Theorie. In: Auswege-Magazin, April 2017, online: http://www.magazin-auswege.de/data/2017/04/Schillo_Marx_ist_wieder_da.pdf.
- Georg Schuster, Bücher für die Flughafenbuchhandlung? Und weitere Fragen (Teil 1): „Postkapitalismus“, „Ende des Eigentums“ und „kollaboratives Gemeingut“. In: Auswege-Magazin, April 2017, online: http://www.magazin-auswege.de/data/2017/04/Schuster_Postkapitalismus_Teil_1.pdf.
Internet
150 Jahre Das Kapital – Das Kapital in der Kritik: https://www.uni-oldenburg.de/marxforschung/ („Anlässlich des 150. Jahrestags des Erscheinens von Das Kapital haben Mitglieder des Instituts für Philosophie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg das Forum für Marx-Forschung Oldenburg gegründet. Dieses Forum nimmt einen neuen Anlauf, um in der Alma Mater jenes politisch brisante Buch zum Gegenstand wissenschaftlicher Debatten zu machen.“)
März
„Die globale Ordnung aktiv mitgestalten“
2016 ist das neue Weißbuch der Bundeswehr erschienen, mit dem die Bundesregierung – nach zehn Jahren Pause – die Reihe ihrer sicherheitspolitischen Selbstdarstellungen fortsetzt. Die Zeitschrift Gegenstandpunkt (1/17) hat das Dokument einer Analyse unterzogen. Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
Verteidigungsministerin von der Leyen legte der Öffentlichkeit am 13. Juli 2016 das Weißbuch 2016 der Bundesregierung vor, nachdem zuvor das Bundeskabinett das oberste deutsche Grundlagendokument zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr beschlossen hatte (verfügbar auf der Website des Verteidigungsministeriums, Adresse siehe unter Literatur). Die Bundesregierung gehe mit dieser Veröffentlichung neue Wege, nachdem sich seit dem letzten Dokument aus dem Jahr 2006 „die Sicherheitslage deutlich verändert“ habe, erklärte die Ministerin (Pressemeldung des BMVg vom 13.7.2016). Das sicherheitspolitische Umfeld sei seither durch eine „nie gekannte Dichte und Parallelität der Krisen“ geprägt. Dieser veränderten Lage trage das neue Weißbuch Rechnung; es sei „erstmals und von Beginn an in einem breiten, transparenten und offenen Prozess entstanden – unter Federführung des Verteidigungsministeriums und im Konsens aller Ministerien der Bundesregierung… Auch die internationalen Partner Deutschlands seien involviert worden.“ (PM BMVg)
Mit der internationalen Partnerschaft ist das allerdings so eine Sache, speziell seitdem in den USA der neue Präsident regiert. Das zeigte sich bereits Ende 2016, kurz nach der Wahl. Russia Today kommentierte: „Der designierte US-Präsident Donald Trump ist noch nicht im Amt. Er hat noch keine einzige außenpolitische Entscheidung getroffen. Doch diesseits des Atlantiks wird schon postfaktisch über eine neue Weltordnung fantasiert – mit Deutschland als Weltmacht.“ (RT deutsch, 29.11.2016). Die FAZ z.B. stellte bereits zum diesem Zeitpunkt Gedankenspiele an, die bis dato als undenkbar Geltendes in Betracht zogen: „Höhere Ausgaben für die Verteidigung, die Wiederbelebung der Wehrpflicht, das Ziehen roter Linien – und das für deutsche Hirne ganz und gar Undenkbare, die Frage einer eigenen nuklearen Abschreckungsfähigkeit, welche die Zweifel an Amerikas Garantien ausgleichen könnte.“ (FAZ, 27.11.2016) Nach der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar 2017 hat sich das bestätigt: Deutschland muss aufrüsten und mehr Verantwortung übernehmen, so der breite Konsens, und unter Fachleuten werden weiterhin Gedankenspiele in Richtung deutsche Atombombe angestellt.
„Der bessere Imperialist“
Theo Wentzke, Redakteur der marxistischen Zeitschrift Gegenstandpunkt (GS), resümierte Anfang des Jahres 2017 die GS-Analysen zu „Merkels Land“ sowie zum Verhältnis von deutscher Aufstiegs- und amerikanischer Aufsichtsmacht in dem Essay „Der bessere Imperialist“ (Wentzke 2017). Der Titel zielte auf die Selbstdarstellung der Nation: „Deutschland mischt sich mit Scheckbuch und Militär in sämtliche Affären von Geschäft und Gewalt auf der Welt ein und rühmt sich für seine angebliche moralische Vortrefflichkeit im Umgang mit den Flüchtlingen“ (ebd., 12). Aus der ökonomischen Stärke, die sich Deutschland mit der „Austerität“ gegenüber seiner arbeitenden Bevölkerung erwirtschaftet hat, erwächst, so Wentzke, der Anspruch auf eine Führungsrolle in Europa, die sich aber nicht in diesem Rahmen erschöpft, sondern weltweit auf die vom „Westen“ gesetzten Geschäftsbedingungen achten, also „Verantwortung übernehmen“ will. Mit dieser pfäffischen Phrase drückte der ehemalige Bundespräsident Gauck auf „seine Weise aus, dass der Segen, den diese Geschäftsordnung stiftet, nur durch allgegenwärtige Gewalt zu haben ist. Und militärisch ist Deutschland dank der Kriegsallianz sehr potent.“ (Ebd., 13)
Die Allianz, die NATO unter Führung der USA, ist – bislang – die Grundlage der deutschen Militärmacht und erlaubt es dieser, permanent über ihre Verhältnisse zu leben, z.B. in der Ukraine eine Konfrontation aufzumachen, um Russland eine Einflusszone zu entziehen und dem eigenen, europäischen Einflussbereich zu „assoziieren“. Der Machtgebrauch laboriert allerdings an einem Widerspruch, der sich nicht erst seit dem Auftreten von US-Präsident Trump bemerkbar macht, jetzt allerdings eine neue Zuspitzung erhält: die Tatsache einer geliehenen militärischen Wucht, über die man nur bedingt verfügt. Die spezielle Lage, der Zustand, dass eine Nation militärisch für mehr einsteht, als sie selber vermag, ist Thema einer ausführlichen Analyse, die der Gegenstandpunkt jetzt zum aktuellen Weißbuch der Bundeswehr vorgelegt hat. In einem ersten Teil geht der Text auf den Widerspruch globaler deutscher Sicherheitspolitik ein und analysiert einerseits die amtliche Fassung des deutschen Sicherheitsbedarfs, andererseits den Werdegang der westlichen Allianz, mit der sich die Mitglieder des „freien Westens“ nach dem Triumph über ihren weltpolitischen Kontrahenten im Osten zu einer zersetzenden Konkurrenz um den Zweck ihres Bündnisses vorgearbeitet haben. Ein umfangreicherer zweiter Teil hat die Haupt- und Nebenwirkungen der „neuen Weltordnung“ Amerikas vor dem von Trump angekündigten Umschwung zum Gegenstand. Er bilanziert erstens den Umgang mit dem Problemfall Russland, zweitens mit den Regionalmächten in näherer und weiterer Umgebung (Israel, Türkei, Saudi-Arabien) – „zu ehrgeizig für die ihnen zugewiesenen Funktionen, zu potent für ihre wirksame Kontrolle, kontraproduktiv beim autonomen Gebrauch ihrer Gewalt“ – und drittens mit dem Zerfall von Staatlichkeit, den die Aufsichtsmächte als „imperialistischen GAU“ in den Ländern des Südens konstatieren.
Die Frage danach, ob und inwiefern man es hier mit einem imperialistischen Anspruch zu tun hat, ist der Ausgangspunkt der Analyse. Sie verweist für ihr Urteil nicht auf die Machenschaften von Monopolkapital oder militärisch-industriellen Komplexen, die als Kriegstreiber im Hintergrund der offiziellen Politik zu vermuten wären, sondern nimmt deren Anspruchshaltung beim Wort. Das Stichwort lautet „Abhängigkeit“. Damit bezeichnen die Weißbuch-Autoren die Tatsache, dass eine weltweit engagierte kapitalistische Nation, die erfolgreich andere Länder für Handelsgeschäfte, Investitionen und Finanzspekulationen benutzt, Besitzstände erwirbt, sie aber nicht einfach in der Hand hat. Das heißt: „Der deutsche Souverän hat entscheidende Bedingungen des Erfolgs seiner Ökonomie und damit seiner Macht nicht unter seiner hoheitlichen Kontrolle, und dabei kann es nicht bleiben. Sicherheitspolitisch gefordert ist ein Äquivalent zu seinem Gewaltmonopol im Innern für sein Außenverhältnis, eine Verfügungsmacht nicht im technischen Sinn über irgendwelche ‚Verkehrswege‘ und ‚Informationssysteme‘, sondern über die alles entscheidende politische ‚Rahmenbedingung‘: die auswärts zuständigen Staatsgewalten; und das nicht bloß im Hinblick auf irgendwelche Abmachungen und ein berechnendes Entgegenkommen der Kollegen, sondern – es geht ja um Sicherheitspolitik – im Sinne einer unkündbaren Verpflichtung auswärtiger Souveräne auf Regeltreue überhaupt. Aus dem ganz kurzen Schluss vom ökonomischem Welterfolg auf Abhängigkeit der Nation folgt der Auftrag der Regierung an sich selbst, die Staatenwelt auf die Respektierung ihrer Funktion als Mittel deutschen Reichtums und deutscher Macht festzulegen. Mit fremden Souveränen kann und will die deutsche Nation dann, aber auch nur dann gut leben, wenn Sicherheit darüber herrscht, dass die international institutionalisierten Regeln, nach denen jedes Land – auch – deutschem Kapital zur Benutzung offen steht, als Prämisse jedes souveränen Machtgebrauchs anerkannt sind.“ (Decker 2017, 34)
Das NATO-Bündnis versteht und präsentiert sich als Wertegemeinschaft. Mit dieser Idealisierung wird von dessen Machern nicht einfach geleugnet, dass es den beteiligten Kapitalstandorten um materielle Werte geht, die sie sich im auswärtigen wirtschaftlichen Verkehr anzueignen versuchen. Auf diese Weise wird vielmehr der grundlegende Sachverhalt ausgedrückt, dass der damit gegebene sicherheitspolitische Bedarf der einzelnen Nationen ein Regelsystem, eine absolut gültige internationale Rechtsordnung notwendig macht, die die Bedingungen des Geschäftsverkehrs prinzipiell festlegt und nicht fallbezogen einzelne Affären „befriedet“. Insofern griff z.B. der Protest gegen die Münchner Sicherheitskonferenz 2017 mit seinem Angriff auf das „Kriegsbündnis NATO“ etwas daneben: „Die NATO-Staaten schützen Handelswege statt Menschenrechte“, hieß es im Aufruf „gegen die NATO-Kriegstagung“ (Aktionsbündnis 2017). Aber schon die letzten Kriege in Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien kann man nur schwer unter die Rubrik vom Schutz des Handels einsortieren. Natürlich ging und geht es hier um eine Region, die für Förderung und Abtransport eines wichtigen Rohstoffs von Bedeutung ist. Sie wird jedoch vom modernen Imperialismus, der ja keine Eroberungskriege für ein Kolonialreich mehr führt, deshalb ins Visier genommen, weil dortige Souveräne sich an der vom Westen gültig gemachten Geschäftsordnung vergehen: also an einem Recht, das auch die Menschenrechte – von Freiheit, Gleichheit, Eigentum bis zur Gewährleistung des Parteienpluralismus – als Herrschaftsprinzipien eines demokratisch verwalteten Kapitalismus einschließt.
Der sicherheitspolitische Dienst an der supranationalen Ordnung ist selbstverständlich kein selbstloser Einsatz um der Ordnung willen, sondern kennt ein interessiertes Subjekt, einen Urheber, nämlich die USA, die auf die Benutzung der Welt aus sind und denen sich wiederum die Mitmacher, darunter die BRD an prominenter Stelle, zuordnen. Der Zusammenschluss der Mitglieder hat seine historischen Gründe – als Ergebnis von Weltkrieg Nr. 2 und des Eintritts in einen Kalten Krieg – und einen aktuellen Verlauf, der aus dem Erfolg beim Niederringen des Gegners mittlerweile eine prekäre Situation, nämlich die Infragestellung der seltsam dauerhaften Einheit eines imperialistischen Kollektivs gemacht hat. Der Zersetzungsprozess, den die Mitglieder betreiben, aber gleichzeitig vermeiden wollen, ist im Weiteren Hauptgegenstand der Analyse von Decker und Co. Sie bezieht sich dabei, wie erwähnt, auf die großen Herausforderungen, mit denen sich die BRD konfrontiert sieht und die gar nicht allein oder zuerst aus den geostrategischen Folgeproblemen der jeweiligen Fälle internationaler Abhängigkeit bestehen, sondern ganz generell in der Relativierung der Bündnissolidarität, die mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes begann und die die US-Führungsmacht seit Trump rücksichtslos ansagt. Der neue Präsident stellt nämlich gerade die Unverbrüchlichkeit der Einheit zur Disposition, d.h. unter den Vorbehalt, dass der amerikanische Nutzen den Ausschlag gibt, dass somit keine supranationale Vereinbarung per se als Wert gilt. „Insofern mögen die – ohnehin sehr vagen – Handlungsperspektiven des Weißbuchs obsolet sein; die herrschende ‚Lage‘, auf die sich seine Bedrohungsdiagnosen in aller nationalen Voreingenommenheit beziehen, ist es nicht. An der muss die nationale Sicherheitspolitik sich nach wie vor abarbeiten; nur muss sie sich dabei nun außerdem zur US-Politik des ‚America First‘ ins Verhältnis setzen.“ (Decker 2017, 44)
Die besserungsbedürftige Schutzmacht
Die Bundesregierung konstatiert in dem Weißbuch aus sicherheitspolitischer Warte – aber noch vor der jüngsten Verunsicherung, die von der neuen US-Führung ausgeht – eine Welt „im Umbruch“ (Weißbuch 2016, 28). Heute stehe die Bundeswehr „einer nie da gewesenen Parallelität und Größenordnung von Krisen und Konflikten gegenüber“ (ebd., 137). Dies mag einem Publikum, das sich vom Sorgestandpunkt seiner Regierung leiten lässt, wie eine realistische Bestandsaufnahme erscheinen. Und sogar aus der Linkspartei, z.B. vom ehemaligen MdB Paul Schäfer, von 2005 bis 2013 Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss sowie ihr verteidigungs- und abrüstungspolitischer Sprecher, wurde diese Politrhetorik, die seit dem Ende des Ostblocks im Schwange ist, positiv aufgenommen (zur Kritik daran siehe Zimmermann 2015). „In einer aus den Fugen geratenden Welt“ (Schäfer 2014) müsse auch linke Außenpolitik konstatieren, dass Deutschland – wie von Bundespräsident Gauck und Regierungsvertretern 2014 proklamiert – mehr Verantwortung für das globale Geschehen zu übernehmen habe. Schäfer teilte zudem die Gaucksche Beurteilung, dass sich (West-)Deutschland seit der Nachkriegszeit einer „Kultur der Zurückhaltung“ befleißigt habe (ebd., 18), es sei bislang „'niedriges Profil' angesagt“ gewesen (ebd., 9). Nun aber, angesichts der Umbrüche, sei Deutschlands Rolle in der Welt gefragt, „die globalen Zwänge zur Regulation und Kooperation nehmen zu.“ (Ebd., 241) Hier müsse die Linke in ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis ihre spezielle friedenspolitische Kompetenz einbringen, eine bloße Verweigerungshaltung führe nicht weiter: „Ausgangspunkt einer Regierungsalternative muss ein alternatives Programm sein. Das heißt nicht, dass mit einer solchen Veränderung alle Grundkonstanten deutscher Außenpolitik in Frage gestellt werden sollen. Niemand kann die gewachsenen Bündnisbeziehungen … aufs Spiel setzen wollen“, so Schäfer (ebd., 263f).
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Bundestagsfraktion der Linken legten aus Anlass der Weißbuch-Veröffentlichung ein Schwarzbuch (RLS 2016) vor, das erfreulicher Weise dem Anschlussbedürfnis, wie es von Schäfer geäußert wurde, gleich eingangs einen Dämpfer erteilt. Die dramatisch klingende Diagnose vom Umbruch etc. bediene sich eines Kunstgriffs, heißt es dort. „Die Bundesregierung tut so, als handele es sich um einen der Bundeswehr von außen aufgezwungenen Sachverhalt. Tatsächlich haben sich Kriege und Krisenherde der deutschen Armee nicht aufgezwungen. Seit rund 25 Jahren werden deutsche Soldaten systematisch in Kriege und Krisengebiete entsandt. Das Weißbuch hat die Aufgabe, diesen Kurs als alternativlos darzustellen.“ (RLS 2016, 2) Die Bilanz dieser Militäreinsätze bildet dann einen Schwerpunkt des regierungskritischen Schwarzbuchs. „Hierbei liegt der Fokus auf der Divergenz zwischen dem selbst gesetzten Anspruch der Bundeswehr an ihre Einsätze und der tatsächlichen Kriegswirklichkeit, wie sie vor allem Zivilisten in den betroffenen Ländern erleiden müssen“, kommentierte Anne Geschonneck in der Jungen Welt (Geschonneck 2016). Die Kommentatorin kam dabei auch auf die Schwachstelle einer solchen antimilitaristischen Kritik zu sprechen, die – nach dem eigentlich vielversprechenden Einstieg – dann doch nicht so viel zu bieten habe:
„Ihrer selbstgestellten Aufgabe, die Ablehnung gegen den Krieg argumentativ zu unterfüttern, wird die Publikation vor allem durch die zahlreichen detaillierten Aufschlüsselungen etwa in bezug auf die Kosten verschiedener Rüstungsgüter oder dem Aufzeigen von Interventionsmöglichkeiten im Alltag gerecht. Erwartet man jedoch eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem ‚Weißbuch‘, so fällt der direkte Bezug auf dieses Strategiepapier mitunter recht spärlich aus… Die Politik der Bundesregierung als imperialistische zu enthüllen, dieser Schritt wird in der Broschüre nicht unternommen. Ob nun um den Begriff Imperialismus herumgeschlichen wird, weil potentielle Leser nicht verschreckt werden sollen, oder die Autoren selbst diese politische Einschätzung nicht teilen, kann nur vermutet werden. Will man jedoch eine klare Stellung gegen Krieg und Aufrüstung beziehen, sollte man vom Imperialismus nicht schweigen.“ (Ebd.) Diese Beurteilung ist zutreffend, auch wenn sie mit einem eigenartigen Lob für die sonstigen Informationsleistungen der RLS-Publikation, z.B. über die Militärausgaben und deren rationellen Einsatz, verbunden ist. Derartige Überprüfungen der Mittelverwendung sollte man lieber dem Bundesrechnungshof überlassen, und die Ratschläge des Schwarzbuchs für Interventionsmöglichkeiten, die auf vier Seiten Ideen für Aktionen liefern (RLS 2016, 98-101), dienen weniger der Aufklärung, sondern fallen unter die Rubrik Motivation oder Animation.
Dass die Kosten der Rüstungsgüter, der Öffentlichkeitsarbeit, der Modernisierungsinitiativen, der militärischen Sportförderung etc. hier in kritischer Absicht aufgelistet werden – im Unterschied übrigens zum offiziellen Weißbuch, das sich nicht detailliert zu den einzelnen Posten äußert, was Kritiker gerne monieren („fehlen alle relevanten Kennziffern…“, Seifert 2016, 10) –, liegt auch daran, dass das Schwarzbuch eine eigenartige Beweisabsicht verfolgt: Es will die Ineffizienz militärischer „Krisenprävention“ herausstellen. Dafür lässt sich sogar der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, zitieren (ebd., 2), der mit den Erfolgen der letzten Jahre auch nicht zufrieden ist. Die Einsätze wären nicht „nach Lehrbuch“ abgelaufen, hört man z.B. von ihm. Daraus schlussfolgern die Schwarzbuch-Autoren, dass den intervenierenden Groß- und Regionalmächten zwischen 2013 und 2016 die „Kontrolle … entglitten“ sei; „die militärischen Interventionen haben eine Eigendynamik angenommen“ (ebd.). Das ist eine eigenartige Betrachtungsweise. Zwar kann man den Äußerungen der Politiker und Sicherheitsexperten entnehmen, dass – aus dem jeweiligen nationalen Blickwinkel betrachtet – nicht alles nach Plan läuft, was sie im Nahen Osten oder in Osteuropa angerichtet haben. Die Vorstellung aber, man müsste die Politik darauf aufmerksam machen, dass sie sich kostspieliger, ineffizienter Instrumente bei Krisenprävention und Konfliktmanagement bedient, geht an der Sache vorbei – nämlich, wie vom JW-Kommentar bemerkt, am imperialistischen Charakter der Politik.
Das zeigt sich auch im Schlussteil des Schwarzbuchs. Er führt die – noch – gültige Grundsatzposition der Linken aus dem Erfurter Programm an, in dem die Partei für „Gewaltfreiheit“ und die „Idee des gerechten Friedens“ eintritt; dem folgen knapp 20 Positionsbestimmungen oder Forderungen, wie sie mit ähnlicher Tendenz die AG Sicherheitspolitik der Linksfraktion im Bundestag formuliert hat (vgl. Buchholz u.a. 2016). Der erste Punkt lautet: „Zentrale Forderung friedenspolitischer Kräfte wie auch der Partei DIE LINKE ist die Beendigung aller Auslandseinätze der Bundeswehr. Das betrifft die Beteiligung an Einsätzen im Rahmen von NATO und EU und in ‚ad-hoc-Kooperationen‘ wie sie im Weißbuch vermehrt angekündigt werden. Darüber hinaus werden von der LINKEN perspektivisch die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands gefordert, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat.“ (RLS 2016, 103) Die Auflösung der NATO wird hier als „perspektivisches“ Ziel bezeichnet. Was das heißt, kann man in dem Sammelband von Schäfer nachlesen, in dem auch Experten aus der SPD oder der grünen Partei schreiben (vgl. Zimmermann 2015): Es ist ein Fernziel, das zunächst einmal und bis auf Weiteres von der Fortexistenz des Militärbündnisses als einer realpolitischen Gegebenheit ausgeht – was noch vorbehaltlich möglicher Koalitionsverhandlungen gilt, in denen die Linke mit ihrer „perspektivischen“ Maximalposition auf die rot-grünen Partner stoßen und natürlich zum Kompromiss genötigt würde. Ein bemerkenswertes Argument, das Schäfer als Vertreter des realpolitischen Parteiflügels vorträgt, lautet in dem Zusammenhang: „Wer Widerspruch zu illegitimen Gewaltinterventionen der NATO anmelden möchte…, wird das ernsthaft nur als Vollmitglied tun können.“ (Schäfer 2014, 259)
Die letzte Forderung bzw. Feststellung des Schwarzbuch-Katalogs lautet: „Zur Bekämpfung von Konfliktursachen ist eine solidarische Weltwirtschaftsordnung unabdingbar, die nachhaltige Entwicklungsperspektiven für alle schafft und globale und soziale, ökologische und demokratische Rechte durchsetzt.“ (RLS 2016, 105) Die real existierende Weltwirtschaft wird hier mit einem gängigen Ideal konfrontiert, wie es eigentlich alle aufstrebenden nationalen Souveräne unterschreiben könnten (wenn sie nicht wüssten, dass es von den Linken stammt): Global Governance nicht hegemonial-unipolar, sondern demokratisch-multipolar aus den jeweiligen Völkerschaften hervorgegangen, auf den Schutz von Heimat, Natur und sozialen Zusammenhang orientiert – das alles, damit sich wirkliche (das meint wohl „nachhaltig“) Entwicklungsperspektiven ergeben, die sich von dem bekannten, seit Jahrzehnten gehandelten Schlagwort „Entwicklung“ abheben und so die unbezweifelbare Güte des Vorhabens in die Welt hinausposaunen. Und es ist speziell die Tonlage, wie sie zu einer Nation passt, die sich als der „bessere Imperialist“ versteht.
Mit Trump ändert sich jetzt die NATO, was aber nicht heißt, dass die oben vorgestellt Analyse über den „besseren Imperialisten“ revidiert werden müsste. „Die Wahl Trumps wird genutzt“, schrieb die UZ (Landefeld 2016), „um die in der BRD anstehende massive Erhöhung der Rüstungsausgaben als ‚Festhalten an den Werten und Prinzipien‘ des Westens zu verklären“. Dem ist insofern zuzustimmen, als Deutschland im neuesten „Umbruch“ die Gelegenheit sieht, seine Rolle als militärischer Verantwortungsträger auszubauen. Dieser Anspruch ist nicht das Produkt der aktuellen Zwangslage, sondern ergibt sich aus dem tatkräftigen Mitmischen Deutschlands in Weltwirtschaft und Weltpolitik. Das Umgehen mit außenwirtschaftlichen und -politischen Herausforderungen – diese Wahrheit liefern die Weißbuch-Autoren aus amtlicher Perspektive – hat einen gewaltträchtigen Charakter. Da ist es merkwürdig, dass friedensbewegte Kritiker eine unnötige Eskalation ausmachen: „Bedrohungsszenarien, wie sie auch dieses Weißbuch hinter jedem Baum und Strauch hervorzaubert, sind nicht hilfreich, die Probleme der Welt wirklich anzugehen.“ (Seifert 2016, 13) So kommt der Vorwurf der Militarisierung ins Spiel: Die Regierung setzt einfach zu sehr auf militärische Gewalt, statt dass sie andere Möglichkeiten der Einflussnahme in Betracht zieht und erprobt. Mehr Verantwortung könnte demnach genau so gut heißen, mit nicht-militärischen Mitteln für eine „Befriedung“ der Konfliktherde zu sorgen – eine Idee, die auch schon von der Bundesregierung kam. Diese wird ja eventuell demnächst die Kosten für Entwicklungshilfe und anderes in die Rüstungsausgaben einbeziehen, um das in der NATO vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen…
Andere Kritiker bemängeln die vom Weißbuch vorgenommene Sortierung in Problemstaaten und Problemfälle, speziell etwa im Blick auf Russland. Dazu hatte ja das Weißbuch von 2006 noch formuliert, es gelte, „eine dauerhafte und belastbare Sicherheitspartnerschaft mit Russland zu entwickeln und zu vertiefen“ (zit. nach Henken 2016). Hier entwirft das neue Dokument natürlich ein deutlicheres Bedrohungsszenario, das vielen Kommentatoren als überzeichnet erscheint. So werden alternative Bündnisideen ins Spiel gebracht. Oder es kommt Kritik an der Ausweitung der Kampfzone, die das Weißbuch ankündigt und die bereits zu einem neuen Organisationsbereich der Truppe namens „Cyber und Informationsraum“ geführt hat, der Heer, Marine und Luftwaffe sowie dem Sanitätsdienst gleichgestellt ist (dazu gibt es ebenfalls eine Analyse in Gegenstandpunkt 1/17). Kritikern leuchtet die neue Cyberfront ein, sie wälzen dann aber das Problem, ob sich nicht die naturgemäß heimlichen Operationen im Internet einer parlamentarischen oder überhaupt einer politischen Kontrolle entziehen (Reinhold 2016, 18). Dazu gibt es dann konstruktive Vorschläge: „Statt die Cyber-Sicherheit zu militarisieren, sollte das BSI gestärkt werden“ (ebd., 20). Statt dem Militär soll also das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik (BSI), einer der zahlreichen deutschen Geheimdienste, aufgewertet werden. Eine sehr zivile Alternative! Alles in allem spürt man gerade auch bei Kritikern das Bemühen, Deutschland als eine besserungsbedürftige und -fähige Weltmacht vorzuführen.
Literatur
- Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz 2017, Aufruf: Frieden statt NATO, Nein zum Krieg, online: www.sicherheitskonferenz.de.
- Christine Buchholz, Katrin Kunert, Alexander Neu, Ein Weißbuch für Aufrüstung und Krieg – Stellungnahme der AG Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion DIE LINKE zum Weißbuch 2016. 13. Juli 2016, https://www.die-linke.de/nc/die-linke/nachrichten/detail/artikel/ein-weissbuch-fuer-aufruestung-und-krieg/.
- Peter Decker u.a., Anmerkungen zum „Weißbuch 2016 Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ – Anspruch und Drangsale des deutschen Imperialismus. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2017, S. 33-64.
- Anne Geschonneck, Nicht vom Imperialismus schweigen – Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung kritisiert „Weißbuch“ der Bundeswehr. In: Junge Welt, 7.11.2016.
- Lühr Henken, Das neue Weißbuch 2016. Bundesausschuss Friedensratschlag, 11. Runder Tisch, Berlin 24.6.2016, Impulsreferat, online: http://www.friedensratschlag.de/userfiles/html/2016/2016-06-24_Henken_Weissbuch.html.
- Beate Landefeld, Imperialistische Widersprüche in der EU – Militarisierung findet auch künftig im Rahmen der NATO statt. In: Unsere Zeit, 9.12.2016.
- Thomas Reinhold, Die Bundeswehr zieht ins Cyberfeld. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 7, 2016, S. 17-20.
- RLS, Schwarzbuch – Kritisches Handbuch zur Aufrüstung und Einsatzorientierung der Bundeswehr. Herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Berlin 2016. Bezug: RLS, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Download: kurzlink.de/schwarzbuch.
- Paul Schäfer (Hrsg.), In einer aus den Fugen geratenden Welt – Linke Außenpolitik: Eröffnung einer überfälligen Debatte. Hamburg 2014.
- Andreas Seifert, Bittere Pille für den Frieden? Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr. In: Ausdruck, hg. von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., Nr. 4, 2016, S.10-13. Online: http://www.imi-online.de/2016/.
- Weißbuch 2016 – Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. Hg. vom Bundesministerium der Verteidigung, Berlin 2016. Online erhältlich unter: www.bmvg.de.
- Theo Wentzke, Der bessere Imperialist. In: Junge Welt, 9.2.2017, S. 12-13, online: https://www.jungewelt.de/2017/02-09/126.php.
- Sabrina Zimmermann, Linke Außenpolitik. IVA-Website, Texte, Juni 2015.
Das rechte Weltbild: Beispiel FPÖ
Im März 2017 ist das Buch „Die FPÖ – Blaupause der neuen Rechten in Europa“ von Herbert Auinger erschienen, der bereits 2000 ein Porträt des ehemaligen FPÖ-Frontmanns Jörg Haider veröffentlichte. Zu der Neuerscheinung eine Information der IVA-Redaktion.
Üble Nachrede erfahren die rechten Bewegungen und Parteien in Europa zuhauf. Von „Wut-“ und „Furchtbürgern“, von einer „Regression der Moderne“ oder einer „Krise der politischen Repräsentation“, von dem „neuen Hass aufs Establishment“ und der „Sehnsucht nach dem Feind“, von der puren Absage an Politik zugunsten der Emotion und des Ressentiments ist unter Experten die Rede – von einer brandgefährlichen Radikalisierung sowieso, die mit ihrem „Populismus“ und „Extremismus“ zu Rassismus und letztlich zu einem neuen Faschismus führe. Oder führen könnte, wenn sich nicht alle guten Demokraten dieser Entwicklung entgegenstemmen, wenn sie nicht „den Anfängen wehren“, die sich seltsamer Weise, auch ein knappes Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des historischen Faschismus, immer wieder an allen Ecken des demokratischen Lebens bemerkbar machen. Dass die rechten Dunkelmänner, die Aktivisten des „Dunkeldeutschland“ (Gauck), Böses im Schilde führen, erfährt man regelmäßig und ausgiebig; was sie eigentlich politisch wollen, dagegen weniger bis gar nicht (vgl. Gutte/Huisken 2007, 44ff; Huisken 2012, 18ff; Loidolt 2013, 6ff).
Die NachDenkSeiten haben jüngst in der Einleitung zu einer AfD-Programmanalyse darauf aufmerksam gemacht, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit der rechten Alternative bislang äußerst dürftig verlaufen ist. Es werde nur pauschal kritisiert und den rechten Positionen einfach das Etikett „Populismus“ angeheftet. Solche Ausgrenzungstechniken hätten den „Vorteil, sich selbst in ein gutes Licht zu stellen: Dort sind die Bösen; wir sind die Guten. Das ist die emotionale Mechanik, die dabei abläuft.“ (Weikamp 2017, 1) Das trifft den Kern des Problems. Doch es bekümmert kaum jemanden, was bemerkenswerter Weise auch da gilt, wo mit Information und Aufklärung dem neuen Rechtstrend entgegengetreten werden soll. Rolf Gloël und Kathrin Gützlaff haben in ihrem Argumentationsleitfaden „gegen Rechts“ (2005, eine Neuausgabe ist für 2017 vorgesehen) darauf hingewiesen, dass selbst die politische Pädagogik, die sich mit dem Thema befasst, es fertig bringt, den politischen Inhalt auszuklammern. So bleibe es letztlich bei einer Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, in der „dieser nicht als ein verkehrter und schädlicher politischer Standpunkt begriffen (wird), dem entsprechende politische Überlegungen zugrunde liegen und dem man auf der Ebene kritisch-argumentativer Auseinandersetzung zu begegnen hätte, sondern als ein Verstoß gegen Sitte und Recht, der durch rechtsstaatliche Repression zu verfolgen sei“ (Gloël/Gützlaff 2005, 10).
Das Beispiel FPÖ
Der österreichische Publizist Herbert Auinger widmete 2000 Jörg Haider, dem ehemaligen Frontmann der „Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)“, eine Veröffentlichung, die eine „Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker“ liefern wollte. Das Porträt beließ es aber gerade nicht dabei, dem Mann Übles nachzusagen, stieg auch nicht, wie sonst in Abrechnungen mit dem FPÖ-Politiker durchexerziert, in biographische Abgründe hinab. Auinger nahm Haider als das, was er politisch war – als Emporkömmling in der demokratischen Parteienkonkurrenz, der mit den üblichen Themen (und ein paar speziellen Touren) die Schlammschlachten der Wahlkämpfe schlug, um nachher in Koalitionskungeleien ein Stück Macht zu ergattern. Im Endeffekt, so Auinger, bestand dann die regierungsoffiziell praktizierte Ausländerfeindschaft darin, die von der Vorgängerkoalition geplanten Gesetzesvorhaben auszuführen. Von faschistischer Machtergreifung war weit und breit nichts zu sehen, und neben der heimischen Protestszene beruhigte sich auch die EU wieder, nachdem sie mittels „Monitoring“ das ÖVP/FPÖ-Regime zunächst dem europäischen Verfassungsschutz unterstellt hatte.
Auinger wollte damit natürlich keine Entwarnung geben. Im Gegenteil. Seine Analyse zielte auf den Tatbestand, der in den Anti-Haider-Protesten kaum ins Blickfeld geriet, dass nämlich das Liebäugeln mit faschistischer Politik wie das kernige Bekenntnis zu ihren Idealen – also die spezielle Profilierungskunst des flotten Jörgl – mitten im demokratischen Betrieb ihren Platz finden. An Haider, so Auingers Hauptthese, hätte einem etwas ganz anderes auffallen können als die ewig beschworene Gefahr, der Demokratie drohe das feindliche Zersetzungswerk einer von außen kommenden faschistischen Unterwanderung: Mit dem freiheitlichen „Rechtspopulisten“ Haider wurde vielmehr aller Welt vor Augen geführt, dass sich demokratische und faschistische Herrschaft in puncto Rassismus, Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit brüderlich die Hand reichen können. Was die modernen Grundkonstanten Staat, Volk und Nation betrifft, klaffe zwischen den beiden „Formen bürgerlicher Herrschaft“ eben gar kein so großer Abgrund, wie Idealisten immer meinen. „Nicht Haider hat die Republik verändert, sie nach rechts bugsiert, sondern die frühere Koalition hat im Gefolge der weltpolitischen Wende und mit dem EU-Beitritt eine Inventur österreichischer Errungenschaften veranstaltet und ziemlich aufgeräumt. Die Umwälzung ihrer eigenen früheren Erfolge und Erfolgsrezepte lassen die ‚Altparteien‘ öfter schlecht aussehen und diejenige Opposition profitieren, die eintönig überall ‚Versager‘ und ‚Verräter‘ werken sieht, also die demokratischen moralischen Wahnvorstellungen über Politik bedient.“ (Auinger 2000, 197)
Auingers Streitschrift analysierte die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede und blieb zugleich bei der konkreten Sache – bei Haiders Sündenregister, das dem agilen Politiker zwar oft und erfolglos genug von aufgeregten Journalisten um die Ohren gehauen wurde, das aber kaum jemand systematisch der Kritik unterziehen wollte. Dass der flotte Law-and-Order-Mann Haider vor rund zehn Jahren stark alkoholisiert in einer 70-Stundenkilometer-Zone mit Tempo 142 gegen einen Betonpfeiler knallte, beendete zwar seine persönliche Karriere, nicht aber den Erfolg der von ihm vorangetriebenen rechten Bewegung. 2005 kam es zunächst zu einer Spaltung der FPÖ, als die bisherige Parteispitze inklusive Haider ihren Übertritt in das neugegründete „Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)“ bekanntgab. Nach Haiders Tod 2008 verkümmerte diese Neugründung, die FPÖ dagegen mauserte sich unter ihrem Vorsitzenden Heinz-Christian Strache zu einer erfolgreichen Oppositionspartei, die mittlerweile wieder in Landtagen mitregieren darf und die bei der Bundespräsidentenwahl Ende 2016 nur knapp den Sieg verfehlte. So lauten gegenwärtig auch schon Prognosen, dass die FPÖ unter Strache 2018 „bei den nächsten Nationalratswahlen stärkste Partei werden und den Anspruch auf das Kanzleramt erheben“ könnte (Heinrich 2017, 17).
Zu dieser (proto-)typischen europäischen Rechtspartei hat Auinger Anfang März 2017 seine Analyse „Die FPÖ – Blaupause der neuen Rechten in Europa“ vorgelegt. Wiederum wird hier nicht das gängige Verfahren praktiziert, die Positionen der Rechten an den etablierten demokratischen Vorstellungen zu messen bzw. an Positionen, die als „politisch korrekt“ gelten. Denn, so Auinger, „wer nicht schon vorher etwas gegen jenen Rechtsextremismus hatte, findet durch dieses Verfahren auch kaum Anhaltspunkte“ (Auinger 2017, 8). Stattdessen widmet sich das Buch der Aufgabe, die vermisste Leistung zu erbringen, das rechte Weltbild und das daraus folgende politische Programm inhaltlich unter die Lupe zu nehmen. Das Gedankengebäude der FPÖ ist ja längst zu einer ausgearbeiteten Weltanschauung geworden, zu einer umfassenden, vom Mainstream abweichenden Deutung von Individuum, Staat, Gesellschaft und Politik. Mit diesen Positionen befasst sich Auingers Studie ausführlich.
In den einzelnen Kapiteln geht es etwa um den Freiheitsbegriff der FPÖ, um die „Dreieinigkeit“ der angeblich natürlichen Daseinsformen von Volk, Nation und Familie sowie um das Begriffspaar „Heimat“ und „Identität“, zu dem „der Andere“, der auszugrenzende Ausländer oder Migrant, als der notwendige Kontrapunkt dazu gehört. Von zentraler Bedeutung im freiheitlichen Weltbild ist ferner der Begriff der „Souveränität“, die Unanfechtbarkeit der nationalen Machtausübung gegenüber einschränkenden Verpflichtungen von außen. Dabei geht die Analyse gleichzeitig der Frage nach, warum sich die FPÖ ganz selbstverständlich als Europa-Partei versteht – als Vorreiterin eines Europas der Vaterländer, das durchaus internationalen Charakter aufweisen soll, denn die Freiheitlichen sehen sich als dezidiert klassenübergreifende Kraft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, vereint im Kampf um den Kapitalstandort.
Bei Auinger wird also nicht das Problem verhandelt, in welche politologische (Unter-)Kategorie man die österreichische Rechtspartei einsortieren soll – ob sie eher zum „ethno-nationalistischen“ oder „zum national-liberalen Typ“ des Populismus gehört, wie Karin Priester (2016, 547) abwägt, ob Populismus erst dann vorliegt, wenn der „moralische Alleinvertretungsanspruch“ (Müller 2016, 28) erhoben wird, ob die FPÖ eher als Fall einer „Männerpartei“ (Geden 2004) zu betrachten ist oder ob man von einem komplexen „Oszillieren des österreichischen modernen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus“ sprechen muss (Dworczak 2006, 86). Es geht natürlich auch nicht darum, als eigentlichen Kern des Rechtspopulismus einen sozialen Protest auszumachen, wie es Joachim Bischoff und Bernhard Müller nahe legen: „Die neuen rechtspopulistischen Kräfte sind Ausdruck einer immer stärker werdenden Hoffnungslosigkeit gegenüber der Politik. Der Verzicht vonseiten der Regierungen, Macht gegenüber der Logik des Finanzmarktkapitalismus auszuüben, hat die Politik insgesamt bereits weitgehend delegitimiert, was im Rückzug der prekären Schichten aus der Sphäre der politischen Willensbildung besonders deutlich wird.“ (Bischoff/Müller 2016, 29)
Auingers Analyse geht, logischer Weise, vom Freiheitsbegriff der Freiheitlichen aus. Diese fügen, wie jeder Befürworter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch, dem Lob der Freiheit gleich deren grundsätzliche Einschränkung an – um schrankenlose Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung darf es ja keinesfalls gehen. Auf diese Weise würde nur das zersetzende Werk des „kulturellen Marxismus“ fortgesetzt, der die Menschen angeblich zu bindungslosen Atomen einer permissiven Gesellschaft freigesetzt hat. Der Freiheit des Einzelnen vorgegeben ist, so das rechte Weltbild, die Bindung ans nationale Kollektiv, an Volk und Volksgemeinschaft. Diese Einbindung werde schlicht und ergreifend von der Natur in Auftrag gegeben, vom Abstammungsverhältnis, also von der klassischen heterosexuellen, auf eigenen Nachwuchs angelegten Familie. Dem traditionellen Familienbild, das die Frauen gegen das modische Gender Mainstreaming wieder auf ihre primäre Mutterrolle festlegen will – „Gender ist Gotteslästerung“, heißt eine der einschlägigen Parolen (Speit 2017, 35) –, widmet das Buch daher das zweite Kapitel. Dem folgt drittens als Pendant die Heimat, die ebenfalls eine Naturbestimmung des modernen Staatsbürgers enthalten soll. In diesem Kapitel wird auch der Heimatgedanke ausführlich anhand seiner notwendigen Entgegensetzung expliziert – am Fremden, der kategorisch in der Heimat stört und nicht erst dann, wenn er sich in irgendeiner (sei es auch nur „gefühlten“) Weise störend bemerkbar macht. Die nachträgliche Bebilderung seines Störpotenzials – wirtschaftlich unnütz, illegal bis kriminell, religiös und ethnisch falsch gepolt – wird dann im Einzelnen der Kritik unterzogen.
Das leitet zum vierten Kapitel über, in dem die Fremdheit der Anderen in umgekehrter Richtung, nämlich von der Eigenheit der Eingeborenen ausgehend, zum Thema wird: Sprache, Kultur (inklusive Religion) und Geschichte sollen ja das Kollektiv so zusammengeschweißt haben, dass seine Mitglieder eine unverwechselbare, unaustauschbare nationale Identität aufweisen. Diesen Pseudobegründungen geht Auinger im Einzelnen nach. Darüber hinaus begutachtet er das eigenartige Konstrukt einer Identität, die – siehe oben – von Natur aus gegeben sein soll, die aber zugleich empirisch dauernd durch Abwesenheit glänzt. Die Freiheitlichen rufen ja gerade zu dem Kraftakt auf, die entwurzelten Massenmenschen durch eine machtvolle Indoktrination, pardon: wertorientierte Verpflichtung auf die nationale Bestimmung wieder zum Eigentlichen hinzuführen. Das Bild eines national selbstbewussten österreichischen Standortnationalismus, der sich europaweit und global seiner Verantwortung stellt, ist dann Gegenstand des fünften Kapitels. Hier kommen auch die Differenzen in und zwischen den europäischen Rechtsparteien zur Sprache: Soll man die Mitgliedschaft in der EU sofort und komplett oder schrittweise und abgestuft aufgeben? Welche Bündnisse und welche Partner lassen sich benutzen? Gibt es heutzutage wirklich eine „Internationale der Nationalisten“ und wie könnte diese funktionieren? Etc.
Das sechste und das siebte Kapitel („Rechter Tugendterror“, „Ein Heimattreuer sieht schwarz“) resümieren die Überlegungen im Blick darauf, wie vom FPÖ-Standpunkt aus die großartige Vergangenheit der österreichischen Nation – die, wie man es von der AfD in Deutschland kennt, nicht durch die unseligen zwölf bzw. sieben Jahre der NS-Zeit kompromittiert werden darf – und deren Zukunft – für die im Politikbetrieb immer eine entsprechende „Vision“ zur Verfügung stehen muss – ausgemalt und propagandistisch unters Volk gebracht werden. Drei Exkurse zur Entwicklung des Asylrechts seit dem Kalten Krieg (Auinger 2017, 60ff), zur Flüchtlingswelle des Jahres 2015 (ebd., 65ff) und zur europäischen Kriseneskalation (ebd., 123ff) vervollständigen das Bild. Sie gehen auch darauf ein, dass die österreichische Rechtsentwicklung sich an der Führungsrolle des Großen Bruders im Norden, d.h. der in Berlin regierenden schwäbischen Hausfrau abarbeitet. Merkel gilt der FPÖ einerseits als „kriminell“ (so FPÖ-Vorsitzender Strache, zit. nach Auinger 2017, 153). Andererseits setzt der österreichische „Zwergenaufstand“ gerade auf europäische Rückendeckung, also auf die bewährte deutsch-österreichische „Freundschaft“.
Es kommen also auch die Besonderheiten des österreichischen EU-Kleinstaates zur Sprache. Hier gibt es ja, wie Kommentatoren nüchtern konstatieren, im Mainstream „durchaus einen rot-weiß-roten Patriotismus, mit stark nationalistischen Anklängen… Diese offene EU-Feindlichkeit wird dabei nicht nur von rechtspopulistischen Politikern genährt.“ (Heinrich 2017, 19) Speziell der ÖVP-Außenminister der Großen Koalition, Sebastian Kurz, „bietet sich den Gegnern von Angela Merkels Flüchtlingspolitik als konservative Alternative zum autoritären ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán an, ohne sich dabei rhetorisch so weit herauswagen zu müssen wie FPÖ-Chef Strache, der Angela Merkel als gefährlichste Frau Europas bezeichnet hat… Ob Kurz mit seinem Rechtsschwenk aber auch der FPÖ politisch den Schneid abkaufen kann oder deren Politik erst recht zum Durchbruch verhilft, diese Frage bleibt bis zum nächsten Wahltag offen.“ (Ebd., 19f) Das Abschätzen von Wahlchancen ist Auingers Sache natürlich nicht. Was er mit seinem Buch liefert, ist argumentatives Material, mit dem man dem nationalen Aufbruch – in welcher Variante und Nationaluniform auch immer – entgegentreten kann.
Literatur
- Herbert Auinger, Haider – Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Wien 2000.
- Herbert Auinger, Die FPÖ – Blaupause der neuen Rechten in Europa. Wien 2017.
- Joachim Bischoff/Bernhard Müller, Rechtspopulismus in der „Berliner Republik“ und Europa – Ursachen und Hintergründe. In: Alexander Häusler/Favian Virchow (Hg.), Neue soziale Bewegung von rechts? Zukunftsängste – Abstieg der Mitte – Ressentiments, Hamburg 2016, S. 19-31.
- Hermann Dworczak, Modernisierter Rechtsextremismus und Rechtspopulismus am Beispiel Österreichs. In: Peter Bathke/Susanne Spindler (Hg.), Neoliberalismus und Rechtsextremismus in Europa – Zusammenhänge, Widersprüche, Gegenstrategien, Berlin 2006, S.84-87.
- Oliver Geden, Männerparteien – Geschlechterpolitische Strategien im österreichischen und schweizerischen Rechtspopulismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 46, 2004, online: http://www.bpb.de/apuz/27985/maennerparteien.
- Rolf Gloël/Kathrin Gützlaff, Gegen Rechts argumentieren lernen. Hamburg 2005.
- Rolf Gloël/Kathrin Gützlaff/Jack Weber, Gegen Rechts argumentieren lernen. Aktualisierte Neuausgabe. Hamburg 2017 (zum Frühjahr angekündigt).
- Rolf Gutte/Freerk Huisken, Alles bewältigt, nichts begriffen! Nationalsozialismus im Unterricht – Eine Kritik der antifaschistischen Erziehung. Hamburg 2007.
- Claus Heinrich, Österreich: Neutral und rechts? In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2017, S. 17-20, online: https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/februar/oesterreich-neutral-und-rechts.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012.
- Georg Loidolt, Vom Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Wien 2013, Vertrieb über www.amazon.de.
- Jan-Werner Müller, Populismus – Symptom einer Krise der politischen Repräsentation? In: Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 40-42, 2016, S. 24-29.
- Karin Priester, Rechtspopulismus – ein umstrittenes theoretisches und politisches Phänomen. In: Fabian Virchow u.a. (Hg.), Handbuch Rechtsextremismus, Wiesbaden 2016, S. 533-560.
- Andreas Speit, Bürgerliche Scharfmacher – Deutschlands neue rechte Mitte. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 10033, Bonn 2017.
- Carsten Weikamp, Die Auseinandersetzung mit der AfD: meist hohl und damit ungenügend. Deshalb hier ein Versuch der inhaltlichen Auseinandersetzung. Nachdenkseiten, 7.2.2017, http://www.nachdenkseiten.de/?p=36906.