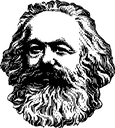Inhaltsverzeichnis
Textbeiträge 2016
An dieser Stelle veröffentlichen wir Texte, Debattenbeiträge und Buchkritiken.
Dezember 2016
Rechts & links – kann man das verwechseln?
Rechte Politik hat Auftrieb – nicht nur in Deutschland. Woher kommt das? Stimmt es, „dass die institutionalisierte Linke eine vernichtende Verantwortung für diesen sich gerade abspielenden Prozess trägt“ (Didier Eribon)? Dazu einige Publikationshinweise der IVA-Redaktion.
Rechte Politik ist im Aufwind – in zahlreichen europäischen Ländern und den USA, mittlerweile auch in Deutschland. Mit der AfD gibt es eine Partei, die für den nationalen Aufbruch einsteht und der große Wahlchancen eingeräumt werden (vgl. die IVA-Texte „Der nationale Aufbruch der AfD“ und „Nationalismus ‚im Aufwind‘“ vom September bzw. Juli 2016). Laut Umfragen vom Jahresende 2016 sind der rechten Alternative für die nächste Bundestagswahl zweistellige Werte zuzutrauen (ARD-Tagesschau, 5.12.2016), sie könnte die Stimmen von mindestens 20 % der Bevölkerung abgreifen (Heitmeyer 2016), wobei nach den letzten Wahlen und Abstimmungen in der EU bzw. den USA weitere böse Überraschungen nicht mehr ausgeschlossen werden.
Der Sozialforscher Wilhem Heitmeyer beklagte noch jüngst: „Solange das Potenzial sich nicht auf parteipolitischer Ebene zeigte, wurde es von den politischen Eliten nicht ernst genommen“ (ebd.). Dieser Zustand ist passé. Der CDU-Parteitag vom Dezember 2016 z.B. stand ganz im Zeichen einer Kampfansage an die rechte Konkurrenz. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Thomas Strobl, will die Perspektive einer demokratisch legitimierten Partei rechts von der Union nicht gelten lassen: „Die AfD ist eine Schande mit Parteistatut“ (ARD-Tagesschau, 5.12.2016). Die CDU stellte auch – mit dem Segen der Schwesterpartei CSU – klar, dass rechts gesinnte Wähler gar nicht zur AfD überlaufen müssen. Im CDU-Leitantrag fallen Sätze wie „Unsere Antwort auf Globalisierung heißt Heimat“, oder es ist von einer „Schicksalsgemeinschaft“ der in Deutschland Lebenden die Rede. Die beschlossene verschärfte Abschiebung wird als „nationale Kraftanstrengung“ definiert, auch darf ein Verweis auf die „deutsche Leitkultur“ nicht fehlen. Neben Burka-Verbot, dem (von Merkel allerdings nicht mitgetragenen) Anti-Doppelpass-Beschluss und der Verschärfung der Asylpolitik gibt es dann die Forderung, dass Flüchtlinge bei ihrer „Integration in den Arbeitsmarkt“ in Zukunft ein Jahr unterhalb der „ortsüblichen Entlohnung“ bezahlt werden sollen (eine aufmerksame, kritische Kommentierung dazu findet man – Russland sei Dank – bei RT Deutsch: https://deutsch.rt.com/inland/44052-deutschland-al…, vgl. auch Lucke 2016).
Die regierenden Parteien in Deutschland wollen die rechtsalternative Konkurrenz fernhalten und kleinmachen, sie soll als irrationaler, unseriöser Verein, der eine Politik des Affekts auf „postfaktischer“ Basis betreibt, gebrandmarkt werden. „Diese ‚politische Auseinandersetzung‘ zielt darauf, die AfD aus der Elite auszuschließen, die für die Führung der Nation in Frage kommt. Spiegelbildlich dazu stellt sich die AfD gegen die gesamte politische Klasse als alternative Führung auf, die Deutschland braucht, weil die ‚Altparteien‘ nicht etwa diesen oder jenen Fehler machen, sondern insgesamt ein nationales Unglück sind…“ (Decker 2016b, 137). Zwar wird von kritischen Stimmen hierzulande auch an die etablierten bürgerlichen Parteien, speziell an die CSU, der Vorwurf gerichtet, sie hätten diesem Aufschwung des Ressentiments und der Ausländerfeindlichkeit den Boden bereitet (vgl. Häusler/Virchow 2016, 8). Inzwischen ist jedoch eine Debatte aufgekommen, die speziell die Linke dafür in Verantwortung nimmt. Hervorgetan hat sich in dem Zusammenhang der französische Soziologe Didier Eribon, der die These vertritt, „dass die institutionalisierte Linke eine vernichtende Verantwortung für diesen sich gerade abspielenden Prozess trägt“ (Eribon 2016c, 48; vgl. Eribon 2016a, 2016b, 2016d). Eribon hat seine Überlegungen in dem bereits vor sieben Jahren erschienenen Buch „Rückkehr nach Reims“ mit Blick auf die französischen Verhältnisse und den Aufstieg des Front National vorgetragen; in Deutschland befeuert es jetzt eine Debatte, die sich nicht nur an der SPD, sondern auch an der Linkspartei festmacht. Zu dem Verhältnis von links und rechts im Folgenden einige Anmerkungen samt Hinweisen auf aktuelle Analysen der marxistischen Zeitschrift Gegenstandpunkt (deren Ausgabe 4/16 am 16. Dezember 2016 erscheint; der AfD-Artikel ist bereits online verfügbar, s.u.).
Von links nach rechts und zurück
| manche meinen/lechts und rinks/kann man nicht velwechsern/werch ein illtum (Ernst Jandl) |
Eribon hat in einem aktuellen Interview seine These von der Verantwortung der „institutionalisierten Linken“ folgendermaßen zusammengefasst: „Die europäische Regierungslinke hat sich zur neoliberalen Ideologie bekehrt, und sie hat unter dem Vorwand, ihre Diskurse und Praktiken zu ‚modernisieren‘, alles, was das linke Denken einst ausmachte, vollständig aufgegeben. Besonders den Gedanken, dass soziale Klassen und Klassenwidersprüche bestehen sowie ein das ökonomische wie soziale Feld strukturierender Gegensatz zwischen Herrschenden und Beherrschten: Die neoliberale Verwaltung der Ökonomie und das neoliberale Konzept des gesellschaftlichen Lebens wurden von den Linken akzeptiert und haben die verantwortlichen Politiker in Versuchung gebracht, sich von dem Gedanken der Herrschaft und der Ausbeutung zu befreien.“ (Eribon 2016c, 48) Das ist nun nicht gerade eine Analyse der Entscheidungsfindung bei Wechsel- oder Neuwählern, was „das politische Buch des Jahres“ (Konkret) laut Autorenauskunft da zu vermelden hat. Es ist die übliche, auch in Deutschland verbreitete Klage, der Neoliberalismus sei schuld am Rechtsruck (vgl. Dörre 2016, Lederer/Miemiec 2016, Wagenknecht 2016). Wagenknecht z.B. stimmt mit Eribon und seiner These, in der „Zustimmung zum Front National“ habe man „eine Art politische Notwehr der unteren Schichten“ vor sich (Wagenknecht 2016), ausdrücklich überein: „Wenn keine glaubwürdige soziale Alternative verfügbar ist, weil ehemalige Arbeiterparteien selbst Teil des neoliberalen Blocks geworden sind, wählt man eben rechts.“ So ist das eben! Man tauscht links durch rechts aus. Gerade das, was erklärungsbedürftig ist, wird als Selbstverständlichkeit präsentiert. Zum Neoliberalismus fügt die führende Linkspolitikerin übrigens noch die Präzisierung an: „Diese Politik [im Interesse der vermögenden Oberschicht] wird üblicherweise neoliberal genannt, obwohl sie eigentlich weder neu noch im echten Sinne liberal ist. Im Kern besteht sie einfach darin, den im 20. Jahrhundert erstrittenen Sozialkompromiss wieder aufzukündigen.“ (Ebd.) Die Notwehr der Massen besteht also darin, sich um eine Verteidigung gegen den Angriff auf die eigene soziale Lage nicht mehr zu kümmern, sondern in ein politisches Lager zu wechseln, das ganz andere Sorgen kennt.
Man wundert sich zudem über die großartige Entdeckung des französischen Soziologen in Sachen europäischer Sozialdemokratie – zu der auch die französischen Sozialisten gehören. Die Sozialdemokratie ist ja bei Eribon hauptsächlich als „institutionalisierte Linke“ gemeint. Es geht also um die Partei, von der man seit Schröders Ansage aus den 1990er Jahren weiß, dass sie nicht mehr „linke“, sondern nur noch „moderne“ Wirtschaftspolitik machen will. Eine Partei übrigens, von der man seit über hundert Jahren weiß – und das gilt auch für die französischen Genossen –, dass die Befriedung der sozialen Gegensätze die Unterordnung unters Kapital bedeutet. 1914 hat sie die europäischen Arbeitermassen zielstrebig in die Politik des Burgfriedens und der Union Sacrée und dann in die erste große Schlächterei des 20. Jahrhunderts geführt. Sie hat sie zum Fußvolk der Konkurrenzaffären gemacht, die die großen kapitalistischen Mächte um die Erfolgsbedingungen und nationalen Rechte ihrer Kapitalstandorte austragen, und jeweils nach Kriegsende zum fleißigen Wiederaufbau angehalten. Sie hat sich vor mehr als einem halben Jahrhundert, in ihrem „Godesberger Programm“, davon verabschiedet, dass das „soziale Feld“ durch Klassenherrschaft „strukturiert“ ist, und sich selbst zur Volkspartei gewandelt, die den Klassenstandpunkt, den Klassenkampf sowieso, ad acta legt. Und jetzt kommt Eribon mit der Entdeckung, dass kürzlich an sozialdemokratische Politiker die Versuchung herangetreten sei, „sich von dem Gedanken der Herrschaft und der Ausbeutung zu befreien“. Weil Maschmeyer Schröder in seine Villa eingeladen hat? Weil Riester von der Versicherungswirtschaft bestochen worden ist? Weil das Finanzgewerbe Steinbrück mit Vortragshonoraren geködert hat?
Kurios ist auch der Fortgang von Eribons Argumentation. Man könnte meinen, als Erstes folge aus seiner Diagnose, dass die verloren gegangene Klassenperspektive – deren Verlust ja das entscheidende Manko sein soll – wiedergewonnen werden muss. Dem ist aber nicht so. Eribon fährt fort: „Wir müssen den Begriff der Klasse offensichtlich überdenken. Das Vermächtnis der marxistischen Tradition ist tatsächlich überholt. Es kann die soziale Realität nicht mehr treffend beschreiben.“ (Eribon 2016c, 48) Eine merkwürdige Mitteilung: Offensichtlich ist doch gerade, dass alle Welt wieder mit den Kategorien (teilweise auch mit der Diktion) der marxistischen Tradition die sozialen Verhältnisse in den USA oder in den europäischen Problemstaaten „beschreibt“. Da werden verelendete (‚abgehängte‘) Volksteile ausfindig gemacht, die neben einer regulären Arbeiterklasse existieren, welche auch nichts zu lachen hat, sondern immer tiefer (‚prekärer‘) in die Misere gerät, oft nur als Reservearmee sparsamst erhalten wird, während am anderen Pol der Gesellschaft eine abgehobene Leisure Class (samt ihrem Establishment) residiert und es sich immer besser gehen lässt. Beschrieben wird das massenhaft – von Pikettys Bestseller über das „Kapital im 21. Jahrhundert“ bis zur deutschen Armutsforschung, vom Feuilleton der FAZ bis zum US-Volksschriftsteller Stephen King, der in seiner neuesten Romantrilogie mit einer amerikanischen Elendsschilderung aufwartet, bei der es einem Charles Dickens kalt den Rücken runtergelaufen wäre…
Ganz zu schweigen davon, dass es Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie nicht darum ging, die Klassengesellschaft zu beschreiben, sondern zu erklären. Zum Mangel dieser Erklärung finden sich bei Eribon – folgt man seinem Resümee im aktuellen Interview – nur Andeutungen. Die Arbeiterklasse ist eben heute nicht mehr das, was sie einmal war, basta. „Dennoch“, fährt er nach seiner Zurückweisung des Marxschen Tradition fort, „hat die politische Kategorie des Proletariats eine objektive Realität, eine Verankerung in den objektiven Bedingungen im Inneren der ökonomischen und sozialen Struktur.“ (Ebd.) Es gibt Armut und arme Menschen, um die muss sich gekümmert werden. Aber bitte, keine Politik der „Arbeiteridentität“! Sondern eine, die sich „mit den unteren Klassen beschäftigt“, „die dem sozialen Leid gegenüber aufmerksam ist“, die den Schwierigkeiten der Ärmsten „Beachtung schenkt“, die den bestehenden Sozialstaat „verteidigt“ etc. (ebd., 49) – die also kurz gesagt, all das macht, was sich DIE LINKE in Deutschland als Kümmerer-Partei auf ihre Fahnen geschrieben hat und was sich die Sozialdemokratie auch nicht als Markenzeichen nehmen lassen will. Armut ist eine Notlage, sie darf nicht ignoriert werden; aber, betont Eribon, man muss den Klassengegensatz in seiner gesellschaftlichen Bedeutung zugleich relativieren, es „darf kein Kampf als wichtiger als der andere betrachtet werden“ (ebd.). Die Idee einer revolutionären Klasse (in Anführungszeichen) sei zu verabschieden, ja schon die Rede von einer Arbeiterklasse (ebenfalls in Anführungszeichen) führe in die Irre.
Bleibt nachzutragen, dass die Reaktionen auf Eribon in Deutschland und bei der deutschen Linken, wo er „hymnisch gefeiert worden“ ist (Kunstreich 2016), ebenso eigenartig sind. Tjark Kunstreich z.B. hält die Veröffentlichung des französischen Soziologen für nicht sehr ertragreich, hat sie aber trotzdem in der Zeitschrift Konkret (12/16) zum „Buch des Monats“ erklärt. Eribons Erkenntnisse seien eher trivial, er habe nicht viel zu bieten; er überzeuge jedoch durch „die Wucht, mit der er aufzeigt, dass es sie noch gibt, die Arbeiterklasse, die Leute, die monatlich Miete zahlen … und deswegen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen“; letztlich beeindrucke der französische Autor durch „den subjektiven Charakter, die autobiografische Prosa …. authentisches Bemühen um Wahrheit“ (ebd.). Ähnlich widersprüchlich fällt die Würdigung Eribons in der Wochenzeitung Jungle World (49/16) aus. Dort schreibt Alex Struwe (2016): „Seit der deutschen Übersetzung von ‚Rückkehr nach Reims‘ vergeht kaum eine größere Podiumsdiskussion zur Zukunft Europas, dem Aufstieg der neuen Rechten oder allgemein zur Linken ohne Bezug auf Eribon. Das Feuilleton ist voll kritischer Würdigung seiner Analysen und bestechenden Selbstkritik, an der sich zugleich das Schicksal der Linken abhandeln ließe.“ Der Kommentator ist beeindruckt, zugleich skeptisch, will wiederum die allgemeine Begeisterung nicht „vollends zurückweisen“; dennoch bedürfe es einer Klarstellung: „Eribon ist trotz allem mehr Symptom denn Lösung des desolaten Zustands der Linken“ (ebd.). „Dennoch“, so fährt der Text mit der nächsten Einschränkung fort, „sollte sein Vorschlag einer Rückkehr ernstgenommen werden“ (ebd.). Eribon erinnere an die marxistische Tradition, aber nicht richtig, denn „die Analyse bleibt am entscheidenden Punkt … Koketterie mit dem Klassenbegriff und seinen strengen theoretischen Implikationen. Eribon kommt am Ende dann doch nur dort an, wo er losgegangen war…“ (ebd.). Und es kommt zum nächsten Dennoch: „Trotzdem ist der Umweg, den Eribon beschreibt, eine Errungenschaft, nicht unbedingt im Kampf gegen die Irrationalität auf der Straße und in der sogenannten Lebenswelt, aber gegen die theoretische Irrationalität, die der Frage der politischen Praxis … vorausgeht.“ (Ebd.) So liefere der französische Soziologe einen „Impuls“, heißt es abschließend, „dem zu folgen ein Gewinn wäre“ (ebd.). Wer diese Empfehlungen einleuchtend findet, mag zu dem neuesten französischen Bestseller greifen…
Aber zurück zum angesprochenen Kernproblem der Links-Rechts-Verschiebung: Wenn der moderne, ‚abgehängte‘ Post-Proletarier in seinen angestammten Parteien die Klassenperspektive vermisst, dann wählt er „eben rechts“, wie Wagenknecht lapidar feststellt und worauf im Grunde auch Eribons Erklärung hinausläuft. Die Logik dieser Argumentation ist bemerkenswert. Der „Sozialkompromiss“, nach der Terminologie Wagenknechts, ist seit Neuestem „aufgekündigt“, die Massen werden also mit dem brutalen Standpunkt der Oberklasse konfrontiert, der den Beherrschten keine Zugeständnisse mehr machen will – und sie haben in ihrer Enttäuschung nichts Besseres zu tun, als Parteien zu wählen, die von diesem Klassengegensatz partout nichts wissen wollen. Wie das? Ist das naheliegend? Sie folgen Politikern, die sich mit ihren nationalistischen Partei(neu)gründungen dazu bekennen, genau das zu sein, was sich alle anderen auf ihre Fahnen geschrieben haben, nämlich Volksparteien – nur mit dem Unterschied, dass die Rechten jetzt mit dem Vorwurf antreten, ihre Konkurrenten hätten den Bezug aufs Volk verraten, seien gar keine wahren Volksparteien mehr. Die ‚abgehängten‘ Massen, die mittlerweile rechts wählen, entscheiden sich also für Parteien, die gar nicht als Kritiker des Neoliberalismus auftreten, die bestenfalls ein paar nationale Ressentiments gegen die Globalisierung im Repertoire haben. Und gerade darin soll ein Protest gegen neoliberale Modernisierung und Globalisierung zum Ausdruck kommen?
Dass die soziale Not von den rechten Parteien angesprochen wird, dass sich jede Unzufriedenheit bei ihnen aufgehoben fühlen soll, stimmt natürlich. So geht z.B. die AfD in Deutschland vor, womit sie sich zunächst nicht von anderen Parteien unterscheidet. Die Analyse des Gegenstandpunkts hat diesen Sachverhalt aufgegriffen. Chefredakteur Peter Decker hat ihn jüngst in einem Vortrag (2016d) an den Anfang gestellt, nachdem zuvor in einem Artikel die Logik rechten Denkens unter die Lupe genommen worden war (vgl. Decker 2016b). In dem Vortrag geht Decker ausführlich auf Äußerungen von AfD-Politikern wie Gauland oder Höcke ein, die zum sozialen Elend in Deutschland Stellung und auch explizit auf die „soziale Frage“ Bezug nehmen. Dabei wird deutlich, dass diese Frage von der rechten Politik ausdrücklich und programmatisch in eine nationale verwandelt wird. Wer sich diesem Blickwinkel anschließt, tritt daher nicht mit einem fehlgeleiteten sozialen Protest gegen die vom Neoliberalismus freigesetzte Macht der Oberklasse an, sondern mit einem anderen Standpunkt (den er beim Driften von links nach rechts vielleicht gar nicht groß auswechseln musste), also mit einer Position, die das Soziale schon unter dem Blickwinkel des Nationalen wahrnimmt. Warum die Politisierung der Rechten derzeit erfolgreich ist, warum sie anderen den Rang ablaufen, warum es ihnen sogar gelingt, Nicht-Wähler zu mobilisieren, hat – worauf hier nur hingewiesen werden soll – mit der gegenwärtigen Situation einer weltwirtschaftlichen Krisenkonkurrenz zu tun; Überlegungen dazu gibt es im Schlussteil des genannten AfD-Artikels (Decker 2016b, 148ff).
Die Kritik von Eribon – die, wie dargelegt, ein landläufiges linkes Argumentationsmuster wiedergibt – wäre statt dessen selber auf ihre eigenartigen Leistungen hin zu überprüfen. Die neue Analyse des Gegenstandpunkts (Decker 2016c), die im Dezember 2016 erscheint, geht in diese Richtung. Sie macht den Kampf der Linken gegen rechts zum Thema, wobei hier prominente Vertreter der Linkspartei gemeint sind (Riexinger, Wagenknecht, Ramelow). DIE LINKE kennt natürlich auch, im Einklang mit allen guten Demokraten, die grundsätzliche Abgrenzung vom Rassismus der neu formierten Ausländerfeinde, mit dem diese sich, so heißt es, fundamental aus der nationalen Wertegemeinschaft ausgrenzen. Aber daneben oder vielleicht zuerst – schon allein aus dem Grund, dass viele ‚ihrer‘ Wähler zu den ganz Rechten übergelaufen sind – will die Linkspartei die Massen als fehlgeleitete Menschen sehen, die aus verständlichen, eventuell sogar ehrenwerten Motiven ihr Kreuz bei einer Partei machen, die das ganz und gar nicht verdient hat. Die Linkspartei kommt der Gefolgschaft von AfD, Pegida etc. also mit dem Angebot, sich mit ihren Sorgen bei der eigentlich zuständigen politischen Kraft, nämlich der Linken, einzufinden. Nicht nur unterbleibt die Erklärung für den eigenartigen Übergang, den ein Mensch von sozialer Unzufriedenheit hin zur Aufregung über ausländische Elendsgestalten machen muss; die Partei erspart sich auch eine Kritik ihrer Wähler-Klientel, die sie als die ihre beansprucht. Die einzelnen Fehlleistungen, die dabei zustande kommen, sind Thema des erwähnten Artikels. Die Linke beschäftigt sich ja auf Parteitagen und in Strategieseminaren ausgiebig mit der Frage, wie es zu dem radikalen Austausch politischer Werte und Orientierungen kommen konnte und was sie zu tun hat, um ‚ihre‘ Wähler wieder einzufangen. „Was ihr dazu einfällt, erklärt schon ein wenig, warum für diese Wähler rechtsradikale Positionen ein Angebot sein können“, schlussfolgern Decker und Co. (ebd., 44).
Literatur
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Öffentlicher Streit der Regierungsparteien über den Aufstieg der AfD: Wie wir den Ausländerfeinden am besten das Wasser abgraben. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2016a, S. 123-125. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2016/2/gs2016212.…
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Die AfD – Auch Deutschland hat jetzt eine Partei, die antritt, um Staat und Volk zu retten. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2016b, S. 137-150. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2016/3/gs2016313.…
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Kampf der Linken gegen Rechts – heute: Die Betreuung der sozialen Unzufriedenheit nicht der AfD überlassen! In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2016c, S. 44-48, online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2016/4/gs20164c0….
- Peter Decker, Rechtsruck in Deutschland und Europa. Vortrag, Nürnberg, 27.10.2016d, Mitschnitt online: https://www.argudiss.de/node/396.
- Klaus Dörre, Fremde – Feinde. Der neue Rechtspopulismus deutet die soziale Frage in einen Verteilungskampf um. Thesen über Pegida, AfD und darüber, wie der wachsende Zuspruch für sie zustande kommt. In: Junge Welt, 27.6.2016, S. 12-13.
- Didier Eribon, Wie aus Linken Rechte werden – Der vermeidbare Aufstieg des Front National. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 8, 2016a, S. 55-63.
- Didier Eribon, Wie aus Linken Rechte werden, Teil II – Der rassistische Reflex und das Ende der Solidarität. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9, 2016b, S. 85-92.
- Didier Eribon, Ich will nicht in den Proletkult zurückfallen – Interview mit D.E. über den Erfolg seines Buchs Rückkehr nach Reims und die Mitverantwortung der Linken für den Auftrieb der Rechten. In: Konkret, Nr. 12, 2016c, S. 48-49.
- Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. (Originalausgabe: Retour à Reims, Paris 2009) Berlin 2016d. (Das Buch ist auch Anfang 2017 in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung als Band Nr. 10005 erschienen, http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/2400…)
- Alexander Häusler/Fabian Virchow (Hrsg.), Neue soziale Bewegung von rechts? Zukunftsängste – Abstieg der Mitte – Ressentiments. Eine Flugschrift. Hamburg 2016.
- Wilhelm Heitmeyer, „Der Erfolg der AfD wundert mich nicht„ – Interview mit W. H. Berliner Zeitung, 22.10.2016, online: http://www.berliner-zeitung.de/24954352.
- Tjark Kunstreich, Buch des Monats: Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. In: Konkret, Nr. 12, 2016, S. 51.
- Klaus Lederer/Olaf Miemiec, Was kommt nach dem Protest? Der Aufstieg der AfD und die Krise der Linken. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 10, 2016, S. 97-104.
- Albrecht von Lucke, Burka als Exempel – Die Lufthoheit der AfD. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9, 2016, S. 5-8.
- Alex Struwe, Leben im Loop – Auch Didier Eribons Gesellschaftsanalyse ändert nichts daran, dass der Ruf nach neuen Visionen nur die Hilflosigkeit der Linken bestätigt. Jungle World, Nr. 49, 2016, online: http://jungle-world.com/artikel/2016/49/55364.html.
- Sahra Wagenknecht, Die Einschläge kommen näher – Warum die Rechte profitiert. N-TV, 6.12.2016, online: http://www.n-tv.de/politik/Warum-die-Rechte-profit….
November 2016
Erziehung im Kapitalismus
Das Standardwerk zur Kritik des kapitalistischen Systems von Bildung und Ausbildung – Freerk Huiskens „Erziehung im Kapitalismus“ – ist im November 2016 in einer überarbeiteten Neuausgabe erschienen. Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
Alle klagen über die Schule: Schüler, Eltern, Lehrer sowieso, dann Hausmeister, Wissenschaftler, aber auch Kultusminister, Haushaltspolitiker, neuerdings Anhänger des Homeschoolings oder Inklusions-Betroffene… Eine Streitschrift, die kein gutes Haar am öffentlichen Erziehungswesen lässt, schien ihnen da recht zu geben. Der Bremer Pädagogikprofessor Freerk Huisken hatte 1992 mit dem zweiten Teil seiner „Kritik der Erziehung“ die Beschwerden eines alten Römers aufgegriffen, dass leider immer wieder non vitae, sed scholae gelernt würde, und seine Schulkritik mit dem programmatischen Titel „Weder für die Schule noch fürs Leben – Vom unbestreitbaren Nutzen unserer Lehranstalten“ versehen. Die auf einer breiten Materialbasis erstellte Streitschrift haderte aber nicht damit, dass die Schule immerzu gegenüber hehren pädagogischen Idealen, elterlichen Ambitionen und allerlei Pennälerwünschen versage. Sie bestand darauf, dass die geläufigen Erwartungen und Idealisierungen am Auftrag des Bildungswesens vorbeigehen, dass Bildung in marktwirtschaftlich geordneten Gesellschaften vielmehr einen anderen Nutzen als die Ausrottung der Dummheit verfolgt, nämlich der Versorgung eines nationalen Standorts mit der Ressource Humankapital dient. In einem systematischen Durchgang durch die Abteilungen des Bildungsbetriebs wies das Buch diese Nützlichkeit fürs kapitalistische Beschäftigungssystem nach – vom dreigliedrigen Schulsystem über Berufs- und Weiterbildung bis zu den Alternativen einer Waldorfpädagogik. Die Schulkritik wurde 1998, zusammen mit der „Einführung in die Grundlügen der Pädagogik“ von 1991, die sich dem Wissenschaftsbetrieb widmete, in einer leicht gekürzten Studienausgabe (es fiel z.B. der Exkurs zur Pädagogik im realen Sozialismus weg) unter dem Titel „Erziehung im Kapitalismus“ veröffentlicht. Jetzt ist im November eine überarbeitete Neuausgabe dieses Standardwerks erschienen (Huisken 2016a).
Dem soll übrigens im VSA-Verlag eine Neuauauflage von Huiskens Veröffentlichung „Über die Unregierbarkeit des Schulvolks“ folgen (vgl. Schuster 2016). Der 2007 erschienene Sammelband, der vier Aufsätze enthielt, basierte auf Vorträgen, die der Autor zum Thema „Jugendgewalt“ gehalten und um einen Debattenteil ergänzt hatte. Roter Faden war das Ordnungsproblem, das die Schulpolitik seit den 1990er Jahren in verschärfter Form bei Schülern aus „bildungsfernen“, „sozial schwachen“, „abgehängten“ Milieus mit oder ohne Migrationshintergrund entdeckt hatte – ein Problem, das in der Bildungs- und Sozialpolitik als Frage nach der Aufstiegsbereitschaft der neuen Unterschicht oder der Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit thematisiert wurde. Neben dem Gewalt-Thema sind es weitere Schlüsselbegriffe der politisch-pädagogischen Debatte – Bildungsbenachteiligung, Leistungsprinzip, Konkurrenzordnung, Erziehungskrise, Integration –, die Huisken hier auf den Prüfstand stellte. „Besonderen Wert legt er dabei auf die doppelte Buchführung, die das heutige Konkurrenzverhalten kennzeichne: Erst durch den Zusammenhang der realen Konkurrenzzwänge mit der als Realismus akzeptierten Konkurrenzideologie könne man Aufschluss über die Gewalttätigkeit gewinnen, die heute für den Alltag Jugendlicher typisch ist. Der Blick sei auf die systemkonformen Produktionsbedingungen von Brutalisierung und Verrohung zu richten, statt dass sich Pädagogik umstandslos für die Beseitigung des unerwünschten Verhaltens verantwortlich machen lasse.“ (Schillo 2007, 52)
Macht die Schule dumm?
Huisken hat seine Schulkritik auch in diversen Vorträgen präsentiert. Eine der letzten Veranstaltungen, die auf YouTube dokumentiert ist (Huisken 2010), beginnt mit der Feststellung „Ausbildung macht dumm“, also mit einem Befund, der der offiziellen Schulpolitik nicht ganz fremd sein dürfte. Denn als zu Beginn des neuen Jahrhunderts die Ergebnisse der internationalen PISA-Studien bekannt wurden, galt das miserable Abschneiden der deutschen Schüler als Blamage für eine Nation, die sich explizit als Wissensgesellschaft präsentiert (vgl. Huisken 2005). Bezeichnenderweise wurde in der öffentlichen Besprechung als besonders skandalös der Tatbestand herausgestellt, dass Deutschland im internationalen Vergleich weit abgeschlagen hinter anderen, mehr oder weniger erfolgreichen Industrienationen zurücklag. Dass ca. 25 % des Nachwuchses in Deutschland die Schule als funktionelle Analphabeten verlassen, erregte für sich genommen nicht so sehr die Gemüter von Politik und Öffentlichkeit. Diese „schulisch produzierte Dummheit“ (ebd., 14) galt als bedauerliche Nebenwirkung oder als Folge einer schwierigen Jugendphase und damit zusammenhängender Integrationsprobleme (vgl. Huisken 2002). Die Frage danach, wieso ein neunjähriger Schulbesuch solche Resultate zur Folge haben kann, war damit im Grunde abgehakt.
Huisken will es mit dem Verweis auf Versäumnisse und ungewollte Wirkungen aber gerade nicht bewenden lassen. Er zielt auf einen grundsätzlicheren Sachverhalt. Das Grassieren von Dummheit, heißt es in der Ankündigung des Salzburger Vortrags, „steht nicht für ein Versagen von Schule und Universität, sondern das gehört zu den Aufträgen des hiesigen Bildungssystems. Dummheit, was ist das? Es fällt nicht unter Dummheit, wenn man die neue Rechtschreibung nicht beherrscht, nur schlecht lesen und rechnen kann, die Nebenflüsse der Donau, die chemische Formel von Schwefelsäure nicht kennt oder von Feuerbach noch nie etwas gehört hat. Das ist fehlendes Wissen, das kann man sich aneignen. Besser: das könnte man sich aneignen, wenn das Schulwesen tatsächlich das Anliegen verfolgen würde, den Nachwuchs solide in die 'Kulturtechniken' einzuführen und ihm gediegenes Wissen über Natur und Gesellschaft zu vermitteln. Tut es aber nicht. Dummheit ist dagegen nicht das, was man nicht lernt. Unter Dummheit fällt vielmehr ziemlich viel von dem was man lernt, und zwar als Hauptschüler wie als Gymnasiast und als Student. Es fällt darunter die Ausstattung der Jugend mit einer Fülle falscher Urteile über Gott und die Welt. Das liegt nicht daran, dass sich Schulbuchverfasser und Lehrer einfach nur irren, wenn sie die Schüler mit ihren Lehren über Demokratie und Faschismus, über Geld und Markt, über Familie und Staat traktieren. Das tun sie auch. Aber das trifft nicht die Sache. Dafür sind die Dummheiten viel zu resistent gegen Argumente und haben bereits zu viele Jahrzehnte in Schulbüchern überdauert. Die frühzeitige Aneignung einer gehörigen Portion Dummheit braucht es vielmehr für die geistige Ausstattung der Heranwachsenden. Gefordert ist sie für Leistungen, die mündige Bürger ständig zu erbringen haben: nämlich für die freiwillige Unterordnung unter alle Zwänge und Sachzwänge dieser Gesellschaft. Und weil die Lebensplanung aller Bürger in der Konkurrenzgesellschaft nicht aufgehen kann, deswegen gehört zu den Dummheiten, die man lernen soll, auch die Ausstattung des Verstandes mit lauter falschen Urteilen über die Gründe, warum das mit Karriere und Selbstverwirklichung so häufig nicht klappt. Dummheit ist also – zusammengefasst – die Summe parteilichen Denkens, mit der der erzogene Mensch es fertig bringt, alle politischen und ökonomischen Beschränkungen seiner Interessen zu verarbeiten und dabei brav zu bleiben. So geht Erziehung in der Gesellschaft, die sich rühmt, eine Wissensgesellschaft zu sein.“ (Huisken 2010)
Die Neuausgabe von „Erziehung im Kapitalismus“ hat die alte Gliederung im Wesentlichen beibehalten. Der erste Teil („Die Grundlügen der Pädagogik“) befasst sich mit der etablierten Wissenschaft von der Erziehung, und zwar in drei Schritten: Erstens wird deren grundsätzliches Anliegen dargestellt und kritisiert, zweitens werden die einzelnen Abteilungen (Erziehungsziele, Bildungstheorie, Pädagogische Psychologie, Sozialisationstheorie, Methodenlehre…) und drittens das Theorie-Praxis-Verhältnis, also die Bedeutung des Wissenschaftsbetriebs für das pädagogische Arbeitsfeld, zum Thema. Der zweite Teil („Die Leistungen des bürgerlichen Schulwesens“) geht dann auf das institutionalisierte öffentliche Erziehungswesen ein. Hier sind die Schule „als Instrument der Volksbildung“, die Leistungsbeurteilung, die Lerninhalte (Allgemein- bzw. „höhere Bildung“) und die Schuldisziplin Gegenstand der Kritik. Abschließend gibt es einige Kapitel zu den Alternativen des hiesigen Schulwesens (neu aufgenommen: Freilerner- und Schulverweigerer-Bewegung).
Zeitbedingte Passagen der letzten Ausgabe wurden gekürzt. Ganz herausgenommen wurde z.B. das Kapitel über den Lehrer, denn es müsse mittlerweile, wie Huisken schreibt, schon „als Idealismus gelten, die selbstbewusste Unterwerfung des Lehrers unter die Anforderungen des Staatsschulsystems als Verlaufsformen von pädagogischem Idealismus zu erklären“ (Huisken 2016a, 11), also, wie in der älteren Ausgabe, eine „Charakterologie des Paukers“ zu entwerfen, die den Realismus der Berufspraxis als Endpunkt eines speziellen Anpassungsprozesses versteht. Daneben wurden in fast allen Kapiteln kleinere oder größere Überarbeitungen vorgenommen, die an der Stoßrichtung der alten Fassung nichts ändern. In einigen Kapiteln trug der Autor dem Umstand Rechnung, dass in den Erziehungswissenschaften neue Themen erörtert werden und sich das Bildungssystem „neuen Herausforderungen“ stellen will. So wird ja die Lerntheorie um eine neurologische Variante ergänzt, die sich mit „hirngerechtem Lernen“ befasst; bei der Curriculumtheorie ist heute das „Lernen von bzw. für Kompetenzen“ angesagt, bei den Erziehungszielen die Erziehung zu Resilienz und Frustrationstoleranz; und die Befassung mit Disziplin in der Schule hat inzwischen, so Huisken, „die Grenze zwischen Pädagogik und Medizin eingeebnet: ADHS macht für Disziplinlosigkeit eine Krankheit verantwortlich“ (ebd.). Was Inklusion ist und soll, macht das Buch ebenfalls zum Thema. Ein vollständig neues Kapitel widmet sich den Schulreformen, die seit dem „PISA-Ranking“ von 2001 initiiert worden sind. Unter dem Titel: „Die dritte Bildungskatastrophe: Der ›PISA-Schock‹ und die Folgen“ werden u.a. die Umgestaltung des Schulwesens zur zweizügigen Form, die Neuauflage der Debatte über die Chancengleichheit und der (Schüler-)Protest gegen die Reform thematisiert.
Machen Lehrer kritisch?
Eine Auseinandersetzung mit Huiskens Analyse war übrigens bei der eigenen Zunft die Ausnahme. Im Grunde hielt sich der pädagogische Betrieb an die bewährte Linie und schwieg die Veröffentlichung zur Schulkritik tot. Deren theoretische Leistung wurde auch da ausgeklammert, wo man die abweichende Position zur Kenntnis nahm. So schrieb Pädagogik-Professor Peter Dudek in einer Bestandsaufnahme zur modernen Erziehungswissenschaft kurz und bündig (womit sich für ihn weitere Worte erübrigten): „Man kann es sich so einfach machen wie der Bremer Erziehungswissenschaftler Freerk Huisken und aus einer fundamentaloppositionellen Kapitalismuskritik heraus den Pädagogen allgemein eine Untertanenmentalität gegenüber politischen Erwartungen oder sogar einen vorauseilenden Gehorsam andichten. In seiner selektiven Wahrnehmung folgt die Pädagogik gegenwärtig einem regierungsamtlichen Auftrag, 'die Jugend moralisch zur Ordnung zu rufen, ihr staatsdienliche Orientierung zu geben, alte Werte zu reaktivieren und überhaupt für Ordnung zu sorgen'“ (Dudek 1999, 246). Die kritischen Aussagen übers Bildungssystem werden also von dem Experten nur daraufhin überprüft, welche Konsequenzen sie für den Lehrerberuf haben: Wird schlecht über die Funktionäre des staatlichen Bildungswesens geredet oder wird ihrem Engagement mit Respekt begegnet? Wird ihr vom Staat organisierter und überwachter Dienst, den Nachwuchs in die bestehende Gesellschaft zu integrieren und für die Zukunft fit zu machen, angemessen gewürdigt?
Kurios ist dabei, dass Dudek die pädagogisch tätigen Staatsdiener vor dem Vorwurf in Schutz nimmt, sie wären in einem höheren politischen Auftrag unterwegs. Um Missverständnisse zu vermeiden: Wie Huisken in seinem Buch detailliert darlegt, erhalten Pädagogen natürlich nicht von der jeweiligen Regierung ihre Direktiven. Als Staatsdiener sind sie – vorwiegend noch – Beamte, stehen daher in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat. Sie werden unter dessen Aufsicht tätig, und jahrzehntelang praktizierte Berufsverbote haben den Berufseinsteigern klar gemacht, dass und wie sie „jederzeit“ Gewähr dafür zu bieten haben, sich in Treue zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufzuführen, also Gehorsam gegenüber ihrem öffentlichen Auftraggeber zu praktizieren. Als loyale Staatsdiener, deren Gesetzesgehorsam über den der Normalbürger hinauszugehen hat, müssen sie sich staatspolitischen Erwartungen unterordnen. Das Endresultat kann man polemisch Untertanenmentalität nennen, wobei Huiskens Analyse gar nicht darauf zielt, ein charakterliches Defizit beim Lehrpersonal dingfest zu machen. Ihm geht es vielmehr darum, dass diejenigen, die hier tätig sind, vorgegebene Funktionen ausführen müssen – und dies auch tun.
Die von Dudek zitierte Stelle stammt zudem aus Huiskens Buch „Jugendgewalt“ (Huisken 1996, 63), wo nicht vom schulischen Alltagsbetrieb, sondern von einem speziellen erziehungswissenschaftlichen Aufschwung die Rede ist, der sich in Reaktion auf den pädagogischen Aufbruch der 68er gegen zu viel „emanzipatorische“ und „antiautoritäre“ Tendenzen stemmte. Beginnend mit dem Manifest „Mut zur Erziehung“ von 1978 gab es ja eine Gegenbewegung gegen die sozialliberale Bildungsreform und ihre linken Begleiterscheinungen. Konservative Pädagogen und Bildungspolitiker forderten eine Rückkehr zu alten Werten. Die zunehmende Gewaltbereitschaft, die Protest- und Abwehrhaltung der Jugend wurden zum Problem – und vielfach zur Schuld der antiautoritären Reformer erklärt. Eine eigene Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages machte in den 1980er Jahren den „Jugendprotest im demokratischen Staat“ zum Thema. Die Kommission sollte laut Bundestagsbeschluss „Möglichkeiten für eine Verbesserung des Verständnisses zwischen den Generationen, zwischen Jugend und Politik sowie für eine Förderung von Demokratie- und Staatsverständnis der jungen Menschen aufzeigen“ (Deutscher Bundestag 1983, 21), also der Jugend, in Huiskens Worten, eine staatsdienliche Orientierung geben.
Dass Dudek die Einbindung der Pädagogen in solche Aufträge und in die normale staatliche Schulaufsicht als eine Voreingenommenheit oder Simplifizierung Huiskens bezeichnet, ist absurd. Muss man den Fachmann erst über die Banalitäten des beruflichen Alltags informieren? Eine solche (künstliche) Weltfremdheit gilt auch für seine Einwände gegen Huiskens Charakterisierungen des pädagogischen Berufsbilds, die salopp klingen mögen, aber in der vorgelegten Schulkritik durch eine minutiöse Analyse erhärtet werden (vgl. auch Gutte 1994). In der 1996er Publikation zur Jugendgewalt ging es, wie gesagt, um die Revision alter, „emanzipatorischer“ Bildungsideale, der sich auch „etliche 'Altlinke'“, wie Huisken schrieb (Huisken 1996, 63), angeschlossen haben. Es wurde also gar nicht behauptet, dass alle Pädagogen in ihrer ‚Untertanenmentalität‘ komplett übereinstimmen; vielmehr wurde auf politische und fachliche Auseinandersetzungen verwiesen – Auseinandersetzungen, die eine bildungspolitische Formierung des Berufsfelds zum Resultat hatten und emanzipatorische Positionen im Endeffekt an den Rand drängten. Deshalb ist auch (siehe oben) in der Neuausgabe von „Erziehung im Kapitalismus“ das Kapitel über den Lehrerberuf im Spannungsfeld von Idealismus und Realismus weggefallen.
Das genannte pädagogische Rollback ist übrigens keine Entdeckung Huiskens, es wurde auch von anderen kritisch eingestellten Bildungsexperten registriert und kritisiert. Hochschullehrer wie Klaus Ahlheim, Armin Bernhard oder Peter Faulstich, um nur einige zu nennen, machten es immer wieder zum Thema (vgl. Ahlheim 2004, Bernhard 2010, Faulstich/Ludwig 2004). Ahlheim sprach z.B. hinsichtlich des Weiterbildungsbereichs von einer „affirmativen Wende“ (Ahlheim 2004, 22): Im pädagogischen Mainstream zum Ende des 20. Jahrhunderts habe sich der Realismus breit gemacht, dass der Bildungsidealismus aus Zeiten der sozialliberalen Bildungsreform nicht länger zu halten sei. Im Endergebnis bildete sich so in Deutschland der neue Konsens heraus, Pädagogen müssten von ihren gesellschaftskritischen und -verändernden Idealen Abschied nehmen, vielmehr die Jugend moralisch aufbauen – etwa hinsichtlich Resilienz, Anpassungsbereitschaft oder sonstiger personaler Kompetenzen –, ihr eine staatsbejahende, konstruktive Orientierung geben, zudem alte Werte reaktivieren und überhaupt für mehr Ordnung sorgen.
Dies ist im Grunde auch kein pädagogisches Novum. Nach jahrzehntelanger Jugendforschung mit Shell- und anderen Jugendstudien, die das politische Desinteresse der Jugendlichen, deren „No-Future“- oder Protest-Haltung, den Rückzug ins Private, den Wertewandel oder den Zuwachs an Gewaltbereitschaft beklagen und die ganze pädagogische Zunft auf Abhilfe sinnen lassen, liegt es auf der Hand, dass ein offizielles Interesse an staatsdienlicher und konstruktiv-moralischer Aufführung der jungen Generation besteht. Mit seiner Schulpflicht dokumentiert der Staat generell die Absicht, die nachwachsende Generation als Ressource zu nutzen. Im pädagogischen Leitbild spielen dabei die Orientierung auf tugendhafte Aufführung, modern: der Erwerb von Kompetenzen, sowie die Bekämpfung von Politikverdrossenheit eine zentrale Rolle. Das betrifft den Lehrplan und die Organisation des Schulwesens, das betrifft aber auch erzieherischen Zusatzmaßnahmen. Schon der Ursprung des Jugendwohlfahrtsgesetzes im 19. Jahrhundert verweist auf die staatliche Sorge um eine Verwahrlosung der jungen Generation. Dass die Jugendphase sich zu einem Ordnungsproblem auswachsen könnte, wird heutzutage wie in früheren Zeiten unter großer öffentlicher Beteiligung thematisiert. Ob es migrantische Jugendliche sind, bei denen Integration besonders Not tut, oder einheimische „Abgehängte“ aus dem „Prekariat“, ob „berufsunreife“, „politik-“ oder „bildunsgferne“ Zielgruppen zu erreichen sind, überall gilt es einzugreifen. Integration, neuerdings Inklusion, heißt das Schlagwort, d.h. nachhaltige Eingliederung in die bestehende Ordnung. Die Politik kennt heute ja gerade als vorrangiges Ziel die Notwendigkeit, wie es im Vertrag der Großen Koalition von 2013 oder bei Reden des Bundespräsidenten heißt, den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu stärken. Vorauseilend sind hier übrigens oft Pädagogen tätig, die die Politik darauf aufmerksam machen, dass ihr ganze Teile der jungen Generation verloren (zu) gehen (drohen).
Einwände gegen Huiskens Analyse vom Standpunkt des Lehrerberufs aus formulierten auch Autoren, die der gelieferten Schulkritik gar nicht groß widersprechen wollen. So heißt es in einer Rezension der marxistischen Zeitschrift Z, dass Huiskens Kritik des gesamten Ausbildungsbetriebs und speziell der schulischen Wissensvermittlung zutreffe: Notengebung sei keine Hilfe, um den Nachwuchs mit Wissen zu versorgen, sondern das Gegenteil, ein Instrument der Selektion. Aber, so wird eingewandt: „Führt man diesen Gedanken konsequent weiter, hat ein Mensch, dem ernsthaft etwas am Wohl von Kindern liegt, der also aus ihnen keine opportunistischen Egoisten machen will, im Schuldienst nichts verloren. Dies sieht Hans-Peter Waldrich anders. In seinem Buch 'Der Markt, der Mensch, die Schule' beschreibt er unabhängig von Huisken die Mechanismen des 'Bulimielernens' und die Reduktion von Wissen zu 'Stoff', gesteht dem Lehrer aber zu, dass er gegen die Schule zumindest einzelne Schüler zu kritischem Denken heranführen kann.“ (Subtil 2008) Der Autor mag sich nicht recht entscheiden, ob man Waldrichs Argumentation zustimmen soll. Dass sie theoretisch schwach ist, wird – gerade auch mit Blick auf das Thema Schulamokläufe – in der Rezension zugestanden. Aber das herausgearbeitete Dilemma für den Pädagogen und seine berufliche Rolle, das aus Huiskens Kritik folge, soll diese wiederum relativieren.
Die Relativierung der theoretischen Einsicht zu Gunsten einer Bestärkung des praktisch-beruflichen Engagements wird hier explizit ausgesprochen. Dabei soll es nicht um die Würde des Berufsstands gehen, sondern um eine grundsätzliche Frage: Wenn die Schule funktionaler Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft ist und die Jugend im Griff hat, wie kann dann noch die Hoffnung keimen, dass es einmal anders wird, dass also stimmt, was im ältesten deutsche Protestsong beschworen wird: Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechtens besser aus!? Wenn man analytisch zugesteht, dass der Kapitalismus die Jugend in Beschlag nimmt, so die Argumentation der Zeitschrift Z, dann stirbt die Hoffnung: „Dass Lehrer eine systemstabilisierende Funktion haben – allein schon dadurch, dass sie Beamte sind – ist richtig, greift aber zu kurz: Das gegenwärtige System hält (bzw. hielt) auch Huisken selbst durch seine Tätigkeit als Professor am Laufen, so wie, strenggenommen, jeder Bäcker oder Gärtner es tut. So gesehen hat man als Linker nur zwei Optionen: Suizid, um das herrschende System nicht zu unterstützen, oder ein progressives Wirken in seinem Beruf, welcher auch immer es sei.“ (Ebd.) Weil man etwas verändern will, muss man in den bestehenden Berufsbildern ein Fortschrittspotenzial entdecken, also demgemäß seine Analyse ausrichten oder revidieren. Ein gar nicht subtiler, eher platt opportunistischer, an Aufklärung desinteressierter Gedanke!
Literatur
- Klaus Ahlheim, Scheingefechte – Zur Theoriediskussion in der politischen Erwachsenenbildung. Schwalbach/Ts. 2004.
- Armin Bernhard, Biopiraterie in der Bildung – Einsprüche gegen die vorherrschende Bildungspolitik. Hannover 2010.
- Deutscher Bundestag – Presse- und Informationszentrum (Hg.), Jugendprotest im demokratischen Staat (II) – Schlussbericht 1983 der Enquete-Kommission des 9. Deutschen Bundestages. Zur Sache, Nr. 1, 1983.
- Peter Dudek, Grenzen der Erziehung im 20. Jahrhundert – Allmacht und Ohnmacht der Erziehung im pädagogischen Diskurs. Bad Heilbrunn 1999.
- Peter Faulstich/Joachim Ludwig (Hrsg.): Expansives Lernen. Baltmannsweiler 2004.
- Rolf Gutte, Lehrer – Ein Beruf auf dem Prüfstand. Reinbek 1994.
- Freerk Huisken, Die Wissenschaft von der Erziehung – Einführung in die Grundlügen der Pädagogik. Kritik der Erziehung, Teil 1. Hamburg 1991.
- Freerk Huisken, Weder für die Schule noch fürs Leben – Von den Grundlügen der Pädagogik und dem unbestreitbaren Nutzen der bürgerlichen Lehranstalten. Kritik der Erziehung, Teil 2. Hamburg 1992.
- Freerk Huisken, Jugendgewalt – Der Kult des Selbstbewusstseins und seine unerwünschten Früchtchen. Hamburg 1996.
- Freerk Huisken, Erziehung im Kapitalismus – Vom unbestreitbaren Nutzen unserer Lehranstalten. Studienausgabe der Kritik der Erziehung Bd. 1 und 2. Hamburg 1998.
- Freerk Huisken, z.B. Erfurt – Was das bürgerliche Bildungs- und Einbildungswesen so alles anrichtet. Hamburg 2002.
- Freerk Huisken, Über „PISA-Schock“ und seine Bewältigung – Wieviel Dummheit braucht/verträgt die Republik? Hamburg 2005.
- Freerk Huisken, Erziehung im Kapitalismus – Von den Grundlügen der Pädagogik und dem unbestreitbaren Nutzen der bürgerlichen Lehranstalten. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Hamburg 2016a.
- Freerk Huisken, Über die Unregierbarkeit des Schulvolks – Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten usw. (Erstausgabe 2007) Neuausgabe, Hamburg 2016b.
- Johannes Schillo, (Rezension) F. Huisken, Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. In: SozialExtra, Nr. 5/6, 2007, S. 51-52.
- Georg Schuster, Jugendgewalt – Von „unerwünschten Früchtchen“, die nicht weit vom Stamm fallen. In: AUSWEGE – Perspektiven für den Erziehungsalltag, 25.6.2016, online: http://www.magazin-auswege.de/data/2016/06/Schuste….
- Alexander Subtil, Schule im Kapitalismus: Anmerkungen zu Freerk Huisken und Hans-Peter Waldrich. In: Z – Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Nr. 74, 2008, online: http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de.
September 2016
Darf man die psychologische Wissenschaft kritisieren?
Anfang 2016 erschien die dritte Auflage von Albert Krölls' „Kritik der Psychologie“, woraus sich eine engagierte Nicht-Diskussion entspann. Dazu eine Nachbetrachtung der IVA-Redaktion mit Beiträgen weiterer Autoren.
Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung seiner „Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes“ legte Albert Krölls Anfang 2016 eine überarbeitete Neuausgabe vor, die u.a. den bereits in der zweiten Auflage von 2007 aufgenommenen Diskussionsteil ergänzte und die These vom „modernen Opium“, also dem Nutzwert, den die psychologische Weltanschauung für die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft erbringt, ausführlicher begründete. Dieser Angriff auf den bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb und auf herausragende Autoritäten der Disziplin zog – bemerkenswerterweise in einem linken Periodikum, der Tageszeitung Junge Welt – heftigen Widerspruch auf sich. Michael Zander wertete eine solche Wissenschaftskritik als „unhaltbare Polemik“ und hielt es für einen Skandal, dass Krölls‘ Machwerk überhaupt „ins Programm eines linken Verlags aufgenommen“ wurde. Der Wortlaut von Zanders Rezension und die Auseinandersetzung damit sind auf dem IVA-Blog dokumentiert, wobei auch Krölls zu den einzelnen Vorwürfen Stellung nahm (vgl. IVA-Redaktion 2016b).
Im Folgenden werden einige Texte und Überlegungen nachgetragen, die im Umkreis von Krölls‘ Psychologiekritik entstanden sind. Zunächst dokumentieren wir die Rezension von Birgit v. Criegern zur Erstausgabe von Krölls‘ Buch, die die Junge Welt 2007 brachte. Dem folgen ein Leserbrief von Franz Anger an die Junge Welt, der auf den Totalverriss Zanders antwortete, und ein Statement von Georg Loidolt, der bereits auf seiner Homepage (http://lektoratsprofi.com/blog/) zum Vorwurf unmarxistischer Kritik Stellung nahm. Abschließend gibt es eine Nachbemerkung der IVA-Redaktion, die auf weitere Punkte einer Kritik an psychologischer Theoriebildung und praktischer Betreuung des bürgerlichen Seelenlebens eingeht.
Bitte wenig erwarten – Cool sein heißt angepaßt sein: Wie die Psychologie sich die Gesellschaft schön denkt (Birgit von Criegern)
„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere dogmatische Sicht von den Dingen,“ dekretierte schon Epiktet im Jahr 100 unserer Zeit. Proportional zur sich dynamisierenden gesellschaftlichen Krise mit forciertem Sozialkahlschlag und Militarisierung werden auch die Appelle an die Allgemeinheit gesteigert, bitte unbedingt positiv zu denken. In Psychotherapie und sogenannter Lebenshilfe hat diese Sozialtechnik „Positive thinking“ große Wirkung gezeitigt. Sinn und Unsinn dieses Konzepts verdeutlicht Albert Krölls, Sozialforscher und Professor für Recht an der Evangelischen Hochschule Hamburg, in seinem neuen Buch „Kritik der Psychologie“. Es geht um Machbarkeit und gesellschaftliche Macht.
Krölls wendet sich gegen die allgemeine Reparatur-Logik der Psychologie und speziell gegen das Prinzip der „Steuerung“. In knapp gehaltenen Artikeln resümiert er die verschiedenen psychologischen Schulen. Krölls‘ Analyse hat der Beratergesellschaft gerade noch gefehlt: streitbar, sarkastisch im Tonfall, aber entschieden in der Sache. Seine These: In der Psychologie zeige sich die „wissenschaftliche Sehnsucht nach einem gesetzmäßig funktionierenden Staatsbürgerwillen“. Nach Krölls verfolgt der „psychologisch verbildete Mensch“ das Ziel, die eigene Funktionsfähigkeit im kapitalistischen System zu sichern. Dabei wird ihm von Psychotherapeuten mittels „abgrundtief menschlichem Verständnis“ geholfen. Ihre Ratschläge lauten ungefähr: „die Realität annehmen“, „weniger Erwartungen haben“, „Dankbarkeit erleben“ – gemeint ist schlicht die „Anpassung an die Sachzwänge des Kapitalismus“.
Einbildung als Bildung. Krölls zufolge klammert die Psychologie den direkten Antrieb für Handeln aus, da mögen sich die Menschen noch so sehr einbilden, Herren ihrer Zwecke zu sein. Damit blendet die gegenwärtige Psychologie jedwede äußere, das heißt soziale oder politische Ursache für menschliche Probleme aus. Familiensorgen, Ängste, Kriminalität erscheinen dann als bloße Formen persönlichen Scheiterns, verursacht durch dunkle Triebe. Erst mit der „Selbststeuerung“ führt die Psychologie, durch die Hintertür, eine Willenskraft des Menschen ein. Krölls erläutert das an dem verhaltenswissenschaftlichen Ideal der Selbstkontrolle im Behaviorismus nach Burrhus Frederic Skinner, das selbstverständlich in jeweilig vorgefundene Herrschaftsstrukturen eingebettet ist. Die Strukturen, das heißt die äußeren Gründe für Probleme, sollen ja auch erhalten bleiben.
Die „Selbststeuerung“ von Gefühlen und Gedanken wird in der Verhaltenstherapie eingesetzt, um eine gewünschte Verhaltensänderung zu erreichen. Historisch ging die Verhaltenstherapie aus dem Pawlowschen Behaviorismus hervor. Demgemäß kann Verhalten nach gleichen Prinzipien erlernt, aufrechterhalten und auch wieder verlernt werden. Solche psychotherapeutischen Verfahren gewinnen zunehmend an Bedeutung, wie dem aktuellen Gesundheitsbericht der Bundesregierung zu entnehmen ist. Seit 1998 hat sich die Zahl der psychologischen Psychotherapeuten mehr als verdoppelt. In steigendem Maße werden Angst- und Streßstörungen behandelt. An der behandlungswürdigen „Burn-out“-Streßerkrankung leiden etwa 40 Prozent der Beschäftigten. Die Symptome werden mit Gefühlen der Kraftlosigkeit und Selbstzweifeln beschrieben. „Selbstvertrauen stärken, eigene Ressourcen erkennen“. Die Ansätze vieler Verhaltenstherapien für einen Umgang mit „Burn-out“ sind grundsätzlich realitätsfern gehalten, insofern die gesellschaftliche Realität als unveränderbar angenommen wird, der sich der einzelne optimal anzuschmiegen hat.
Antidepressiva. Für die Regierung ist der Fall klar: Depressionen sind auf dem Vormarsch, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit, mindestens vier Millionen Menschen sind davon bundesweit jährlich betroffen. 1999 wurde ein „Kompetenznetzwerk“ ins Leben gerufen, das größte Projekt des Gesundheitsministeriums zur Bekämpfung von Depressionen aller Zeiten. Mit einem Neun-Millionen-Euro-Etat wird unter anderem die Medikamentenforschung subventioniert. Einem Bericht der Techniker Krankenkasse zufolge hat bei Erwerbslosen die Zahl der verschriebenen Antidepressiva seit 2000 drastisch zugenommen.
In der gesellschaftlichen Krise boomt die Verhaltenspsychologie. Beispielsweise in der Hans-Böckler-Schule, einer Berufsschule in Berlin-Kreuzberg. Bei einigen Schülern (im Alter zwischen 16 bis 19) wird seit drei Jahren ein Training erprobt, um „abweichende“ Verhaltensweisen zu verändern. Das Training haben die Pädagogen Roland Büchner und Martin Ziegler entwickelt, die dafür im vergangenen Jahr den Projektpreis „Im Netz gegen Rechts – Arbeitswelt aktiv“ bekamen.
Was sind die „abweichenden“ Verhaltensweisen? Im Konzept des von Büchner/Ziegler ersonnenen „Konfrontativen Sozialen Kompetenztrainings“ (KSK), auch „Anti-Aggressivitätstraining“ genannt, ist die Antwort komplex: Da ist von „delinquent/devianten Verhaltensmustern“ und Gewaltbereitschaft bei Schülern die Rede sowie von Lernschwächen und Respektlosigkeit. Die Zielvorgaben sind umfassend: Die Jugendlichen sollen u.a. „sich selbst und ihre Gefühle besser kennenlernen (…), die Chance verbessern, sich in die Berufswelt zu integrieren, (…) lernen, sich an Regeln und Absprachen zu halten (…)“. Dabei folgt „das KSK einem optimistischen Menschenbild: den Menschen mögen, aber mit seinem abweichenden Verhalten nicht einverstanden sein!“
Totale Sozialisation. Der Ansatz der KSK-Pädagogen fordert die totale Sozialisation auf kleinem Raum in bestimmter Zeit. Zum Inhalt des Trainings gehört „Verhaltensübung“ bei Konfliktsituationen, in Rollenspiel und Gesprächskonfrontation, mit schriftlichen und mündlichen Befragungen. Das KSK-Training basiert u.a. auf der Lerntheorie von Albert Bandura, nach der jedes nicht-angeborene, angestrebte Verhalten kognitiv vermittelt werden könnte. Vorausgesetzt, daß die Teilnehmer in unterschiedlich schwierigen Situationen auf „Coolness“ trainiert werden, soll diese Methode zum Ausbügeln aller gesellschaftspolitischen Mißstände geeignet sein. Die KSK- Pädagogen stehen nicht nur mit Polizei und Justiz in Kontakt, sie rufen zur verstärkten Zusammenarbeit mit diesen Institutionen auf. „Uncooles“ Verhalten ist in erster Linie ein Sicherheitsproblem, wie sich migrantenfeindliche Politik und der Abbau subventionierter Ausbildungsplätze auf das Aggressionspotential von Jugendlichen auswirken – hierüber wird weiter geschwiegen. Im „Infopaket“ des Berliner Bildungssenators zur Gewaltprävention an Schulen ist dann auch konsequent von „gewaltbelasteter Erziehung“ in den Familien, nicht aber von deren soziopolitischem Kontext die Rede. Beim Amt für Jugendförderung in Kreuzberg-Friedrichshain bekundet man starkes Interesse am KSK-Training. Auch hier meint die Sprecherin: „In den Familien fehlen oft die Ressourcen für die Erziehung“.
(Die Autorin bezog sich auf die Erstausgabe von Krölls‘ „Kritik der Psychologie“ aus dem Jahr 2006 und auf die Dokumentation der Friedrich Ebert-Stiftung zur „konfrontativen Pädagogik“, vgl. Koch-Laugwitz/Büchner 2005; zudem verwies sie auf Jurk 2008.)
Unhaltbare Rezension (Franz Anger)
Da Michael Zander sich darauf kapriziert zu haben scheint, die marxistisch-leninistische Ideologie um die Psychologie zu bereichern, ist ihm Albert Krölls' fundamentale „Kritik der Psychologie“ ein Dorn im Auge. Darum will er Krölls' Darlegungen als „unhaltbare Polemik“ diskreditieren, indem er dem Kritiker beispielsweise die Aussage unterstellt, die Psychologie interessiere sich überhaupt nicht für die Handlungszwecke der Individuen. Widerlegt wird diese haltlose Unterstellung des Rezensenten dadurch, dass im Krölls-Buch zu lesen ist: „Psychologen haben … ein lediglich bedingtes (sic!) Interesse am Willensinhalt“ (Krölls 2016, 18). Denn der „zweckbestimmte Inhalt der Handlungen“ fungiere im Rahmen psychologischer Erklärungen „in der Regel (sic!) lediglich als bloßer Anknüpfungspunkt oder Material für Rückschlüsse auf die im Inneren des Menschen angelegten tieferen Ursachen ihres Tuns“ (ebd., 21).
Angesichts dieses Textbefundes kann man dem schludrigen Psychologie-Apologeten namens Zander nur raten, die Krölls'sche Schrift sorgfältig zu studieren, um eine niveauvolle Rezension verfertigen zu können. Nicht zurückfallen sollte Zander dabei hinter die Erkenntnisse, die Alfred Schmidt über die Unvereinbarkeit von Marx'schem Materialismus und Freud'schem Idealismus dargelegt hat: Freud sei kein Materialist, weil dessen „Lehre vom Unbewussten“ eine „'innerpsychische' Erklärung psychischer Vorgänge“ liefere, die „dem Unbewussten eine Eigengesetzlichkeit“ zuschreibe. Materialismus hingegen bedeute, „dass Geistiges (oder Psychisches) aus einem ihm Transzendenten, 'Materiellen'“ erklärt werde. (Schmidt 1970, 32*f)
Zur Verweigerung der Diskussion determiniert? (Georg Loidolt)
„Wären Handlungen arbiträr, d.h. würden nur auf die nicht weiter zurückführbaren Größen ‚Willen‘ und ‚Bewusstsein‘ beruhen, dann wäre auch der historische Materialismus hinfällig“ (Zander 2016), lautet der Einwand von Michael Zander gegen Albert Krölls‘ Kritik der Psychologie. Von dem Grammatikfehler dieses Satzes abgesehen, findet sich hier meines Erachtens der grundlegende Fehler der Protagonisten des psychologischen Determinismus. Ist das Handeln nicht determiniert, so lässt es sich nicht erklären, meinen sie. Sobald man beim Handeln auf Willen und Bewusstsein der betreffenden Personen rekurriere, würde man in der Erklärung willkürlich – also arbiträr – verfahren. Menschliches Handeln wäre beliebig, zufällig, keiner Erklärung zugänglich, wenn man mit diesen Begriffen operiere; es könne nur dann erklärt werden, wenn es determiniert sei.
Wille und Bewusstsein sind aber trotz ihrer relativen Freiheit, die sich negativ auch in Fehlurteilen und Ideologien betätigt, keine abstrakten Wesenheiten, die willkürliche Inhalte produzieren. Das Handeln der Menschen ist keinem Instinkt unterworfen, es beruht auf Urteilen und Überzeugungen, die zwar unterschiedlich sein können, aber dennoch eine argumentative Logik aufweisen und dadurch auch einer Veränderung zugänglich sind. Wenn nun moderne Zeitgenossen mit falschen Urteilen über die bürgerliche Gesellschaft auf- und antreten, so nicht deswegen, weil die bürgerliche Herrschaft auch ihr Denken determinieren würde. Es verhält sich vielmehr so, dass sie in dieser Gesellschaft erfolgreich sein wollen und sich die Urteile über diese Gesellschaft entsprechend zurechtlegen. So halten sie daran fest, dass es doch nur an ihrem Arbeitseinsatz und ihrer Leistungsfähigkeit liegen kann, ob sie erfolgreich sind, und stellen eher sich selbst als diese Gesellschaft in Frage, wenn der Erfolg trotz allem Bemühen ausbleibt. Andernfalls müssten sie es nämlich hinnehmen, dass die bürgerliche Gesellschaft keine Einrichtung für ihre Zwecke ist, vielmehr für den Großteil ihrer Mitglieder ziemlich trostlose Perspektiven bereithält. Und dann wäre es vorbei mit dem trostreichen Gedanken, dass man sich hier beheimatet fühlen kann, man würde sich letztlich sogar mit Kritikern der bürgerlichen Gesellschaft gemein machen, die wegen ihrer Weltfremdheit die Häme der Mehrheit abkriegen…
Wenn das menschliche Handeln seinen Ausgangspunkt in Wille und Bewusstsein der Gesellschaftsmitglieder hat, so ist es deswegen also noch lange nicht arbiträr, umgekehrt aber auch nicht determiniert. Es hängt vielmehr von den Einsichten der Menschen in ihre gesellschaftlichen Verhältnisse ab, welche Urteile sie darüber fällen und welche Ziele sie sich setzen. Diese Urteile sind zwar nicht determiniert, weisen aber eine mehr oder weniger logische Konsistenz auf, weswegen sie auch keineswegs unter das Verdikt der Beliebigkeit & Zufälligkeit fallen. Ihre Logik, die sich aus der Bereitschaft zur Bewährung in der vorgegebenen Konkurrenzordnung ergibt, ist es nun wiederum, die Wille und Bewusstsein durch Kritik angreifbar macht – was bei vollkommen willkürlichen, jeder Logik baren Urteilen ein Ding der Unmöglichkeit wäre.
Nachbemerkung
Die vorstehenden Texte gehen noch einmal auf Punkte ein, die bei der Kritik des psychologischen Wissenschaftsbetriebs von Bedeutung sind. Außerdem werfen sie weiter gehende Fragen auf. Die Auseinandersetzung mit den – tiefenpsychologischen oder behavioristischen – Koryphäen deterministischer Seelen-Konstruktion erschöpft ja nicht das Problemfeld, das Krölls als Psychologisierung der bürgerlichen Lebensverhältnisse dingfest gemacht hat. Im IVA-Blogeintrag „Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus“ (IVA-Redaktion 2016a) wurde bereits auf die diagnostische und therapeutische Behandlung seelischer Krankheiten eingegangen, die heutzutage ein vorrangiges Thema der öffentlichen Gesundheitsversorgung darstellen. Birgit von Criegern hat in ihrem Text auf die Studie von Charlotte Jurk aufmerksam gemacht, die sich dem Aufstieg der Depression von einem Symptom persönlicher Verstimmung – ursprünglich in christlicher Perspektive ein sündhaftes Verhalten, dann ein Leiden der leisure class – hin zur Volkskrankheit der globalisierten Marktwirtschaft widmet. Die Autorin greift die herrschende Diagnostik an, sieht aber in dem mittlerweile durchgesetzten Krankheitsbild eine systemgemäße Zeiterscheinung: „In einer Gesellschaft, die die seelischen Ressourcen ihrer Mitglieder als arbeits- und verwertungsrelevant anzapft, in der Glück als Pille käuflich ist und Einsamkeit zur ‚Autonomie’ hochstilisiert wird, muss der niedergeschlagene Mensch krank sein. Eine steigende Anzahl psychischer ‚Abweichungen’ speist das medizinische Versorgungssystem in einer gut geölten Maschinerie mit Medikamenten und Verhaltenstherapie ab“ (Jurk 2008, 200).
Diese „Medikalisierung“ einer gesellschaftlichen Notlage, die Erklärung des „erschöpften Selbst“ (Ehrenberg 2008) zum Patienten, ist selber ein kritikwürdiger Sachverhalt, unabhängig davon, dass dazu heute die Neurowissenschaft ihre spezifische Biologisierung beisteuert und die Pharmaindustrie dem mit ihren Medikament-Innovationen assistiert bzw. vorauseilt. Jurks Analyse zeigt – so schreibt Renate Dillmann (2008) in einer Besprechung der Studie –, dass der jüngste neurobiologische „Aufschwung einen Rückschritt hin zu den biologistischen Konzepten der Psychiatrie vor 100 Jahren (Kraepelins Erfindung der ‚endogenen Depression‘ etc.) bedeutet und in keiner Weise eine Erklärung der Gefühls- und Gedankenwelt depressiver Patienten leistet. ‚Traurigkeit ist berechtigte Daseinsäußerung‘, hält sie dagegen und kritisiert das Manipulationsideal einer neurobiologisch aufgerüsteten Humanwissenschaft, die das ‚neoliberale‘ Leitbild des selbst gesteuerten, allzeit leistungsbereiten und leistungsstarken Individuums hochhält.“ (Dillmann 2008) Die neurowissenschaftliche Mode kommt übrigens – wie die Auseinandersetzung mit Einwänden von Seiten des historischen Materialismus – auch im Haupt- und Diskussionsteil von Krölls‘ Buch zur Sprache (zur Hirnforschung siehe Krölls 2016, 33ff; zur Determination des Bewusstseins durch das gesellschaftliche Sein siehe ebd., 220ff).
Krölls ist in seinem Buch ebenfalls darauf eingegangen, dass er nicht der Einzige oder Erste ist, der eine solche Kritik an der wissenschaftlichen Psychologie versucht. Er hat z.B. auf Marx fußenden oder sich berufenden Kritikansätzen – dem „Psychomarxismus“ der Kritischen Theorie oder der „Subjektwissenschaft“ von Klaus Holzkamp – eigene (Unter-)Kapitel gewidmet (vgl. ebd., 79ff, 126ff). Zeitgleich zu Krölls hat auch der Schweizer Psychologieprofessor Mark Galliker eine Studie unter dem Titel „Ist die Psychologie eine Wissenschaft?“ (Galliker 2016) vorgelegt, die – allerdings aus ganz anderem Geist – eine grundsätzliche Infragestellung der Disziplin vornimmt. Galliker geht es um die grundlegende Frage, ob die akademische Psychologie angesichts ihrer „aktuellen Krise“ überhaupt dem „Anspruch der Wissenschaftlichkeit und insbesondere der Naturwissenschaftlichkeit zu genügen vermag“ (ebd., IX). Die Antwort des Autors – der ebenfalls selektiv verfährt, z.B. die gesamte Tiefenpsychologie ausklammert – ist alles andere als beruhigend. Die Bilanz des Buchs zu den einschlägigen Kontroversen des Fachs fällt negativ aus. Den Ausweg aus der unbefriedigenden Situation sieht Galliker darin, die „Invasion der Mathematik in das psychologische Denken und Urteilen“ (ebd., 237) zurückzudrängen und wieder neu den „Primat der Theorie“ (ebd., 25) zu etablieren. Das schließe ein, dass „Psychologie primär als Sozialwissenschaft zu verstehen“ sei (ebd., 239). Diplomatisch gesteht der Autor allerdings zu, dass der Psychologie auch die Aufgabe obliege, „die naturwissenschaftlichen Momente zu involvieren“ (ebd.).
Solche Selbstdestruktionen sind übrigens im modernen Wissenschaftsbetrieb nicht anstößig; hier wird von Kollegen keine unhaltbare Polemik entdeckt. Logischerweise, denn das Kleinmachen der eigenen Leistungsbilanz dient dazu, sich in der Hochschullandschaft neu aufzustellen, um erfolgreich in die „Selbstbehauptungsdiskurse des 21. Jahrhunderts“ (ebd., 189) einzusteigen – wobei es nicht um die Durchsetzung von Erkenntnissen geht, sondern um die Selbstbehauptung und das Profil einer Zunft, die nicht von anderen niederkonkurriert werden will. Einem solchen Vorhaben lässt sich dann leicht die Versicherung hinzufügen, man müsste sich stärker gesellschaftlich oder gesellschaftswissenschaftlich orientieren. Verbessert ist damit noch nichts, es kommt alles darauf an, wie die jeweiligen Sachverhalte erklärt werden. Solche gesellschaftlichen Erweiterungen der bürgerlichen Psychologie sind bzw. waren eine Domäne marxistisch-leninistischer Psychologie. Einen Vertreter dieser Abteilung, den 1962 verstorbenen, weitgehend vergessenen französischen Entwicklungspsychologen Henri Wallon, hat Michael Zander in der Jungen Welt vor zwei Jahren mit einem eigenen Essay gewürdigt. Der Text ist eine eigenartige Hymne auf die Verdienste eines Wissenschaftlers. Angesichts von Zanders scharfer Reaktion, wenn er Kritik am Wissenschaftsbetrieb zur Kenntnis nimmt, sei aus diesem Text beispielhaft einiges erwähnt, ohne dass hier in eine nähere Befassung mit dem verdienten KP-Mitglied Wallon eingetreten werden soll.
Ein großer Teil von Zanders Würdigung widmet sich der Biographie des Wissenschaftlers (Mitglied der „Gesellschaft für das Neue Russland“, Teilnahme am spanischen Bürgerkrieg, Mitarbeit in der Résistance, mit Lacan befreundet…) – eine bemerkenswerte Bilanz! Interessanterweise sah Wallon allein im Aufbruch Sowjetrusslands Chancen für ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, während unter bürgerlichen Verhältnissen die Wissenschaft verkomme: „Die Psychologie in den kapitalistischen Ländern“, so referiert Zander Wallon, „spiegele deren soziale Verhältnisse wider.“ (Zander 2014) Dieses Generalverdikt über die Arbeit der Kollegen ist natürlich keine unhaltbare Polemik, sondern die korrekte Anwendung der Widerspiegelungstheorie. Wenn das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein determiniert, müssen bürgerliche Wissenschaftler im Geld- und Kapitalfetisch befangen bleiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte Wallon sich dann laut Zander etwas gemäßigter in seinem Urteil über den Stand der Disziplin, und der Entwicklungspsychologe durfte auch bei der Schulreform in Frankreich mitwirken; Anregungen wurden in de Gaulles Schulpolitik aufgenommen. Zander berichtet über den Langevin-Wallon-Plan: Dieser „sah ein einheitliches Bildungssystem, angefangen beim Kindergarten über die Grund- bis hin zu weiterführenden Schulphasen vor. Für behinderte Kinder sollten spezielle Klassen eingerichtet werden. Alle Schüler sollten ab dem 15. Lebensjahr neben einem weiterhin gemeinsamen Unterricht an gesonderten Kursen teilnehmen, die ihren Fähigkeiten, Interessen und künftigen Berufslaufbahnen entsprechen. Der Psychologie sollte dabei die Rolle zufallen, die Potentiale der Schüler wissenschaftlich zu ermitteln. Hier zeigt sich eine deutliche Differenz zwischen Wallon und dem Ehepaar Freinet. Alle drei waren überzeugte Sozialisten, doch während die Freinets den repressiven Charakter der bürgerlichen Schule und die Selbstbestimmung der Schüler betonten, ging es Wallon hauptsächlich darum, allen Zugang zu einer republikanischen Schule zu verschaffen.“ (Ebd.) Eine interessante Aufgabe der marxistischen Psychologie: die Potentiale der Schüler zu ermitteln, damit der Nachwuchs effektiver die Leistungskonkurrenz des bürgerlichen Schulbetriebs durchläuft! Selbst Zander konstatiert (im Anschluss an Freinets Einspruch) eine „aus heutiger Sicht fast naive Vorstellung, die Schülerbiographie lasse sich von den Anfängen bis zur Berufswahl pädagogisch durchplanen“ (ebd.), hält Wallon aber zugute, dass er die Schulpsychologie außerhalb des unmittelbaren Selektionsprozesses verorten wollte: „Schulpsychologen, so Wallon, sollten Kindern helfen, sich selbst zu entdecken; statt auf schulische Selektion solle ihre Arbeit darauf gerichtet sein, das kulturelle und Bildungspotential jedes Individuums möglichst umfassend zu entwickeln.“ (Ebd.) Und auch das muss noch in der Würdigung des marxistischen Pioniers erwähnt werden: „Obwohl der Langevin-Wallon-Plan letztlich im Parlament nicht angenommen wurde, gilt er als einflußreich für die Bildungspolitik in Frankreich.“ (Ebd.) Ein erstaunliches Lob: Der Mann hat sogar für die französische Bildungspolitik – von der gaullistischen Schulpolitik mit ihren Eliteeinrichtungen bis hin zur Einbindung in den Lissabon-Prozess – Vorarbeiten geleistet, wird zumindest in dieser Hinsicht anerkannt!
Dabei wäre Wallons schulpsychologische Aufgabenstellung, „die Potentiale der Schüler wissenschaftlich zu ermitteln“, genau ein Fall der von Krölls kritisierten deterministischen Konstruktion, und sie gibt in ihrer „republikanischen“ Zielsetzung, den Nachwuchs der Nation flächendeckend und leistungsgerecht zu erfassen, ja auch ihre Nützlichkeit für den bürgerlichen Betrieb zu erkennen. Schule im Kapitalismus organisiert die Vorsortierung des „Humankapitals“ für den Arbeitsmarkt als Leistungskonkurrenz, indem sie bei den angelieferten Unterschieden des Schülermaterials ansetzt und daraus einen systematischen Unterscheidungsprozess macht, der jeweils über den Fortgang oder Ausschluss von Bildungskarrieren entscheidet. Das, was mit der Schuljugend angestellt wird, soll aber Ausdruck der inneren Anlagen der Person sein. Die – vorläufige – Zuweisung zu Positionen in der Hierarchie der Berufe sei, so die große Lüge der Konkurrenzgesellschaft, nichts anderes als die Ermöglichung der persönlichen Entfaltung, nämlich das, was in einem steckt, gesellschaftlich gültig zu machen. Die Konkurrenz soll man also als ein einziges Bemühen darum betrachten, dem Einzelnen gerecht zu werden. Und hier assistiert die Schulpsychologie als Überhöhung der normalen Leistungsbewertung. Sie bestätigt, dass in den Individuen Potenziale an Intelligenz oder Kompetenzen ruhen, die determinieren, was sich aus den Kandidaten jeweils machen lässt. Psychologie à la Wallon beglaubigt mithin die Gerechtigkeit des schulischen Verfahrens, indem sie gegen die Zufälligkeiten, die bei der Notengebung auftreten mögen, auf dem rein leistungsorientierten Einblick in das jeweilige Vermögen der Schülerpopulation besteht und sich notfalls korrigierend einmischt, z.B. einem Arbeiterkind, dessen Anlagen vielversprechend sind und zum Aufstieg in höhere Positionen berechtigen, gegen möglicherweise vorhandene Vorurteile in der Lehrerschaft zum Fortkommen verhilft.
Zanders Fazit lautet (ebd.): „Insgesamt fällt die Bilanz vorerst zwiespältig aus: Einerseits war Wallon ein progressiver und vielseitiger Intellektueller, der für den Sozialismus und gegen den Faschismus kämpfte, der die Psychologie und Soziologie seiner Zeit kritisch verarbeitete und der sich energisch für eine Reform des Bildungswesens einsetzte. Andererseits scheint er die Planbarkeit der kindlichen Sozialisation überschätzt und diese zu wenig unter genuin gesellschaftlichen Gesichtspunkten untersucht zu haben. Das eher kritische Bild, das hier von seiner Entwicklungspsychologie gezeichnet wurde, könnte allerdings korrigiert und differenziert werden. Notwendig und sicher lohnend dafür wäre eine wissenschaftlich kommentierte Neuausgabe seiner wichtigsten Schriften, die momentan zum Teil schwer zugänglich sind und nur in zahllosen verstreuten Aufsätzen vorliegen.“ Dazu kein weiterer Kommentar! Es sei nur erwähnt, dass Lucien Sève, ein anderer akademisch anerkannter marxistisch-leninistischer Psychologie-Pionier (dem der Argument-Verlag gerade eine Neuedition widmet, vgl. Sève 2016), seinen Vorgänger Wallon in ähnlicher Weise gewürdigt hat. Er lobte den Langevin-Wallon-Plan in den höchsten Tönen – „nicht bloß ein ‚hochherziger‘ Plan, sondern ein realistischer Plan, nicht ein demokratischer Plan schlechthin, sondern ein wissenschaftlicher Plan“ (Sève 1973, 15). Und er fragte die „französische Bewegung für eine demokratische Schule“, ob sie auch immer der Tatsache eingedenk sei, dass sie diese „unschätzbar wertvolle politische Waffe“, nämlich den „festen Halt des Langevin-Wallon-Plans“, „großenteils den Fortschritten der französischen wissenschaftlichen Psychologie der Vorkriegszeit zu verdanken hat, Ergebnissen der Vorstöße großer materialistischer Wissenschaftler wie Wallon…“ (ebd.).
Texte marxistischer Wissenschaftskritik finden sich im Netz übrigens unter: http://www.wissenschaftskritik.de/fach/psychologie…. Dort gibt es z.B. kritische Analysen zum Vorgehen der psychologischen Disziplin (vgl. Decker 2016), zu einzelnen Koryphäen des Fachs wie zu Begründern wissenschaftlicher Schulen (S. Freud, B.F. Skinner, C. Rogers, R. Tausch, E. Fromm…), ferner einen Beitrag zum oben erwähnten Lerntheoretiker Albert Bandura („Banduras ‚kognitive‘ Komplettierung des behavioristischen Fehlers“) oder zum Fortschritt der Neurowissenschaften und deren dubiosen Leistungen in Sachen Willensfreiheit („Naturwissenschaftler klären auf über ‚Geist & Gehirn‘, ‚Bewusstes & Unbewusstes‘, ‚Willensfreiheit & Determination‘: Machen die Ergebnisse der modernen Hirnforschung aus der Psychologie des Seelenapparates eine materialistische Wissenschaft?“). Dokumentiert ist dort zudem eine marxistische Kritik am „Beruf: Psychologe“ (aus den „Jobs der Elite“ von 1987). Einzelne Beiträge sind hier auch als Mitschnitte von Vortragsveranstaltungen verfügbar. Zur Einführung empfiehlt sich etwa der Text „Was gegen psychologisches Denken spricht“ (http://www.wissenschaftskritik.de/was-gegen-psycho…), der aus den 1980er Jahren stammt (Sozialistische Hochschulzeitung, Nr. 37) und Einblick in die seinerzeit an den Hochschulen betriebene Kritik des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs gibt. Leider kann man von den Schriften nicht behaupten, dass sie „einflussreich“ für den modernen wissenschaftlichen Diskurs gewesen sind…
Literatur
- Birgit von Criegern, Bitte wenig erwarten – Cool sein heißt angepaßt sein: Wie die Psychologie sich die Gesellschaft schön denkt. In: Junge Welt, 4. 1. 2007.
- Peter Decker, Die Psychologie – Sachzwänge des Subjektseins. Auszug aus: P.D., Die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Online: http://www.wissenschaftskritik.de/die-psychologie/, 8.9.2016.
- Renate Dillmann, Depression (Rez. zu Jurk 2008). In: Erwachsenenbildung, Nr. 4, 2008.
- Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst – Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt/M. 2008.
- Mark Galliker, Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Ihre Krisen und Kontroversen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden 2016.
- IVA-Redaktion, Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus. 13. 6. 2016a, online: http://www.i-v-a.net, Texte Juni.
- IVA-Redaktion, Mit Kritikern des (psychologischen) Determinismus diskutiert man nicht! 23. 7. 2016b, online: http://www.i-v-a.net, Texte Juli.
- Charlotte Jurk, Der niedergeschlagene Mensch. Depression – Geschichte und gesellschaftliche Bedeutung einer Diagnose. Münster 2008.
- Ursula Koch-Laugwitz/Roland Büchner, Konfrontative Pädagogik – Neue Handlungsstrategien im Umgang mit Kindern als Täter und Opfer. Herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2005.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- Alfred Schmidt, Vorwort zum Reprint der Zeitschrift für Sozialforschung. München 1970.
- Lucien Sève, Marxismus und Theorie der Persönlichkeit. Frankfurt/M. 1973.
- Lucien Sève, Die Welt ändern – das Leben ändern. Neuausgabe des Klassikers „Marxismus und Theorie der Persönlichkeit“, herausgegeben von Klaus Weber. Hamburg 2016.
- Michael Zander, Prominenter Unbekannter – Porträt. Vor 135 Jahren wurde der marxistische Entwicklungspsychologe Henri Wallon geboren. In: Junge Welt, 14. Juni 2014.
- Michael Zander, Unhaltbare Polemik – Neuauflage von Albert Krölls’ „Kritik der Psychologie“ im VSA-Verlag erschienen. In: Junge Welt, 6. Juni 2016.
TTIP: Zerwürfnis in der Freihandelskumpanei
Am Samstag, dem 17. September 2016, findet in Köln eine der sieben regionalen Demonstrationen gegen TTIP, die „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“, statt. Dazu ein Flugblatt und eine Veranstaltungsankündigung von Gegeninformation Köln.
In sieben deutschen Städten demonstriert am Samstag, dem 17. September 2016, ein breites Anti-TTIP-Bündnis gegen die von der EU projektierte „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“, deren Verhandlungen Wirtschaftsminister Gabriel jüngst für – mehr oder weniger – gescheitert erklärt hat, sowie gegen das kanadische Pendant CETA, das ähnlich gelagert ist, aber trotzdem in Kraft gesetzt werden soll – wenn es nach dem Willen der Regierenden in Deutschland und Europa geht. Gegeninformation Köln wird bei der Demonstration ein Flugblatt verteilen, das wir im Folgenden dokumentieren (Informationen zum Kölner Demo-Ablauf finden sich unter: http://ttip-demo.de/bundesweiter-demo-tag/koeln/).
Außerdem wird Gegeninformation am Donnerstag, dem 22. September, in Köln im Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Clubraum, Melchiorstraße 3, 50670 Köln, Nähe Ebertplatz, Beginn: 20 Uhr) eine Diskussionsveranstaltung zum Thema TTIP & CETA durchführen (nähere Informationen unter: http://gegeninformation.org/). Eine weitere Diskussionsveranstaltung wird in Dortmund, und zwar am Dienstag, dem 25. Oktober, folgen; nähere Informationen dazu finden sich unter: http://kritik-und-argumente.de/.
Streit um TTIP in Zeiten globaler Krisenkonkurrenz: Regierende Standortnationalisten zweifeln heftig an ihrer Freihandelskumpanei
Teilen deutsche Wirtschaftspolitiker, die für den profitablen Absatz deutscher Dieselautos auf der ganzen Welt jeden Umwelt-Beschiss ihrer Vorzeige-Konzerne mitmachen, auf einmal die Befürchtungen, TTIP sei schlecht für die Umwelt? Wohl kaum!
Haben französische und deutsche Staatsleute nun Bedenken gegen TTIP wegen Verschlechterungen bei den Schutzstandards für lohnabhängig Beschäftigte – obwohl der französische Staat die nationale Krise gerade mit einem Großangriff auf die soziale Lage der arbeitenden wie arbeitslosen Franzosen bekämpft und deutsche Politiker solche radikalen „Spar-“ und „Reformprogramme“ sowieso seit Jahr und Tag für ganz Europa fordern? Wer soll das glauben!
Wenn jetzt führende Politiker in Europa und den USA gegen TTIP wettern, dann kalkulieren sie anders, als sie es bisher getan haben. Der Standpunkt, von dem aus sie kalkulieren und an dem sich jeder Protest von unten noch stets die Zähne ausgebissen hat, ist aber ein und derselbe.
Es ist der überall regierende Standpunkt, dass die nationalen Kapitale wachsen müssen – unbedingt. TTIP sollte dafür die Wunderwaffe sein: mehr Kapitalwachstum durch mehr grenzüberschreitende Freiheit beim Handeln und Investieren! Darum ist TTIP ehrlicherweise noch nie damit angepriesen worden, mit ihm würden Löhne und Gehälter steigen, überhaupt die Lebensverhältnisse der Menschen angenehmer oder sauberer – darum ging es ja auch nie. Immer war klar, dass mehr Kapitalfreiheit vor allem mehr Konkurrenz zwischen den Firmen bedeutet, die dafür ihr Personal auf wachsende Leistung zu sinkenden Kosten trimmen; und mehr Konkurrenz zwischen den Staaten, die ihren Völkern per Dauer-„Reformen“ Druck aufs nationale Lohnniveau bescheren. Weil und solange diese Standortpolitiker entfesselte Konkurrenz mit mehr transatlantischem Wachstum gleichsetzten, von dem sie für ihre Nation möglichst große Teile sichern wollten, war für sie auch klar: Wenn Umwelt-, Sozial- und sonstige Standards dabei Konkurrenzhemmnisse, also Wachstumshemmnisse sind, gehören sie weg – eine schöne Auskunft aus berufenem Munde darüber, was diese Standards tatsächlich immer schon in erster Linie sichern sollten.
Wegen der weltweiten Wachstumskrise des Kapitals zweifelt dieser politische Standpunkt mittlerweile am nationalen Nutzen der TTIP-Kooperation mit den transatlantischen Konkurrenten. Mehr transatlantisch vereinbarte Kapitalfreiheit erscheint vielen der früher Freihandels-begeisterten Politiker jetzt nicht mehr als das Mittel für mehr Wachstum. Ihre unversöhnlichen Positionen im Streit um TTIP machen deutlich, dass das mit dem Projekt von beiden anvisierte Wachstum für ihre nationalen Kapitale nicht als Anteil an einem transatlantischen Gesamtwachstum zu haben ist, sondern nur noch durch das Wegnehmen und die nationale Monopolisierung von Geschäftsgelegenheiten, durch das Abwälzen von Krisenfolgen auf die anderen. Darum geraten die Verhandlungen so unversöhnlich; darum kommt die geplante imperialistische Kumpanei, die sich erklärtermaßen auch gegen Dritte richtet, neuerdings auf beiden Seiten des Atlantiks in den Ruf, den Verzicht auf die unverzichtbaren nationalen Waffen für die ruinöse Krisenkonkurrenz zu besiegeln. Und in der für die gewöhnlichen Leute erst recht nichts anderes vorgesehen ist als maximale Dienstbereitschaft zu minimalen Kosten.
West- und ostatlantische Führer sind entschlossen, die Krisenkonkurrenz zum Nutzen der eigenen, also zum Schaden der anderen Nationen zu bestehen. Darum kommt es ihnen auf Durchsetzung gegen die anderen an, also auf die an nichts relativierte Souveränität ihrer Macht. Jede ökonomische Nutzen-Schaden-Rechnung überführen sie deshalb in die Gretchenfrage, wer sich von wem überhaupt Bedingungen gefallen lassen muss, wer wem generellen Respekt und Entgegenkommen – egal in welcher bestimmten Frage – abringen kann: Erkennt Europa endlich ohne Abstriche die Führungsmacht der USA an – fragen die Amerikaner. Erweisen die USA der EU endlich wirklichen Respekt auf Augenhöhe – fragen die Europäer. Ihre ökonomische Abhängigkeit voneinander bringt alle immer weniger auf berechnende Kooperation und immer mehr auf ein Kräftemessen gegeneinander, das sich pur um Über- oder Unterordnung dreht.
Ihre Völker ermuntern die Mächtigen nach Kräften dazu, ihnen die Daumen dafür zu drücken, dass sie sich in diesem Kampf durchsetzen – in einem Kampf, für den die Leute, so oder so, ausschließlich in der Rolle der möglichst billigen Manövriermasse verplant sind.
Der nationale Aufbruch der AfD
„Auch Deutschland hat jetzt eine Partei, die antritt, um Staat und Volk zu retten“, resümiert die neue Ausgabe der Politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt (3/16) in ihrer Analyse der Rechtspartei AfD. Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
„Den regierenden Parteien und der gesamten Presse gilt die AfD als irrationaler, unseriöser Verein von Wutbürgern. Man entlarvt sie als Ewiggestrige, die aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Man wirft ihnen vor, dass sie außer einem chaotischen Parteileben politisch nichts hinkriegen, lastet ihnen an, dass sie beim Einfangen von Wählerstimmen, die eigentlich den Etablierten gehören, viel zu erfolgreich sind und damit zum Risiko für die politische Stabilität der Republik werden. Diese ‚politische Auseinandersetzung‘ zielt darauf, die AfD aus der Elite auszuschließen, die für die Führung der Nation in Frage kommt. Spiegelbildlich dazu stellt sich die AfD gegen die gesamte politische Klasse als alternative Führung auf, die Deutschland braucht, weil die ‚Altparteien‘ nicht etwa diesen oder jenen Fehler machen, sondern insgesamt ein nationales Unglück sind…“ (Decker 2016b, 137). So beginnt die Programm-Analyse der Rechtspartei AfD in der neuen Ausgabe der Politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt (GS 3/16, auch online verfügbar, s.u.).
Die Analyse widmet sich detailliert, im Durchgang durch die einzelnen Programmpunkte, der Anklage, mit der die AfD lautstark antritt: Spätestens seit Merkels Flüchtlingspolitik vom Spätsommer 2015 sei die deutsche Regierung mehr oder minder systematisch damit befasst, Staatsgewalt und Volk zu ruinieren. Beim nationalen Aufbruch, den diese Partei „für Deutschland“ auf den Weg bringen will, hat man es mit einer Frontstellung gegen die „abgehobenen“ Berliner „Systemparteien“ zu tun. Die neue rechte Mannschaft (mit starker weiblicher Führung) stellt klar, dass es ihr nicht einfach um einen Austausch des Regierungspersonals geht, das – wie sonst üblich – eine zwischen den Konkurrenten um die Ämter unstrittige Staatsräson exekutiert; sie will vielmehr eine Neudefinition dessen, was die Nation ist und zu tun hat. Die GS-Analyse kritisiert das – anders als sonstige Diagnosen, die gleich von einem rechtspopulistischen oder -extremistischen Fremdkörper ausgehen – als eine national logische Folge der neuesten Krisenkonkurrenz, die der demokratisch verwaltete Kapitalismus betreibt. Dazu im Folgenden einige Hinweise.
Rettung von Staat und Volk
Decker und Co. gliedern ihren Text in zwei Hauptteile. Erstens geht es um die von rechts inkriminierte regierungsamtliche Linie, die die staatliche Handlungsfreiheit, von der das Volk leben soll, zerstöre. Im Einzelnen sind die Flüchtlingspolitik, der Euro, die Energiewende, die Bündnispolitik und das Militär – das AfD-Programm votiert für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht – Thema. Dabei wird vermerkt, dass die Partei jegliche Unzufriedenheit einlädt, sich als Beispiel dafür zitieren zu lassen, wie sehr die derzeitige Regierung vor ihren eigentlichen Amtspflichten versagt, ja regelrechten Verrat betreibt. So sammelt die AfD natürlich auch Beschwerden ein, die soziale Missstände betreffen. Das ist aber alles andere als ein Anschluss an den sozialen Protest oder gar eine Übernahme von Positionen, wie man sie aus dem linken Lager kennt. „Dass die allgemeine Ordnung nichts anderes als das flächendeckende und praktisch unanfechtbare Regiment des staatlichen Gewaltmonopols sein kann, dass es ein anderes Zusammenleben und Zusammenwirken gar nicht geben kann als ein umfassend erzwungenes“ (Decker 2016b, 138), ist für die AfD selbstverständlich. Deren Politiker „fordern diese Gewalt ein als den ersten Dienst, den die Regierung ihren Bürgern schuldet“ (ebd.).
Der Text weist nach, dass linke und andere Interpretationen, die im rechten Wutbürger einen Beschwerdeführer in Sachen soziale Lage der ‚Unterprivilegierten‘ sehen – „Der neue Rechtspopulismus ist vor allem eine Bewegung gegen die Zumutungen und Zwänge des Marktes“ (Dörre 2016, 12) –, einem Fehlurteil unterliegen. Die Beschwerden, die die rechte Opposition bündelt, richten sich darauf, dass der Staat gestärkt wird, damit er seines Amtes walten kann. „Angeklagt wird ein Defizit an Gewalt, damit eine Einbuße an deutschen Möglichkeiten, mithin ein Schaden für den Gemeinsinn und inneren Zusammenhalt der Deutschen.“ (Decker 2016b, 138) Die GS-Analyse zitiert dazu den AfD-Promi Björn Höcke: „Die Soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche Soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen.“ Und sie kommentiert: „Dass das deutsche Volk aus lauter gegensätzlichen Kollektiven wie ‚oben‘ und ‚unten‘ besteht, ist den Rechten natürlich klar, kann aber unter der Perspektive der Nation nicht zählen. Höcke erinnert nur an die ‚Soziale Frage‘ – die Kämpfe der Arbeiterklasse um die Anerkennung ihrer Überlebensnotwendigkeiten –, um der gegenwärtigen Republik zu sagen, wo heute die unbefriedigten Bedürfnisse der Volksmassen liegen: in der Beendigung der Verschwendung von ‚Volksvermögen‘ an Ausländer. Vermögenslose Volksgenossen hetzt Höcke gegen ihre Enteignung auf, die erst, aber genau dann eintreten soll, wenn Flüchtlinge Sozialhilfe beziehen. Und er verspricht ihnen das Lebensmittel, das ihnen als Volksgenossen zusteht: Mehr Gewalt, die Ausländer draußen hält.“ (Ebd., 138f)
Der zweite Teil befasst sich mit dem komplementären Vorwurf, die Merkel-Regierung zerstöre das deutsche Volk. Rechtes Sorgeobjekt ist nicht dessen soziale Situation, sondern die nationale Identität. Die AfD will einen Kulturkampf zu deren Erhaltung führen, indem sie gegen die von oben verordnete Toleranz gegenüber Fremden, gegen die Zerstörung der deutschen Leitkultur durch Multikulti, gegen die Aufweichung der Familie und deren Ersetzung durch ein Programm von Gender Mainstreaming, Diversity etc. antritt. Auch hier ist die Gewalt des Staates, die wieder souverän und ohne internationalistische oder sonstige Hemmungen eingesetzt werden soll, das A und O des rechten Programms. Bei der positiven Bestimmung der deutschen Leitkultur lässt zwar auch diese Partei eine gewisse Pluralität bzw. Beliebigkeit erkennen wie man sie aus den christdemokratischen und christlich-sozialen Debatten kennt, aber bei der Ausgrenzung der Undeutschen, die nicht hierher gehören, ist sie knallhart: Die fängt beim Islam, der laut Grundsatzprogramm „nicht zu Deutschland … gehört“, an und hört beim Burkaverbot noch lange nicht auf.
Auch hier resümiert die GS-Analyse als Kern des Programms die rechte Bezugnahme auf den starken, in seiner Handlungsfreiheit unbehinderten Staat: „Nationale Identität ist nicht nur ohne Ausgrenzung nicht zu haben, sie besteht überhaupt nur darin: Außer der Scheidung zwischen denen, die – letztlich aufgrund gesetzlicher Richtlinien – dazugehören, und den anderen, hat sie keinen Inhalt; einen Inhalt bekommt sie erst durch die Bebilderung der per staatliche Gewalt vollzogenen Absonderung; und praktisch durchgesetzt wird sie ohnehin mit nichts als Gewalt.“ (Ebd., 144) Die abschließenden Überlegungen des Textes zielen zunächst auf die doppeldeutige Rolle, die die AfD einnimmt und – da sie deren Erfolgsweg ausmacht – weiterhin einnehmen will, nämlich als „Sammlungsbewegung für aktionsbereite, enttäuschte Nationalisten“ und als „Wahlalternative für Bürger, die konservativer regiert werden wollen“ (ebd., 147), aufzutreten. In diesem Charakter einer Art „Volksbefreiungsbewegung“ (ebd.) unterscheidet sich die AfD von den anderen Parteien, von denen sie sich sonst – entgegen den öffentlichen Dementis – gar nicht groß unterscheidet.
Das macht die GS-Analyse auch in einem letzten Schritt deutlich. Sie verweist auf die Gemeinsamkeit, die eine solche Unzufriedenheit mit anderen nationalen Aufbruchsbewegungen hat – vom US-Präsidentschaftsbewerber Trump bis hin zu den erstarkten Rechtsparteien in Europa. Die bekennenden und unzufriedenen Nationalisten der AfD bewegen sich ja gerade nicht außerhalb der Welt der „Realpolitik“, wie deren amtierende Vertreter gerne behaupten. AfD-Politiker radikalisieren vielmehr „Zweifel, die auch regierende Demokraten an den internationalen Beziehungen und der Einbindung ihrer Staaten in internationale Institutionen derzeit hegen. In der EU und weltweit ringen die Regierungen im Rahmen dieser Beziehungen und Institutionen um Korrekturen. Ausgangspunkt der Unzufriedenheit aller Teile der politischen Klasse ist die nicht endende Wirtschaftskrise, in der die Staaten – in unterschiedlicher Weise und Heftigkeit und mit sehr verschiedenem Anspruchsniveau – an der Aufgabe scheitern, den nationalen Kapitalismus zu dem Wachstum zu bringen, das sie für ihr Land bzw. ihre darüber hinaus reichenden Ambitionen brauchen. Wenn im globalen Maßstab Wachstum ausbleibt, konkurrieren die Nationen nicht mehr um ihren Anteil am allgemein zunehmenden kapitalistischen Reichtum, sondern um die Abwehr von Rezession und Kapitalentwertung bei sich und ums Abwälzen der Krisenfolgen auf andere Länder.“ (Ebd., 148f)
Extremismus, Populismus…
Der GS-Beitrag betont gerade mit seinen Schlussüberlegungen noch einmal die Wucht, die in dem – nach der Berliner Wahl vom 18. September wieder bestätigten – Aufschwung der neuen Partei steckt. Der nationale Aufbruch, der damit in und für Deutschland zu verzeichnen ist, lässt sich nicht als vorübergehende Proteststimmung, die den Regierenden einen Denkzettel mit Blick auf mehr Bürgernähe und Volksfreundlichkeit übermitteln will, abtun. Das belegen auch die Reaktionen aus den etablierten Parteien, die sich zu dem Aufschwung in doppelter Weise stellen. Einerseits denken sie darüber nach, wie sie den Ausländerfeinden von AfD, PEGIDA etc. am besten das Wasser abgraben können (vgl. Decker 2016a), was darauf hinausläuft, sich so zu präsentieren, dass enttäuschte Nationalisten sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen und in SPD, CDU oder CSU (wieder) ihre Heimat finden. Andererseits wird der „Kampf gegen rechts“ verstärkt und die Ausgrenzung der Rechtspartei aus dem wählbaren, politikfähigen Spektrum betrieben.
Seit bald 70 Jahren demokratischer Politik kennt die Bundesrepublik die Notwendigkeit, einen solchen Kampf zu führen und den „Anfängen zu wehren“, also dem Wiedererstarken eines politischen Programms, das sich am NS-Rechtsvorgänger orientiert, entgegenzutreten. Staatsschutz, politische Öffentlichkeit, Bildungsarbeit, Wissenschaft sind an dieser Front unermüdlich tätig, und auch die Zivilgesellschaft lässt sich nicht lumpen. Mit dem mittlerweile zu verzeichnenden Aussterben der „unverbesserlichen“ Alt-Nazis ist die faschistische Gefahr in Deutschland aber keineswegs ausgestorben. Die Gründung (neo-)faschistischer Parteien und Kameradschaften, das Entstehen von faschistischen Skinhead-Bewegungen, organisierter oder individuell betriebener Rechtsterrorismus, Hasspropaganda in den „sozialen Medien“ – all das ist weiterhin an der Tagesordnung. Und die relative Erfolglosigkeit der stramm rechtsradikalen Parteien im Kampf um Sitz und Stimme in Parlamenten verdankt sich, wie die neuere Sozialforschung bekräftigt (vgl. „Nationalismus ‚im Aufwind‘“, IVA-Blog, 31.7.2016), gar nicht einer Ablehnung ihrer Parolen. Diese sind vielmehr „in der Mitte der Gesellschaft“ angekommen und werden jetzt von einer neuen, „rechtspopulistischen“ Partei benützt.
Das Ganze müsste eigentlich zu einem Schluss führen: „Die demokratische Form der Verwaltung einer kapitalistisch verfassten und weltweit erfolgreichen Ökonomie bringt regelmäßig (neue) Faschismen hervor.“ (Huisken 2012, 10) Das sieht die offizielle Politik aber ganz anders. Der „Extremismus“ von rechts, der nur die Variante einer Grundhaltung sein soll, die sich ebenso in linker oder islamistischer Form äußert, ist für sie eine Bedrohung, die der freiheitlichen Ordnung und offenen Gesellschaft als pure Gegenbewegung entgegentritt. Dabei konstatiert jetzt auch die Bundesregierung in ihrer neuen Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung, die am 13. Juli 2016 vom Bundeskabinett beschlossen wurde (vgl. Die Bundesregierung 2016), den Extremismus als Phänomen der Mitte: „Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen und Institutionen bis hin zu offener Feindseligkeit und Ablehnung einer freiheitlichen, friedlichen Gesellschaftsordnung sind keine bloßen Randerscheinungen. Radikalisierungstendenzen sind bis in die Mitte der Gesellschaft sichtbar und fordern alle gesellschaftlichen und politischen Akteure heraus.“ (Ebd., 7) Extremismus resultiere dabei nicht allein aus aktuellen politischen Entscheidungen, etwa im Rahmen der deutschen Flüchtlingspolitik, hier lägen vielmehr „langfristig wirkende Einstellungsmuster“ (ebd.) vor. Worin sie bestehen, macht die regierungsoffizielle Definition von Extremismusprävention deutlich. Diese „umfasst Maßnahmen, die der Ablehnung der Werteordnung des Grundgesetzes und des demokratischen Verfassungsstaates vorbeugen und entgegenwirken und in diesem Kontext auch der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dienen“ (ebd., 11).
Mit der jetzt verabschiedeten Strategie hat sich die Regierung auch die Ergebnisse der neueren Sozialforschung à la Heitmeyer zu eigen gemacht: „Die Bundesregierung verurteilt jegliche menschenfeindlichen Handlungen und Ideologien. Sie tritt dabei unterschiedlichen Formen von Extremismus sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entschieden entgegen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Hervorh. i. O.) oder Ideologien der Ungleichheit meinen dabei feindselige Einstellungen und die damit verbundene Abwertung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen aufgrund einer ungleichwertigen Betrachtung von Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser, ethnischer Herkunft, sexueller oder geschlechtlicher Identität oder anderer Merkmale.“ (Ebd.) Dabei besteht die Regierungsstrategie – die übrigens die AfD nicht in ihre Übersicht aufgenommen hat – ausdrücklich darauf, dass sie den Extremismus allgemein als Problem identifizieren will und dass die Absehung vom konkreten Inhalt der jeweiligen politischen Strömung die einzig korrekte Herangehensweise sei: „Eine phänomenübergreifende (Hervorh. i. O.) Betrachtung von Formen des Extremismus ermöglicht sowohl die Identifikation von Gemeinsamkeiten als auch von Unterschieden pädagogischer Präventionsansätze und somit eine wirksamere Umsetzung zielgruppenspezifischer Maßnahmen“ (ebd.).
Die Sozialforschung wendet sich teilweise gegen einen solchen Extremismusbegriff, bestätigt ihn aber auch immer wieder – direkt oder indirekt –, so etwa, wenn sie die neue Rechte als fehlgeleiteten sozialen Protest interpretiert (vgl. Dörre 2016, für die französische Entwicklung: Eribon 2016). Oder sie übernimmt die offizielle Ansage, dass es sich beim rechten Aufschwung um eine Ablehnung oder ein Missverständnis der parlamentarischen Demokratie handelt. Alexander Häusler und Fabian Virchow schreiben in dem Sammelband „Neue soziale Bewegung von rechts?“, im Aufstieg von PEGIDA und AfD verschaffe sich „ein tiefes Misstrauen gegenüber den Bundestagsparteien im Besonderen oder [gegen] das demokratische System im Allgemeinen“ (2016, 7) neue Ausdrucksformen. Der „rassistische Vormarsch“ sei allerdings nicht ganz von der offiziellen Politik abgekoppelt, denn politisch werde „diese Entwicklung indirekt legitimiert durch die CSU“ (ebd., 8), die in Abgrenzung zur Linie Merkels von einer „Herrschaft des Unrechts“ (Seehofer) spreche. Wenn die Sozialforschung tiefer bohrt, kommt sie aber immer wieder auf den sozialen Protest zu sprechen. So hat laut Häusler/Virchow das „neoliberale“ Krisenmanagement der Großen Koalition „Ängste vor der unkontrollierbaren Entwicklung eines ungezügelten Profitstrebens und zugleich einer abstrakten Regulierung globaler Herrschaftsverhältnisse hervorgerufen, die nun von reaktionären politischen Kräften zur Re-Nationalisierung des Politischen genutzt werden.“ (Ebd., 125)
Auch wird darüber diskutiert, ob sich der Populismusbegriff zur Erfassung des neuen nationalen Aufbruchs eignet oder ob er nicht „den analytischen Zugang mehr behindert, als dass er zur Aufklärung beiträgt“, wie Alexandra Kurth und Samuel Salzborn (2016, 50) im Hinblick auf die Bildungsarbeit schreiben. Mit der allgemeinen Charakterisierung als populistisch werde das Spezifische dieser Bewegung verfehlt, denn Populismus sei ein Kennzeichen aller Parteien in der „Mediendemokratie“. Für den Erfolg der AfD sei aber ausschlaggebend, dass sich „Führung wie Basis … als zu kurz gekommen begreifen. Die AfD ist, vereinfacht gesprochen, eine Partei der Durchschnittlichen und Mittelmäßigen, die sich als deklassiert empfinden, weil sie sich selbst für überdurchschnittlich halten“ (ebd., 51). In ähnlicher Weise argumentieren Joachim Bischoff und Bernhard Müller, obwohl sie im Unterschied zu den beiden zitierten Autoren aus der politischen Bildung gerade am (Rechts-)Populismusbegriff festhalten wollen. „Grundlage der politischen Mobilisierung sind Anti-System-/Anti-Establishment-Affekte“, führen sie als dessen erste und prinzipielle Bestimmung auf (Bischoff/Müller 2016). Dafür zitieren sie als Gewährsmann den Politikwissenschaftler Frank Decker: „Populistische Parteien sind Anti-Establishment-Parteien und geben gleichzeitig vor, für das sogenannte einfache Volk zu stehen im Unterschied – so lautet zumindest der Vorwurf – zu den anderen Parteien, die das nicht mehr tun. Das ist der Kern des Populismus.“ (Ebd.)
Wenn man schon bei Ressentiments und Affekten als den entscheidenden Bestimmungsgrößen ist, kann man das auch ins (Sozial- bzw. Tiefen-)Psychologische verlängern. Götz Eisenberg sieht hier den autoritären Charakter der Ewig-Gestrigen am Werk. „Die bittere Wahrheit, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, lautet: Unter einem dünnen Firnis angepassten Verhaltens existiert ein bedrohliches, faschistoides, antidemokratisches Potenzial, das den Wandel der politischen Systeme überdauert hat. Das ist der eigenartige Doppelsinn des viel zitierten Stalin-Satzes: ‚Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt bestehen.‘ Das Nazi-Regime ging unter, aber das deutsche Volk und seine Mentalität blieben. Hinter einem demokratischen Paravent haben sich ältere Reaktionsmuster durchgehalten…“ (Eisenberg 2016, 25) Also auch hier kommt der Rechtstrend von außen, eben ganz klassisch aus den Relikten einer unbewältigten Vergangenheit. Jetzt soll dieser Untergrund angesichts der „Flüchtlingskrise“ wieder auftauchen und in PEGIDA oder AfD politische Gestalt annehmen.
Man kann aber auch vor einem Missbrauch oder einem Missverständnis der Demokratie warnen, die von den Bürgern gewissermaßen zu ernst genommen werde. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, teilt in einem Interview (General-Anzeiger, 15.9.2016) seinen Eindruck mit, dass dem neuen rechten Aufbruch „ein vulgäres Verständnis von direkter Demokratie“ zu Grunde liege, „nach dem Motto: Ich bestelle mir eine bestimmte Politik, und wer die nicht liefert, ist nicht akzeptabel“. Allem Anschein nach wird also Demokratie von den Wutbürgern zu extensiv gehandhabt. „Die AfD spricht offenbar Themen an, die bei vielen Leuten in Form von Ängsten und Unsicherheiten vorkommen. Allerdings mit Antworten, die höchst problematisch sind.“ (Krüger) Als Chef der Zentrale, die für die pädagogische Abteilung bei der Extremismusprävention zuständig ist, will Krüger natürlich weiterhin zu Bürgerbeteiligung ermuntern, aber im richtig verstandenen Sinne, als Ergänzung der klassischen Verfahren der repräsentativen Demokratie und ihrer Aushandlungsprozesse sowie als das ehrenamtliche Engagement, von dem die Republik nicht genug kriegen kann.
Die Abwehr der rechten Gefahr soll also – den verbindlichen Ansagen, aber auch linken Einlassungen zufolge – auf die Wiederherstellung eines klaren Bekenntnisses zum eingerichteten System der repräsentativen Demokratie zielen. Dass sich der Aufstieg der AfD auf der Grundlage eines internationalen Konkurrenzkampfes vollzieht, den sich Standortnationalisten mit ihren demokratisch-parlamentarisch verfassten Gemeinwesen liefern, und von daher seine Wucht erhält, kommt bei solchen Anforderungen nicht in den Blick. Dabei zeigen gerade die Programmpunkte der AfD – wenn man sie unvoreingenommen nimmt und nicht als maskiertes faschistisches Programm –, dass es sich um lauter Sorgethemen handelt, die die anderen Parteien ebenso auf der Agenda haben. Vom Euro über die Wehrpflicht bis zur Anerkennung der Homo-Ehe kennen die etablierten Parteien (und nicht nur die CSU), auch wenn sie sich für einen modernen, weltoffenen, in globaler Verantwortung betriebenen, sprich: imperialistischen Kurs entschieden haben, die einschlägigen Kontroversen und Bedenken. Auch in ihren Reihen gibt es die abweichenden Positionen, die sich die Frage stellen, ob der eingeschlagene Weg den nationalen Erfolg befördert. Es gibt sogar Fälle, wo die AfD Anschluss an andere Bewegungen sucht und erst von der Teilnahme regelrecht ausgeschlossen werden muss. So hat sie sich seit den großen Anti-TTIP-Demonstrationen des letzten Jahres darum bemüht, dort mitzumarschieren. Sie wurde daraufhin – wie jetzt auch wieder bei den Demos vom 17. September 2016 – ausdrücklich des Platzes verwiesen. Anschlussfähigkeit, wenn sie sie für ihre Zwecke nutzen will, wird ihr nicht gewährt. Und dass der nationale Aufbruch der AfD kein Fremdkörper, kein Anachronismus oder nostalgischer Rückschritt im modernen Verfassungsstaat ist, sondern Geist vom Geist des nationalstaatlich betriebenen Daseinskampfes im Globalisierungszeitalter – davon wollen die offiziellen Kampfansagen gegen Extremismus und Populismus nichts wissen.
Literatur
- Joachim Bischoff/Bernhard Müller, Gründe und Hintergründe des AfD-Vormarschs. In: Sozialismus aktuell, http://www.sozialismus.de, 5.9.2016.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Öffentlicher Streit der Regierungsparteien über den Aufstieg der AfD: Wie wir den Ausländerfeinden am besten das Wasser abgraben. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2016a, S. 123-125. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2016/2/gs2016212….
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Die AfD – Auch Deutschland hat jetzt eine Partei, die antritt, um Staat und Volk zu retten. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2016b, S. 137-150. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2016/3/gs2016313….
- Die Bundesregierung, Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung. Hg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de) und vom Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de), Berlin 2016.
- Klaus Dörre, Fremde – Feinde. Der neue Rechtspopulismus deutet die soziale Frage in einen Verteilungskampf um. Thesen über Pegida, AfD und darüber, wie der wachsende Zuspruch für sie zustande kommt. In: Junge Welt, 27.6.2016, S. 12-13.
- Götz Eisenberg, Zum Verhältnis von Angst und Demokratie – Über Rechtsextremismus, Amok und Terrorismus. In: G.E., Zwischen Arbeitswut und Überfremdungsangst – Zur Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus, Band 2. Gießen 2016, S. 23-32.
- Didier Eribon, Wie aus Linken Rechte werden – Der vermeidbare Aufstieg des Front National. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 8, 2016, S. 55-63.
- Alexander Häusler/Fabian Virchow (Hrsg.), Neue soziale Bewegung von rechts? Zukunftsängste – Abstieg der Mitte – Ressentiments. Eine Flugschrift. Hamburg 2016.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012.
- Alexandra Kurth/Samuel Salzborn, Die AfD als Herausforderung für die politische Bildung. In: Journal für politische Bildung, Nr. 3, 2016, S. 50-55.
Zur Kritik der Inklusion
Behinderung im Kapitalismus und das Leitbild der Inklusion war das Thema einer IVA-Veranstaltung in Köln. Im Folgenden ein Kurzbericht der IVA-Redaktion.
Die IVA-Initiative führte Anfang September 2016 in Köln im Bürgerzentrum Alte Feuerwache eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Behinderung im Kapitalismus und das Leitbild der Inklusion“ durch. Referent war Prof. Matthias Schnath (Bochum), von dem früher ein Fachbeitrag auf dem IVA-Blog erschienen war. Im Folgenden gibt die IVA-Redaktion einen Überblick über die Thesen des Referenten und die einschlägigen Diskussions- bzw. Streitpunkte.
Behinderung im Kapitalismus und das Leitbild der Inklusion
Für die moderne Wissenschaft ist Inklusion – anders als für Menschen mit Behinderung, für Lehrer und Eltern, die sich hauptseitig mit den Zumutungen der Durch- und Umsetzung des neuen Ideals herumquälen – eine ‚spannende‘, eine ‚fruchtbare‘ Sache. Eine exemplarische Stimme: „Die immer wieder auszutarierende (sozialpolitische) Frage, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen, soll beleuchtet werden: Teilhaben und Teil sein – ein diskussionswürdiges Spannungsfeld. Aus sozialrechtlicher Sicht ist Teilhabe durch Ansprüche und Leistungen geprägt. ‚Teil sein‘ – also die Zugehörigkeit zur Gesellschaft – verlangt nach Anerkennung von Vielfalt und Verschiedenheit sowie die Möglichkeit von Beteiligung. Diese beiden Aspekte stehen nicht nebeneinander, vielmehr bestehen zwischen ihnen Beziehungen und Wechselwirkungen. Dahinter stehen Fragen, wie angesichts des demografischen Wandels und knapper werdender Ressourcen die Verantwortung von Staat, Gesellschaft und des Einzelnen auszutarieren ist, um den – zu Recht – steigenden Anspruch auf Teilhabe sicherstellen zu können.“ (Hagen 2015, 145)
Wenn man die demokratisch geregelte kapitalistische Konkurrenz als einen Ort des Zusammenlebens betrachtet, der immer wieder die – offene – Frage aufwirft, wie er gestaltet werden soll, dann kann man natürlich munter Modelle der Integration, der Kohäsion, der Inklusion, des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder der kulturellen Diversität ausspinnen. Man muss dann nur vergessen, dass man sich in einer Parallelwelt befindet, die neben die privateigentümliche Festlegung und sozialstaatliche Einordnung der Gesellschaftsmitglieder tritt. Für den Wissenschaftsbetrieb ist das anscheinend eine einfache Übung. So kam auch bei der Kölner Veranstaltung prompt der Einwand, der Referent habe selber kein eigenes Konzept der Inklusion – das sich einen originellen Zugang wählt oder ans breite Spektrum vorhandener Ansätze (vgl. z.B. Möller 2012) anschließt – an den Anfang seiner Ausführungen gestellt und so den wissenschaftlichen Standard unterschritten. Dagegen hier in Thesenform die Position des Referenten.
Vier Thesen
Seit der UN-Behindertenrechtskonvention ist es in der Bundesrepublik üblich, den sozialpolitischen Idealen Selbstbestimmung und Teilhabe in der Behindertenpolitik das der Inklusion zur Seite zu stellen; praktisch wahr geworden ist es in der Öffnung der Regelschulen für Schüler mit Behinderungen, und auch die Bundesregierung beruft sich auf Inklusion in der Begründung ihres jüngst vorgelegten Entwurfs eines Bundesteilhabegesetzes.
1. Dabei ist fraglos bejaht, dass „die Gesellschaft“, an der Teilhabe ermöglicht und in die inkludiert werden soll, diejenige ist, in der alle sich um ihrer individuellen Lebensinteressen willen zunächst einmal der Konkurrenz am Arbeitsmarkt zu stellen haben: Ein Lebensstandard will verdient sein – und daran scheitern Menschen mit Behinderungen, weil ihre verminderte Leistungsfähigkeit mit erhöhtem Bedarf zusammen trifft. Diese Logik trifft aber nicht nur sie: Die Lebenslage Familie unterliegt demselben Dilemma.
2. Genauso ist deswegen fraglos klar, dass Menschen mit Behinderungen – ebenso wie Familien – ohne sozialstaatliche Hilfen nicht über die Runden kommen. Die bisherige Behindertenpolitik hat sich dem im Wesentlichen „fürsorglich“ gewidmet – also herablassend; die Betroffenen und ihre Verbände haben dagegen nach Kräften Selbstbestimmung und Gleichberechtigung gefordert. Dem kommt die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf auf ihre Weise nach – sortiert nämlich die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen neu nach dem Kriterium ihres Bezugs zum Arbeitsmarkt.
3. Damit ist klar gestellt, wie Inklusion in der sozialstaatlich betreuten Konkurrenzgesellschaft zu verstehen ist: Teilhabe ist Pflicht zur selbstbestimmt-individuellen Bewährung an deren Anforderungen – und dabei und darin haben alle Anspruch auf Anerkennung. Die Schulpolitik erhebt das zum allgemeinen Leitbild, wenn sie in das selektive, fundamental leistungsorientierte Ausbildungswesen den Gesichtspunkt von Diversity einführt: Der Zwang zur Konkurrenz wird ergänzt um das verlogene Ideal der respektvollen Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Individuen.
4. Inklusion ist also eine Modernisierung des staatsbürgerlichen Bekenntnis zum Kapitalismus, das sich dadurch auszeichnet, dass es von dessen sozialen Gegensätzen endgültig nichts mehr wissen will.
Ein Diskussionsüberblick
A. Einleitung
Betroffenheit gibt es bei dem Thema in vielerlei Hinsicht – von der Debatte um das Bundesteilhabegesetz bis zu den Varianten der schulpolitischen Inklusion, die sich auf Länderebene finden. Gerade in Nordrhein-Westfalen wurden zu Beginn des neuen Schuljahrs im September 2016 vielfach Klagen und Beschwerden laut, die Praxis der Inklusion sei ein hartes Brot, die Implementierung des Programms katastrophal und es bestünde die Gefahr, dass das ganze Vorhaben „gegen die Wand fahre“ (VBE, GEW etc.). Bei der Debatte im Schulausschuss des NRW-Landtags am 7. September 2016 äußerten Bildungsgewerkschaften und Fachverbände weit gehend übereinstimmend eine solche Kritik („Bei der Umsetzung in Stich gelassen“, General-Anzeiger, 8.9.2016). Daher Gesamtnote: mangelhaft! In der Diskussion der IVA-Veranstaltung ging es darum, als Erstes zu solchen Betroffenheiten Distanz einzunehmen, also nicht die eigenen Erwartungen (auf angemessene, wahre, gerechte… Hilfe) oder moralischen Enttäuschungen (etwa über den Kapitalismus, der sowieso nichts Gutes für die Menschen bereithält) zur Leitschnur der Beurteilung zu machen. Vielmehr zielte die Veranstaltung auf die Frage, wie von dem Leitbild und seinen Verheißungen in der aktuellen Politik, vornehmlich in der Reform des Teilhaberechts und der Durchsetzung der inklusiven Beschulung, Gebrauch gemacht wird.
B. Der Ausgangspunkt
Die ökonomische Logik der Lebenslage Behinderung ist – analog zur Situation der Familie – durch die Notwendigkeit bestimmt, dass der Einzelne sich seinen Lebensunterhalt verdienen muss, auch wenn er auf Grund seiner speziellen Beeinträchtigungen und Belastungen, seiner verminderten Leistungsfähigkeit, die mit erhöhtem persönlichem/familiärem Bedarf zusammen trifft, nicht in der Lage ist, im Kampf um Zugangsvoraussetzungen und Erwerbsmöglichkeiten mitzuhalten: Ein aufgrund von Behinderung – oder Kindern – erhöhter Bedarf tritt damit und deswegen auf verminderte „Leistungsfähigkeit“. Damit ist klar, dass die Bewältigung dieser Lebenslage ohne sozialstaatliche Hilfen unmöglich ist. Die bundesdeutsche Sozialpolitik zeichnet sich dadurch aus, die Hilfen so auszugestalten, dass sie die Betroffenen stets auf die Ursache ihrer Lage, die Logik des kapitalistischen Arbeitsmarktes, zurück verweist:
C. Die Rechtslogik der sozialstaatlichen Betreuung der Lebenslage Behinderung
1. Die Gerechtigkeit der Freiheit = Eigenverantwortung in Erwerbsarbeit und Familie. 2. Die Ermöglichung solcher Gerechtigkeit: Sozialversicherung mit Lohnersatzleistungen und grundgesicherte Armut. 3. Insbesondere Bundesteilhabegesetz. Auflösung: ambulant – stationär, Verbesserung: Einkommens- und Vermögensanrechnung – strikte Trennung Lebensunterhalt und „Fachleistung“ = Differenzierung der behinderten Lebenslagen als „Anreiz“ zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
D. Behinderung im öffentlichen Raum - insbesondere Inklusive Schule
„Hilfen“ nach Maßgabe von „Leitbildern“: Diversity im selektiven Klassenverband. Politisch betreuter Sittenwandel: vom „Rheinischen Kapitalismus“ zur „Grünen Republik“. Überhöhung der Eigenverantwortung zur Selbstverwirklichung, Kulturalisierung, Leistung der „neuen sozialen Bewegungen“. Achtung: Inklusion! Gemeinschaft statt Gemeinsamkeit – Macht und Ohnmacht eines Ideals.
Ursprünglich hatte IVA im Herbst 2016 einen Fachbeitrag von Matthias Schnath zu „Behinderung im Kapitalismus und das Leitbild der Inklusion“ veröffentlicht, Interessenten können ihn bei der IVA-Redakltion anfordern. Eine erste Version des Textes war in standpunkt : sozial, Nr. 1/2015, erschienen.
Literatur
- Becker, Uwe: Die Inklusionslüge – Behinderung im flexiblen Kapitalismus. 2015.
- Cechura, Suitbert: Inklusion – die Gleichbehandlung Ungleicher. 2015.
- Hagen, Beate: Ankündigung zum 80. Deutschen Fürsorgetag, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, 2015.
- Marx, Karl: Zur Judenfrage, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, 1974, S. 347ff, insbesondere 363-370 (zur Kritik der Menschenrechte und des Humanismus’ der bürgerlichen Gesellschaft).
- Möller, Kurt: Gesellschaftliche Kohäsion als Herausforderung für die politische Bildung, in: Journal für politische Bildung, Nr. 4, 2012, S. 8-17.
- Schnath, Matthias: Menschen mit Behinderungen: Die Spiegel der Normalität, in: Behindertenpädagogik 2006, S. 11-35.
- Wohlfahrt, Norbert: Vom „Klassenkompromiss“ zur widerspruchslosen Staatsbürgergesellschaft? Zu einigen Widersprüchen einer inklusiven Sozialpolitik, in: Widersprüche, Nr. 133, September 2014, S. 11-24.
Kontakt zum Autor E-Mail: schnath@efh-bochum.de
August 2016
Amok, Antiterrorpaket und Ursachenforschung
Nach den blutigen Anschlägen in Frankreich und Deutschland vom Sommer dieses Jahres beschäftigte sich der IVA-Blog am 25. Juli mit dem Thema Amoklauf. Dazu ein Nachtrag von Johannes Schillo.
Nach dem Münchner Amoklauf vom Juli 2016 gab es kritische Pressestimmen, die vor einer Neuauflage der früheren Debatten über Computerspiele und Gewaltvideos warnten (vgl. den IVA-Blog-Eintrag „Betrifft: Amoklauf“ vom 25.7.2016). „De Maizière reanimiert Killerspiel-Debatte“, kommentierte z.B. die SZ (23.7.2016). Doch diese Reanimation hat nicht stattgefunden, das Amok-Problem geriet nicht groß ins Visier. Was der Bundesinnenminister am 11. August als neues „Sicherheitspaket“ der Großen Koalition präsentierte – dabei auch weiter reichende Vorschläge aus den Reihen seiner eigenen Partei übergehend (Burkaverbot, Abschaffung des Doppelpasses…) –, konzentrierte sich auf die Terrorgefahr. In der Hauptsache geht es um „mehr Personal und Technik bei den Sicherheitsbehörden, genauere Beobachtungen von Radikalisierungstendenzen bei Flüchtlingen und Gesetzesverschärfungen im Ausländerrecht“ (FAZ, 12.8.2016). Eine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Innern ist demnach nicht vorgesehen. Wozu auch? „Bundeswehr operiert längst im Inland“, meldet z.B. die Junge Welt (JW, 12.8.2016) über die Pläne der Verteidigungsministerin, die Zusammenarbeit von Polizei, Bundeswehr und anderen Behörden fortzusetzen. Noch in diesem Jahr soll eine erste gemeinsame Übung von Bundeswehr und Polizei „für den Terrorfall“ folgen.
Im Blick auf mögliche Amok-Taten gab es lediglich einen Vorschlag de Maizières, nämlich die „Idee, die Schweigepflicht von Ärzten künftig so zu interpretieren, dass die Weitergabe von Informationen über traumatisierte Flüchtlinge möglich wird, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen könnten“ (FAZ, 12.8.2016). Entschieden ist das noch nicht, der Innenminister will dazu einen „Dialog“ mit den Repräsentanten der Ärzteschaft in Gang setzen. Dagegen gab es Einspruch, so vom Präsidenten der Ärztekammer Ulrich Montgomery – „Die angespannte Sicherheitslage darf nicht zu vorschnellen politischen und rechtlichen Maßnahmen verleiten“ –, wobei der Verbandsvertreter aber gleichzeitig darauf hinwies, „dass Ärzte bereits nach geltendem Recht in Einzelfällen von der Schweigepflicht abweichen dürfen“ (JW, 11.8.2016). Der Dialog dürfte also keine großen Überraschungen bringen. Dass die Ärzteschaft zum Ansprechpartner wird, passt natürlich zur offiziellen Maßgabe, in den entsprechenden Taten das Werk „kranker Hirne“ zu sehen und sie als „unfassbare“ Entgleisungen von „Einzeltätern“ in die Zuständigkeit von Psychiatrie und Psychopathologie zu verweisen.
Zu dieser Art und Weise, Katastrophenfälle zu verrätseln und aus dem Normalbetrieb der marktwirtschaftlichen Konkurrenzordnung auszugrenzen, hat schon der letzte Blog-Eintrag vom Juli Hinweise gegeben. Im Folgenden dazu einige Ergänzungen.
Vom freien Tod
| „Stirb zur rechten Zeit: also lehrt es Zarathustra… Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird. Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden und Gelobenden… Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will.“ Friedrich Nietzsche (1960, 333) |
„Gestörte Einzeltäter“ hat der Psychologe Götz Eisenberg einen aktuellen Essay in der Jungen Welt überschrieben – und dem freilich ein Fragezeichen hinzugefügt, denn der Text wendet sich entschieden gegen die vorherrschende Individualisierungsthese, stellt vielmehr eine radikale Gegenthese auf: „Amok und Terror könnten zur Signatur des neoliberalen Zeitalters werden“ (Eisenberg 2016). Eisenberg, der bereits eine Reihe von Publikationen zu dem Thema veröffentlicht hat (siehe das Literaturverzeichnis), beginnt seine Ausführungen – ähnlich wie Freerk Huisken in seinem Vortrag über „School Shooting“ (2009) – mit der Feststellung, dass die allgemeine Erschütterung über die unfassbare Tat unredlich sei. Sie bedeute nichts anderes, als sich dumm zu stellen. Im Brustton der Überzeugung werde geäußert: „Das könnte ich nicht! Der Täter muss ein Wahnsinniger sein!“ „In Gedanken aber“, fährt Eisenberg fort (2016, 12), „sind wir alle schon einmal Amok gelaufen.“ Der Autor führt als Belege u.a. literarische und filmische Zeugnisse an, die entsprechende Taten – erfundene wie authentische – dem Publikum als Kunstgenuss aufbereiten, somit ein Verständnis der Tat unterstellen. Dabei fehlt übrigens ein einschlägiger Klassiker, der preisgekrönte deutsche Film „Warum läuft Herr R. Amok?“ (1970) von Michael Fengler und Rainer Werner Fassbinder, ein quälend-monotones Opus, das das gewalttätige Ausrasten eines kleinen Angestellten nach einer Kette privater und beruflicher Demütigungen zum nachvollziehbar logischen und in gewisser Weise auch befreienden Schlusspunkt macht.
Eisenberg liefert zudem viele Beispiele aus den USA und aus Deutschland, die die Normalität dieses anormalen Verhaltens deutlich machen. Er beginnt mit den Firmen-Amokläufen in den 1980er Jahren, als die US-Post privatisiert wurde und ehemalige Angestellte an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten, um dort um sich zu schießen. Daraus „entstand die Bezeichnung Going postal für irrationale und oft gewalttätige Handlungen, die durch Stress bei der Arbeit ausgelöst werden. Obwohl der Ausdruck auch ganz allgemein mit ‚ausrasten‘ oder ‚durchdrehen‘ übersetzt werden kann“, sei die Redewendung „vor allem in den Vereinigten Staaten ein Synonym für Amokläufe am Arbeitsplatz“ geworden (Wikipedia, 12.8.2016). Eisenberg berichtet ferner vom Schulmassaker in der Columbine Highschool in Littelton (1999), das zum Startschuss für das neuere „School Shooting“ wurde. In Deutschland folgte Robert S. mit seiner Tat in Erfurt (siehe Huisken 2002). Eisenberg erinnert in dem Zusammenhang auch an den 16jährigen Lehrling, der 1999 in Bad Reichenhall „mit väterlichen Waffen aus dem Fenster der elterlichen Wohnung auf Passanten feuerte und vier Menschen und sich selbst tötete. Seither reißt die Kette jugendlicher Amokläufe und Schulschießereien in Nordamerika und Mittel- und Nordeuropa nicht ab.“ (Eisenberg 2016, 13) Die Schlussfolgerung, dass sich der aus dem südostasiatische Raum kommende „Amok“ längst „mit entsprechenden kulturspezifischen Modifikationen“ in den kapitalistischen Metropolen als „Modell des Fehlverhaltens“, als „Ventilsitte“, etabliert habe (ebd.), mag da nahe liegen. Doch man sollte der Herkunft und Adaption des exotischen Wortes nicht zu viel Wert beimessen; man kann die Sache genauso gut als gediegenes europäisches Kulturgut betrachten. Der antike griechische Dichter Sophokles hat 450 Jahre v.u.Z. die Tragödie „Aias“ verfasst. Der viel gerühmte Kriegsheld Aias rastet aus, nachdem Achilles im Trojanischen Krieg gefallen ist und die Heerführer nicht ihm, Aias, der ein vertrauter Kampfgefährte des Gefallenen war, dessen Waffen zusprechen, sondern dem bekannt „listenreichen“ Odysseus. Aias will sich für diese Schmach rächen und die eigenen Heerführer töten. In seiner Raserei wird er jedoch von der Göttin Athene mit Wahnsinn geschlagen und schlachtet daraufhin Herdentiere samt Hirten ab, die er für die Truppen der Atriden hält. Aus dem Wahnsinn erwacht, stürzt er sich in sein Schwert. Wenn man dazu aufgelegt ist, kann man also „suizidoagonale Handlungsmuster“ (Takeda 2010, 114) auch in der abendländischen Kulturgeschichte als geschätzte Traditionsbestandteile finden (der Germanist Arata Takeda jedenfalls wird hier, im Alten Testament oder im deutschen Sturm und Drang, vielfach fündig).
Eisenberg will mit seinem Essay darauf hinaus, dass heute, in der entfesselten neoliberalen Konkurrenz solche Handlungsmuster als Modell denen zur Verfügung stehen, die wie der alte Haudegen Aias, aber natürlich auf Grund ganz anderer Motiv- und Zwangslagen einen Rachefeldzug planen. In Richtung kultureller Muster Nachforschungen anzustellen, würde allerdings in die Irre führen. Gewaltbereite Jugendliche beziehen sich nicht auf kulturgeschichtliche Überlieferungen, ihnen steht ganz praktisch ein anderes Modell zur Verfügung, nämlich der Rechtsstaat mit seiner Strafjustiz, als dessen gelehrige Schüler sie sich erweisen. Die strafende Justiz verfährt nach dem Muster, dass der ersten Schädigung, die dem Opfer durch den Täter widerfuhr, eine zweite durch die Justiz, die dies am Täter vollstreckt, hinzugefügt wird. Die absurde Logik der Vergeltung, die den Schaden verdoppelt statt ihn zu beheben, findet auch im demokratischen Rechtsstaat höchste Anerkennung. Dabei dient sie natürlich nicht der Befriedigung eines persönlichen Rachebedürfnisses, sondern der Wiederherstellung des Rechts. Huisken hat in dem genannten Vortrag (2009) die verrückte, aber gängige Logik dieser Adaption erläutert, und in der Analyse zum Erfurter „School Shooting“ schreibt er resümierend: „Wo mit den Anerkennungsfragen die Ehre verknüpft wird, da wird … auch der Wunsch nach Achtung gleich als Rechtsanspruch auf sie formuliert.“ (Huisken 2002, 63) Die angemaßte Rolle des Richters hat natürlich etwas Imaginäres, weshalb die eingesetzte Gewalt konsequenter Weise auf den eigenen Selbstmord hinausläuft. Andernfalls würde die wirklich geltende Gewalt, nämlich die des Staates, den Täter wieder zu dem Loser degradieren, als der er sich empfindet.
Eisenberg formuliert das „Modell Amok“, das der jugendliche Gewalttäter beherzigt, folgendermaßen: „Wenn du dich ausgegrenzt und nicht wahrgenommen fühlst, wenn sich in deinem Leben Kränkung an Kränkung reiht und du deswegen einen wachsenden Hass verspürst, dann kannst du einen Amoklauf in Erwägung ziehen. Zu dessen Vorbereitung empfiehlt es sich, am Computer das Schießen und die Choreographie zu trainieren und dich systematisch zu desensibilisieren. Denke rechtzeitig an deine multimediale Selbstdarstellung, um deinen Nachruhm zu sichern. Wenn der Tag der Rache gekommen ist, hole die Waffen aus dem Versteck, kleide dich schwarz und maskiere dich. Begib dich ins Epizentrum deiner Kränkungen und zeige aller Welt, dass sie dich verkannt hat und wozu du imstande bist. Verwandele die Stätte deiner Traumatisierungen in den Ort deines Triumphes und lass dein geschundenes und verkanntes Selbst in einem gigantischen finalen Feuerwerk verglühen.“ (Eisenberg 2016, 13) Diese Paraphrase des Täterstandpunkts leuchtet ein, inklusive der Einordnung der immer wieder bemühten Computerspiele, die erst dann Brisanz erhalten, wenn sich der Betreffende eben mit dem speziellen Interesse für sie begeistert. Die Erklärung ist damit aber nicht fertig.
Anerkennung, Ehre, Rache
| „Athena: … sag: hast du dein Schwert schön tief ins Blut von Griechenkriegern eingetaucht? Aias: Bin stolz darauf! Nicht im geringsten streit ich‘s ab. Athena: Auch auf Atriden sauste deine Faust herab? Aias: Die tun dem Aias wahrlich nie mehr Kränkung an.“ Sophokles (1970, 6) |
Der Einspruch Eisenbergs gegen die Psychiatrisierung und Individualisierung der Täter verstößt gegen den offiziellen Konsens der „Unerklärbarkeit“, wie ihn etwa die Bundespräsidenten Rau und Köhler nach den Amokläufen von Erfurt bzw. Winnenden vorgetragen haben (vgl. die Kritik daran bei Huisken 2009). Köhler: „Solche Taten führen uns an die Grenze des Verstehens. Und auch an die Grenze des Sagbaren, hinter der alles Deuten, Fordern und Erklärenwollen schnell unsäglich wird.“ (Rede vom 21. März 2009, www.bundespraesident.de) Ähnliches findet sich allerdings auch bei linken Autoren, so bei Hans-Peter Waldrich. Er schreibt zu Winnenden: „Eine Veranlassung zur Tat, die in einem verstehbaren Verhältnis zum Ausmaß der ausgeübten Gewalt steht, findet sich bei Schulamokläufen eigentlich nie. Dennoch gibt die Inhaltsleere der Taten einen Hinweis auf die Täter: Das Innere der Schulamokläufer gleicht einem Vakuum. Dieser allmählich entstandene seelische ‚Hohlraum‘ ist aber nicht ohne explosive Energie.“ (Waldrich 2009, 41f) Der Autor, der durchaus kritische Worte über den Schulalltag verliert, bringt das logische Unding zustande, die Tat aus etwas Nichtvorhandenem zu erklären. Analoges hat der Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer beigesteuert: „Der Kontrollverlust bei den Tätern besteht im Anerkennungszerfall und damit im Verlust der Kontrolle über das eigene Leben.“ (Heitmeyer 2009) Solche Erklärungen, die die Tat auf eine Leerstelle zurückführen, auf einen Verlust oder Zerfall, die die Kraft zum kontrollierten Aushalten des Daseinskampfs untergraben, sind nicht besser als die offiziellen politischen Ansagen, die die Vorschrift der Unerklärbarkeit erlassen. Statt der Grundlosigkeit erscheint hier die Inhaltsleere als Triebkraft.
Für die Mainstream-Psychiatrie hat der US-Autor Peter Langman (2009) die These von den „kranken Hirnen“ verbindlich gemacht – und dessen Buch „Amok im Kopf“ fanden ja kurioser Weise Kriminalbeamte, als sie das Zimmer des Münchner Amokläufers durchsuchten; der junge Mann hat sich anscheinend vor seiner Tat richtiggehend sachkundig gemacht. Aber auch von kritisch gesinnten Vertretern der Psychologie wird in diese Kerbe geschlagen. Hier erweist sich wieder einmal die Veröffentlichung von Meinhard Creydt „Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler“ (2015) als eine Fundgrube der Dummheiten des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs. Creydt hat sich in seinem Buch mit Huiskens Erklärung von Jugendgewalt allgemein und des Erfurter Massakers im Besonderen auseinandergesetzt, wofür er sich zunächst ein Zitat Huiskens erfindet. Dieser weigere sich, so die Behauptung, analytisch den „Mühen des Individuums, in seiner Lebensführung mit den Gegensätzen, die seine individuelle Existenz gesellschaftlich betreffen, subjektiv umzugehen.“ (Creydt 2015, 120) Statt diese Mühen ernst zu nehmen, setze der „rationalistische“ Marxist Huisken etwas anderes an den Anfang: „Den Ausgangspunkt von Huiskens Argumentation bilden die ökonomische Konkurrenz und die Subjektform, in der das Individuum sich selbst für sein gutes oder schlechtes Abschneiden in der Konkurrenz verantwortlich macht. Zu diesem ersten Denkschritt kommen weitere hinzu: Man kann sich als Gewinner- oder Verlierertyp wahrnehmen…“ (Ebd.)
Das ist ein schlechter Witz. Jugend hat keine freischwebende Existenz, sondern ist im Kapitalismus gesellschaftlich bestimmt, nämlich als Ressource für den Standort, der mangels Rohstoffvorkommen, so die gängige deutsche Globalisierungsrhetorik, gnadenlos in sein Humankapital investieren muss. Das heißt, Jugendliche sind in eine Bildungskonkurrenz, die die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt übernimmt, lückenlos und flächendeckend – von der Vorschule bis zum modernisierten Hochschulbetrieb – integriert. Dies ist keine theoretische Setzung, sondern ein Tatbestand, von dem sowohl Kritiker des Schulbetriebs wie Bildungspolitiker ausgehen. Jugendliche mögen sich für die unterschiedlichsten Anliegen erwärmen und sie sich auch zum Lebensinhalt machen – Huisken handelt dies ausführlich unter der Rubrik „Anerkennungskonkurrenz“ ab –, aber das ändert nichts daran, dass das staatliche Bildungssystem die „Gegensätze“ festlegt, die ihre „individuelle Existenz gesellschaftlich betreffen“. Huisken trifft daher keine willkürliche theoretische Entscheidung, wenn er diesen gesellschaftlichen Ort an den Anfang stellt und dann das Privatleben als die Sphäre erläutert, in der das bürgerliche Subjekt die an ihm vollzogenen – und von ihm fehlgedeuteten – Konkurrenzresultate durch Zusatzanstrengungen zu korrigieren oder zu bestätigen versucht.
Und genau dieser Punkt des Übergangs ist bei Huisken ausführlich Thema – im Unterschied zu anderen Kritikern des modernen Schulbetriebs. Huisken betrachtet Amokläufer nicht einfach als Opfer des schulischen Selektionsprozesses, sondern als selbstbewusste Individuen, die aus ihrer Misserfolgsbilanz – einer selbst erstellten, die sich auch in den höheren Sphären des Bildungsbetriebs abspielen kann und nicht objektiv an bestimmten Noten hängt – die Konsequenz ziehen, um ihre Anerkennung zu kämpfen. Sie sehen ihr Recht auf Erfolg bestritten, suchen dafür Schuldige, bewegen sich aber gerade nicht auf der Ebene der wirklichen Schulkonkurrenz, sondern machen ihre Ehre bzw. deren Beschädigung zum Thema. All diese Schritte kann und muss man erklären, denn so selbstverständlich, wie sie im Grunde jedem modernen Konkurrenzsubjekt erscheinen, sind sie nicht. Hier ist die Eingangsbemerkung von Eisenberg – das kennt doch jeder! – eben nicht die Auflösung des Falls. Diese Selbstverständlichkeit der Zustimmung moderner Konkurrenzsubjekte gilt es gerade zu analysieren.
Creydt macht den entgegengesetzten Fehler. Er stellt sich dumm, so als könnte man aus den Taten des Amokläufers überhaupt keine Schlüsse auf die zu Grunde liegenden Überlegungen ziehen und als würden im Kopf eines solchen Menschen alle möglichen Probleme hausen. Dass der Erfurter Schüler Robert S. keine rechtlichen, pädagogischen, therapeutischen Maßnahmen unternahm, um gegen seinen Schulverweis vorzugehen, erscheint dann als eine gewagte Deutung (Creydt 2015, 122): „An der Stelle, an der zu fragen wäre, warum die nahe liegende juristische Überprüfung der Schulentscheidung nicht zustande kam, geht Huisken von diesem Faktum aus und schließt aus ihm sehr frei, der Schüler habe seinen Ausschluss von der Schule akzeptiert.“ Ein merkwürdiger Einwand. Das Faktum ist eindeutig; Robert S. hat den Weg der Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes oder ähnliche Schritte – wozu er ja erst einmal seine Eltern in das konsequent verschwiegene persönliche Desaster hätte einweihen müssen – nicht eingeschlagen. Das, was er getan hat, ging in eine andere Richtung. Den Ausschluss aus der Schule nahm er hin, akzeptierte ihn, weil er für sich keine andere Möglichkeit sah. Laut Creydt soll man aber problematisieren, was der junge Mann unterlassen hat, um das zu erklären, was er getan hat. Wohin das führen soll, ist unerfindlich; auf jeden Fall hat der Autor damit angedeutet, dass der Fall voller Rätsel steckt. Dabei lassen sich die angesprochenen Unklarheiten durchaus auflösen, Huisken bespricht z.B. ausführlich die Verschwiegenheit von Robert S. wie auch die generelle Unauffälligkeit, die bei Amokläufern immer wieder auffällt (vgl. die Einleitung des Vortrags von 2009).
Von diesem Kaliber ist ein Großteil der zusammengesuchten Einwände Creydts. Im Weiteren kapriziert er sich dann darauf, die Kategorien von Anerkennung, Ehre und Rache in Zweifel zu ziehen. Zur Abwechslung stellt er sich nicht dumm, sondern bemüht den wissenschaftlichen Pluralismus, zumindest in Form einer anderen Fachautorität. Der Standpunkt der Ehre, wie er bei Huisken vorkommt, erscheint Creydt „zeitlos“ (ebd., 123), er erinnere an Schillers Erzählung vom „Verbrecher aus verlorener Ehre“, passe jedenfalls nicht zu den modernen Verhältnissen, denen der französische Philosoph Gilles Lipovetsky seit den 1980er Jahren eine Zunahme des Narzissmus attestiert habe. Theorien vom narzisstischen Charakter der Jugend waren ja zu dieser Zeit im Schwange, wobei man denken könnte, eine narzisstische Haltung, also eine übertriebene Selbstliebe, würde mit einer Erklärung, die auf die gekränkte Ehre zielt, eigentlich ganz gut zusammen passen. So soll ja auch bei dem Münchner Attentäter eine narzisstische Störung diagnostiziert worden sein. Creydt hat dem Buch des französischen Autors jedoch einen ganz anderen Schluss entnommen. Er zitiert: „Der lässige Mensch ist ein entwaffneter Mensch.“ (Ebd., 124) Der „Charakterpanzer“ der Individuen werde durch die gesellschaftliche Flexibilisierung aufgelöst, es entstehe eine neue Lässigkeit oder „allgemeine Beliebigkeit“, in der sich kaum noch jemand zum Selbstmord aufraffen könne: „Huisken redet von ‚verletzter Ehre‘ als Motiv, als ob über den Suizid nicht anders geredet werden müsste, wenn er in einem ‚Zeitalter der Indifferenz‘ eher unwahrscheinlich wird.“ (Ebd.) Dazu setzt er als Begründung ein weiteres Zitat Lipovetskys: „Da der Selbstmord eine radikale und tragische Lösung ist, da er eine extrem starke emotionale Besetzung von Leben und Tod voraussetzt und eine Herausforderung darstellt, entspricht er dem postmodernen Laxismus nicht länger.“ (Ebd.) So geht – nicht nur postmoderne – Theoriebildung im heutigen Wissenschaftsbetrieb: Was in der Realität stattfindet, die allseits konstatierte Zunahme suizidaler Attentate seit den 1990er Jahren oder das dauernde Einfordern von Respekt, blamiert sich angesichts einer Theorie, die das nicht vorsieht, und muss von daher umgedeutet werden, die Realität wohlgemerkt und nicht die Theorie.
Creydts Fazit: „Was ‚Ehre‘ zu Beginn des dritten Jahrtausends in Deutschland heißt … und was ‚Rache‘ – all das wird von Huisken als bekannt unterstellt. Zu Erklärendes firmiert als Evidentes. Als handle es sich bei ‚Ehre‘ und ‚Rache‘ um unhistorische Universalien. Die subjektiven Entwicklungsschritte, die zu einem vorbereiteten und geplanten Angriff auf Lehrer und Schüler führen, bleiben unbestimmt.“ (Ebd., 124f) Nichts von dem trifft zu. Weder geht es Huisken um Wahrscheinlichkeiten des Auftretens – das Faktum der Häufung ist Ausgangspunkt seiner Überlegungen wie für alle anderen Analytiker auch –, noch unterstellt er Anerkennung, Ehre und Rache als überzeitliche, auf kulturelle Handlungsmuster zurückführbare Größen oder als Selbstverständlichkeiten menschlicher Existenz. Im Gegenteil, er bestreitet die Evidenz dieser Handlungsmaximen, die für viele andere Bobachter, auch kritisch gesinnte, auf der Hand zu liegen scheint. Huisken macht sich die Mühe, die angeblich selbstverständliche Praxis, eine nicht erbrachte Leistung oder einen kassierten Misserfolg in ein Urteil über die eigene Person umzudeuten, daraus eine persönliche Bilanz zu verfertigen und schlussendlich – nach der Identifizierung von Schuldigen – als Rächer zur Tat zu schreiten, Schritt für Schritt analytisch aufzulösen. Das unterscheidet ihn, wie erwähnt, von anderen Autoren, die die gängige Auffassung der Konkurrenz übernehmen und damit schnell beim Verständnis für die schwierige Lage der neoliberalen Konkurrenzsubjekte landen. Die Publizistin und Schriftstellerin Ines Geipel, die mit ihrem Erfurt-Buch (2004) für einige Kontroversen sorgte, verfährt z.B. so. Die Amoktat wird von ihr als eine Art Überreaktion gedeutet, was sofort die Frage aufwirft, wie man dem Übermaß entgegenwirken kann. So forderte Geipel „in einem Radio-Interview nach dem Amoklauf in München … dazu auf, sich Gedanken zu machen über mögliche Angebote und die Wieder-Einbindung der sich ‚auf der Suche nach Idealitität [?] befindenden‘ potentiellen Täter, die ‚Andocksysteme suchten, glauben, lieben wollten‘, ‚verlorene Söhne‘ seien, ‚Bezug zum symbolischen, gesellschaftlichen Vater suchten‘: ‚welche Sublimierungsmodelle man diesem Typ Männer anbieten kann‘ … sei es von Bedeutung, dass die Täter meist junge Männer seien, die keinen Platz in ihrem Umfeld fänden. Mit ihrer Tat würden sie immer auf ein bekanntes Muster referieren.“ (Wikipedia, 12.8.2016)
Leider geht auch der Schluss von Eisenbergs Essay in eine solche Richtung: „Die einzig denkbare Amok-Prävention wäre eine soziale. Wir müssten der Demontage des Sozialstaats Einhalt gebieten und Solidarität an die Stelle des entfesselten Konkurrenzkampfes setzen. Es gilt, gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen, in denen der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr und Freundlichkeit der vorherrschende Kommunikationsstil ist. Das würde langfristig den Nährboden austrocknen, auf dem Amoklauf und Terrorismus gedeihen.“ (Eisenberg 2016, 13) Nichts gegen andere gesellschaftliche Verhältnisse! Aber was hier anklingt ist eine Mäßigung des Konkurrenzstrebens, die noch nicht einmal groß die Praxis im heutigen Bildungs- und Beschäftigungssystem anzugreifen braucht, sondern die bekannte Konkurrenzmoral aufleben lässt, dass man bei allem Gegeneinander, das sein muss, im Mitbewerber nicht den Mitmenschen vergisst.
Literatur
- Meinhard Creydt, Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler – Interessenpolitik, Autonomie und linke Denkfallen. Hamburg 2015.
- Götz Eisenberg, Amok – Kinder der Kälte. Über die Wurzeln von Wut und Haß. Reinbek 2000.
- Götz Eisenberg, Damit mich kein Mensch mehr vergisst – Warum Amok und Gewalt kein Zufall sind. München 2010.
- Götz Eisenberg, Zwischen Amok und Alzheimer – Zur Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus. Frankfurt/M. 2015.
- Götz Eisenberg, „Gestörte Einzeltäter“? Amok und Terror könnten zur Signatur des neoliberalen Zeitalters werden. In: Junge Welt, 11.08.2016, S. 12-13.
- Ines Geipel, Für heute reicht's – Amok in Erfurt. Berlin 2003.
- Ines Geipel, Der Amok-Komplex oder die Schule des Tötens. Stuttgart 2012.
- Wilhelm Heitmeyer, Jugendliche Massenmörder – Der doppelte Kontrollverlust. In: taz, 19.3.2009.
- Freerk Huisken, Jugendgewalt – Der Kult des Selbstbewusstseins und seine unerwünschten Früchtchen. Hamburg 1996.
- Freerk Huisken, z.B. Erfurt – Was das bürgerliche Bildungs- und Einbildungswesen so alles anrichtet. Hamburg 2002.
- Freerk Huisken, School shooting (Vortrag). 2009, online: https://soundcloud.com/arab-2/freerk-huisken-schoo….
- Peter Langman, Amok im Kopf – Warum Schüler töten. Mit einem Vorwort von Klaus Hurrelmann. Weinheim und Basel 2009.
- Friedrich Nietzsche, Vom freien Tode (1883). In: Also sprach Zarathustra, Nietzsche, Werke, hg. von K. Schlechta, Band 2, München 1960.
- Sophokles, Aias. In: Sophokles, Werke, hg. von R. Schottländer, Berlin und Weimar 1970.
- Arata Takeda, Ästhetik der Selbstzerstörung – Selbstmordattentäter in der abendländischen Literatur. München 2010.
- Hans-Peter Waldrich, In blinder Wut – Amoklauf und Schule. Köln 2007.
- Hans-Peter Waldrich, Tatort Schule. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 4, 2009.
Juli 2016
Mit Kritikern des (psychologischen) Determinismus diskutiert man nicht!
2016 ist die dritte Auflage von Albert Krölls' „Kritik der Psychologie“ erschienen – und hat neben Zustimmung auch einigen öffentlichen Widerspruch erfahren. Dazu eine Information der IVA-Redaktion mit einer Stellungnahme des Autors.
Zehn Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung seiner „Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes“ legte Albert Krölls Ende März 2016 eine überarbeitete und erweiterte Neuausgabe vor, die den bereits in der zweiten Auflage von 2007 aufgenommenen Diskussionsteil sowie andere Kapitel um einige Punkte ergänzte (vgl. IVA-Redaktion 2016). Im Rahmen einer neuen Schlussbetrachtung erläutert Krölls dort z.B. – anknüpfend an den Untertitel vom modernen Opium – den Nutzwert, den die psychologische Weltanschauung für die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft hat. Es gab zur Neuausgabe zustimmende Reaktionen (vgl. Wohlfahrt 2016), aber auch Widerspruch, der die theoretische Position des Psychologie-Kritikers grundsätzlich verwarf (vgl. Schillo 2016). Kürzlich meldete Michael Zander in einer Rezension der Tageszeitung Junge Welt (JW) derartigen Widerspruch an (Zander 2016). Im Folgenden ist dieser Text dokumentiert, anschließend nimmt Albert Krölls dazu Stellung und referiert die Schwierigkeiten, eine Debatte zu führen, worauf es abschließend ein paar Bemerkungen von IVA in eigener Sache gibt
Unhaltbare Polemik (Michael Zander)
Seit jeher stehen Marxisten der Psychologie skeptisch gegenüber. Sie halten das Fach nicht ganz zu Unrecht für sozialwissenschaftlich uninformiert, insofern es Menschen nur als Produkte ihrer Lebensumstände, aber nicht als Produzenten der Gesellschaft versteht. Marxistische Psychologen in Ost und West haben ihr Fach gründlich kritisiert und eigenständige Ansätze entwickelt. Anders der Sozialwissenschaftler und Jurist Albert Krölls: In seiner „Kritik der Psychologie“, die kürzlich in dritter Auflage bei VSA erschienen ist, will er das „moderne Opium des Volkes“ entlarven. Sein Hauptvorwurf lautet: „Wenn Psychologen den Willen erforschen, fragen sie nicht nach dem Zweck des Handelns, sondern suchen nach den Ursachen von Willensleistungen außerhalb von Willen und Bewusstsein. (…) Ihr Bild vom Willen macht die ›Verrückten‹ und ›Geisteskranken‹, die ihres Willens nicht mächtig sind, zur Norm, die auch die ›inneren Prozesse‹ erklärt, die bei den ›Normalen‹ ablaufen.“ Das Programm der Psychologie bestehe unter anderem darin, „Verhaltensdeterminanten finden zu wollen“. Per Korrelationsstatistik schlössen Psychologen fälschlich von einer „gehäuften Gleichzeitigkeit“ von Phänomenen auf einen Kausalzusammenhang.
All diese Kritiken sind unhaltbar. Psychologen interessieren sich sehr wohl für Handlungszwecke, die sie etwa mittels Fragebögen oder qualitativer Interviews erheben. Sie halten „Willen“ und „Bewusstsein“ mit Recht für Phänomene, die nicht aus sich selbst erklärt werden können; Marx und Engels hielten übrigens entsprechende Versuche für Ideologie. Die Kategorien „verrückt“ und „geisteskrank“ haben in einer Fachdebatte nichts zu suchen. Es ist ein Zeichen wissenschaftlichen Fortschritts, keinen prinzipiellen Unterschied bei der Erklärung von „verrücktem“ und „normalen“ Verhalten zu machen. Man kann kritisieren, wie die Psychologie die objektive Bestimmtheit von Handlungen modelliert. Ohne irgendeine Form von Determiniertheit wäre allerdings keine Sozialwissenschaft möglich. Zudem wird in der Psychologie keineswegs umstandslos von Korrelation auf Kausalität geschlossen. Entscheidend ist vielmehr die Möglichkeit, Ausgangsbedingungen so zu manipulieren, dass sie vorhersagbare Ergebnisse zeitigen. Diese Methode ist durch zahlreiche Probleme belastet, nur kommt kaum eines davon im Buch vor.
In weiteren Kapiteln polemisiert Krölls gegen Sigmund Freuds Psychoanalyse, Theodor W. Adornos angeblichen „Psychomarxismus“ und Klaus Holzkamps kritische Psychologie. Er meint, Freuds These vom elterlichen Einfluss auf die Gewissensbildung würde die „Frage nach der Herkunft dieser Traditionen bei den ersten Eltern“ schuldig bleiben. Genausogut könnte er die Zeugung anzweifeln und fragen, wer den „ersten Vater“ gezeugt habe. Handelte das Buch auf diesem Niveau von Ökonomie oder Soziologie, wäre es wohl nicht ins Programm eines linken Verlags aufgenommen worden.
Im Namen der unheiligen Liaison von Marxismus-Leninismus und Psychologie: Der Ausschluss der Determinismuskritik aus der Fachdebatte (Albert Krölls)
Als Reaktion auf diese Veröffentlichung trat ich wenige Tage später an die Redaktion der Jungen Welt mit der Aufforderung heran, möglichst bald die im Folgenden abgedruckte Kurzstellungnahme zu dieser Rezension zu veröffentlichen; zugleich schlug ich die Veranstaltung eines öffentlichen Streitgespräches mit dem Autoren der Rezension vor.
An die Redaktion der Jungen Welt
Es mutet einigermaßen überraschend an, wenn eine für ihre faktengetreue Berichterstattung und faire politische Diskussionskultur bekannte linke Tageszeitung dem Abdruck einer Rezension Raum gibt, die in weiten Teilen auf der interessiert-zerrbildartigen Wiedergabe zentraler Aussagen des besprochenen Buches beruht. Die einem unbefangenen Leser unmittelbar ins Auge fallenden massiven Fehlinformationen des Rezensenten zum Inhalt des Buches bedürfen der Richtigstellung. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Redaktion die im Anhang (siehe den folgenden Text) übersandte Entgegnung zeitnah veröffentlichen wird. Sollte darüber hinaus die Bereitschaft bestehen, mir Gelegenheit zu einer vertieften Stellungnahme zur Rezension von Herrn Zander zu geben, würde ich dies natürlich sehr begrüßen. Darüber hinaus würde ich auch für ein öffentliches Streitgespräch mit dem Redakteur Ihrer Zeitung zur Verfügung stehen, auf Grund dessen sich der geneigte Leser selber ein Urteil bilden kann, wer sich in dieser Auseinandersetzung einer „haltlosen Polemik“ befleißigt.
Für den nicht auszuschließenden Fall, dass die Redaktion wegen der Länge des Beitrages Bedenken gegenüber einem Abdruck in der Printausgabe der JW haben sollte, spräche aus meiner Sicht nichts dagegen, die Replik lediglich in der Online-Ausgabe zu veröffentlichen. Ich verbleibe in Erwartung einer baldigen Rückantwort und mit freundlichen Grüßen, A.K.
Anhang: Entgegnung auf die Rezension von Michael Zander
Die über weite Strecken unzutreffende zerrbildartige Wiedergabe der Aussagen des Buches und die darauf basierenden Urteile des Rezensenten bedürfen der Korrektur:
Zur Rolle von Handlungszwecken im Rahmen psychologischer Erklärungen:
So hält der Rezensent allen Ernstes dem Buchautor entgegen: „Psychologen interessieren sich sehr wohl für die Handlungszwecke, die sie etwa mittels Fragebögen oder qualitativer Interviews erheben.“ Der vom Rezensenten bis zur Unkenntlichkeit verdrehte Aussagehalt der einschlägigen Passagen des Buches besteht demgegenüber in der Bestimmung der (kritikablen) Art und Weise, wie sich die Psychologie für den Willensinhalt der Subjekte interessiert (Hervorhebungen im Folgenden durch A.K.):
„Psychologen haben eine eigentümliche Auffassung vom Willen. Wenn sie sich mit dem Willen beschäftigen, offenbaren sie ein lediglich bedingtes Interesse am Willensinhalt, d.h. der Frage, was die Menschen denken und wollen. Wenn sich Psychologen bspw. auf die Suche nach einer Erklärung politischer Attentate (…) begeben, gilt ihr primäres Erkenntnisinteresse keineswegs den subjektiven Handlungsgründen der Akteure (…). Sondern mit der Frage nach dem ‚Warum‘ ihres Denkens und Handelns ist die gänzlich andere Frage danach aufgeworfen, auf welche inneren und/oder äußeren Umstände jenseits von Wille und Bewusstsein die Aktionen der Subjekte zurückzuführen sind.“ (Krölls 2016, 18) „Weil vom psychologischen Standpunkt das Tun und Treiben der Subjekte ohnehin lediglich die äußere Erscheinungsform dahinterliegender Prozesse bildet, fungiert im Rahmen psychologischer Erklärungen der zweckbestimmte Inhalt der Handlungen deshalb in der Regel lediglich als bloßer Anknüpfungspunkt oder Material für Rückschlüsse auf die im Inneren des Menschen angesiedelten tieferen Ursachen ihres Tuns.“ (Ebd., 21)
Zur Rolle der Korrelationsstatistik im Rahmen psychologischer Erklärungen:
Der Rezensent hält dem Buchautor entgegen: „Zudem wird in der Psychologie keineswegs umstandslos von Korrelation auf Kausalität geschlossen. (…) Diese Methode ist durch zahlreiche Probleme belastet, nur kommt kaum eines davon im Buch vor.“ Dazu findet sich im Buch folgende vom Rezensenten unterschlagene zentrale Aussage, die zugleich den methodisch-problematisierten (umständlichen) Weg aufspießt, auf dem die empirische Psychologie zielstrebig zum letztendlichen Ergebnis der Fiktion von (wahrscheinlichen) Wirkungszusammenhängen gelangt: „Die Aussage, dass die empirisch-erfahrungswissenschaftlich orientierte Psychologie von Korrelationen auf die Existenz von Kausalzusammenhängen schließen würde, ist beinahe eine verharmlosende Charakterisierung. Ihren Fachvertretern ist natürlich durchaus bekannt, dass kein Ursache-Wirkungs-Verhältnis zwischen dem Storchenaufkommen und der Geburtenrate besteht. In voller Kenntnis des fundamentalen Unterschiedes zwischen Korrelation und Kausalität, das sie im Ausgangspunkt als methodologisches Problem referieren, pflegen Psychologen diesen Umstand im weiteren Gang ihrer Forschungen umso ungenierter zu ignorieren, wenn sie das von ihnen (experimentell) erhobene Zahlenwerk als Beleg für die Existenz von Wirkungszusammenhängen deuten. (…) Wenn man also dieses Wissen um die Untauglichkeit der Korrelation als Beweismittel für Kausalbeziehungen ernst nehmen würde, würde man stattdessen an den sachlichen Bestimmungen des Erklärungsgegenstandes weiterdenken, und sich von Statistiken aller Art grundsätzlich als Beweismittel für Kausalverhältnisse verabschieden.“ (Krölls 2016, 30, Anm. 8)
Die Universalität des (psychologischen) Determinismus als Wahrheitsbeweis:
Aus der flächendeckenden Verbreitung eines solchen Erklärungsmodus nicht nur im Bereich der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, sondern auch im Lager marxistischer Wissenschaft lässt sich ohnehin kein beweiskräftiges Argument für das psychologische Dogma der Determination des Denkens und Handelns gewinnen. Die Aussage des Rezensenten, wonach „ohne irgendeine Form von Determiniertheit“ keine Sozialwissenschaft möglich sei, stellt einer so beschaffenen Gesellschaftswissenschaft umgekehrt ein ziemliches Armutszeugnis aus. Wenn Wissenschaft nur gehen soll mittels der zirkulären Verdoppelung ihrer Erklärungsgegenstände in Gestalt der beliebten psychologischen Zurückführung sämtlicher Handlungen der Subjekte auf das Wirken gleichnamiger innerer Antriebskräfte oder Dispositionen nach dem Muster „Gewalttaten werden verübt, weil im Inneren des Menschen eine Gewaltbereitschaft besteht“, deren Existenz dann umgekehrt damit „bewiesen“ wird, dass die „Gewaltpotenz sich in der Gewalttat äußert“ (zu dieser typischen psychologischen Erklärungs(un)logik vgl. Krölls 2016, 21f), dann kann man getrost auf sie verzichten.
Zur ungerechtfertigten Berufung auf Marx:
Marx als Kronzeugen für den (psychologischen) Determinismus anzuführen, ist ein Fehler, der übrigens im Buch selber schon thematisiert ist. Daher seien im Folgenden die Ausführungen aus dem Diskussionsteil des Buches („Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein – Argumente gegen ein gängiges Fehlverständnis“) zitiert, die mit der Frage eines Lesers beginnen: „Der Marxismus vertritt doch bekanntlich die Auffassung, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt. Wollen Sie denn ernsthaft behaupten, dass es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen des Kapitalismus und dem Denken der (lohnabhängigen) Gesellschaftsmitglieder gibt?“ (Krölls 2016, 220) Die Antwort beginnt: „Nein, keineswegs. Es gibt schon einen Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Realität und den Urteilen, welche die Subjekte über diese Verhältnisse im Kopfe haben. Nur handelt es sich dabei eben nicht um einen Determinationszusammenhang dergestalt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse den Inhalt der Gedanken der Subjekte über den Kapitalismus erzeugen würden…“ (Ebd.) Weiter heißt es dort: „Es ist also weder notwendig noch vernünftig, die durch die öffentliche Gewalt aufgezwungene lebenspraktische Abhängigkeit von der Befolgung der Spielregeln der freiheitlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung auch noch um die entsprechende geistige Botmäßigkeit zu ergänzen. Die vielzitierte Aussage von Marx, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt, kritisiert dementsprechend den Bewusstseinszustand der lohnabhängigen Staatsbürger: Wer sein Bewusstsein durch die gesellschaftliche Realität des Kapitalismus bestimmen lässt, macht einen folgenschweren Fehler. Dieser Satz richtet sich also gegen die verstandesmäßige Leistung des Lohnarbeitersubjekts, ungeachtet des wenig menschenfreundlichen Charakters der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im demokratischen Kapitalismus diese Verhältnisse unter Verzicht auf eine Prüfung ihrer Tauglichkeit für die eigenen Lebenszwecke zur fraglos bestimmenden Leitlinie seines Denkens und Handelns zu machen.“ (Ebd., 223)
Zur hochgradigen Widersprüchlichkeit der von Zander verteidigten Kategorie eines „bedingten Willens“ – „Psychologen halten ‚Willen‘ und ‚Bewusstsein‘ mit Recht für Phänomene, die nicht aus sich selbst erklärt werden können“ – sei ergänzend verwiesen auf die Ausführungen im Diskussionsteil des Buches („Freiheit oder Determination des Willens? – Eine grundlegend falsche Fragestellung“, ebd., 181ff; zur Frage der Determination des Willens ist auch ein Vortrag im Netz dokumentiert, vgl. Krölls 2014).
Zur Kategorie der „Geisteskrankheit“:
Es mag ja sein, dass der progressive Zweig der geisteswissenschaftlich orientierten Psychologie im Unterschied zur Abteilung der Psychiatrie beschlossen hat, keine wesentlichen Unterschiede mehr zwischen der Qualität der Geistesleistungen von Subjekten mit hirnorganischen Defekten und anderen krankhaften Störungen der Geistestätigkeit und den (verrückten) Verstandesleistungen von „Normalbürgern“ kennen zu wollen. Nur vermag dieser wohl weniger auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende als von Überzeugungen der political correctness geleitete Paradigmenwechsel wohl kaum die inkriminierte Feststellung des Buches zu entkräften, wonach die psychologische Vorstellung des Ablaufes der Willensbildung beim „Normalsubjekt“ ihr maßgebliches Anschauungsmaterial aus dem Reiche der Erscheinungsformen des funktionsgestörten Verstandes entnimmt. Die Untauglichkeit dieses Gegenargumentes tut dessen Produktivkraft als politmoralischem Diffamierungsinstrument freilich leider keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit dem Hinweis auf einen Verstoß gegen das von Zander im Namen des wissenschaftlichen Fortschrittes dekretierte Verbot der theoretischen Unterscheidung zwischen dem funktionsgestörten Geist und der Normalform des (bürgerlichen) Verstandes wird derjenige, der solche Kategorien wie die der „Verrücktheit“ verwendet, als Teilnehmer aus der Fachdebatte ausgeschlossen. Der lästigen Notwendigkeit einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Argumenten gegen den Determinismus als universellem Fehlerklärungsmodus einer Wissenschaft namens Psychologie sowie mit der im Buch ausgeführten Kritik an den psychologischen Theorievarianten von der Tiefenpsychologie bis zur Kritischen Psychologie hat sich der Rezensent auf diese Weise erfolgreich entledigt. Die argumentlose Verleihung des Generalnegativ-Etiketts der „unhaltbaren Polemik“ bildet die dazu passende Form der „Widerlegung“.
Nachdem die Redaktion der Jungen Welt zunächst überhaupt nicht auf meine Zuschrift antwortete, wandte ich mich an den Chefredakteur und erhielt von diesem folgende Nachricht:„Entgegnungen auf Rezensionen sind ungewöhnlich, aber selbstverständlich möglich. Allerdings bedeutet das Eröffnung einer Debatte. Ob die in einer Tageszeitung zu diesem Gegenstand sinnvoll ist, bespreche ich mit meinen Kollegen und lasse von mir hören.“ Seit dieser Mitteilung ist fast ein Monat ins Land gegangen, ohne dass die angekündigte Rückmeldung erfolgt wäre. Der Autor der Rezension hatte bereits vorher definitiv seine Teilnahme an einem öffentlichem Streitgespräch abgelehnt, zu dem er vom Verfasser einer weiteren kürzlich veröffentlichten Rezension des Buches (siehe Wohlfahrt 2016) eingeladen worden war. Seine Weigerung hatte Zander mit folgenden, hier auszugsweise wiedergegebenen Argumenten begründet:
„Ich habe nochmals über Ihre Einladung nachgedacht, u.a. weil das Buch von Herrn Krölls ja offensichtlich recht populär ist, aber meine Antwort bleibt nein. Aus meiner Sicht ist das Buch voll mit Überverallgemeinerungen, Irrtümern und Halbwahrheiten, die alle richtigzustellen äußerst aufwändig und im Rahmen einer Veranstaltung auch undankbar wäre, eine Arbeit, die in meinen Terminplan absolut nicht unterzubringen ist. Hinzu kommt, dass ich durch den Tonfall und die Rhetorik des Buchs den Eindruck gewonnen habe, dass der Autor vor allem tabula rasa in Sachen Psychologie machen möchte und nicht so sehr an einer Fachdebatte interessiert ist. Bei einer Diskussion würde voraussichtlich nur wieder die Unvereinbarkeit unserer Standpunkte deutlich werden. Vielleicht komme ich dazu, mich noch einmal ausführlicher schriftlich mit dem Buch auseinanderzusetzen, versprechen kann ich es aber nicht.“
Zu dieser Diskussionsabsage ist Folgendes festzuhalten: Man erfährt auf diese Weise etwas über die bemerkenswerte Bindung eines Wissenschaftlers an seinen Terminplan – der einerseits die Verfassung einer publikumswirksamen unhaltbaren Rezension dieses Kalibers zulässt, es aber andererseits nicht erlauben soll, die von Autor angeblich erkannten zahlreichen „Überverallgemeinerungen, Irrtümer und Halbwahrheiten“ des Buches im Rahmen einer Diskussion unter Beweis zu stellen. Es würde für diesen Zweck ja vollends ausreichen, einige repräsentative Fehler des Buches dazulegen, was eigentlich eine leichte Übung für den Rezensenten darstellen sollte. Vor allem aber verdanken wir Michael Zander die antikritisch-affirmative Definition einer „Fachdebatte“, die durch die Zulassungsvoraussetzung bestimmt ist, dass deren Teilnehmer unbedingte Parteigänger des Streitgegenstandes „Psychologie“ zu sein haben, und die überaus erkenntnisstiftende Feststellung, dass eine Streitschrift mit dem Titel „Kritik der Psychologie“ tatsächlich einen Angriff auf die gesamte gleichnamige Disziplin beinhaltet – wer hätte das gedacht?
Die von Zander eingeschlagene Tour, Kritik geistig auf den Kritikgegenstand verpflichten zu wollen, ist wohlbekannt aus der Umgangsweise der Apologeten der bürgerlichen Gesellschaftsordnung mit der marxistischen Gesellschaftskritik, die jede Kritik am Kritikgegenstand damit mundtot zu machen suchen, dass sie diese auf eine konstruktive Kritik festnageln und die mangelnde Bereitschaft dazu mit einem Nichtbefassungsbeschluss zu ahnden pflegen. Zander als Repräsentant der kritischen Psychologie macht mit der Übernahme dieser antikritischen Verfahrensweise deren Namen alle Ehre: Kritik an psychologischen Theorien im Dienste ihrer Verbesserung immer, eine Kritik an der Disziplin selber und deren deterministischem Grunddogma gehört sich jedoch nicht und wird mit Nichtbefassung bzw. mit dem Titel der unsachlichen Polemik erledigt. Denn die Sache verlangt ja gemäß dem psychologisch-pseudomarxistischen Dogma Zanders, dass Kritik nur auf dem konstruktiv-deterministischen Boden dieser Wissenschaft zulässig ist.
Was den im Buch angeschlagenen Tonfall und dessen Rhetorik in der Auseinandersetzung mit Kritikern der Aussagen der „Kritik der Psychologie“ betrifft, welche von Zander zur Begründung seiner Absage an eine öffentliche Diskussion bemüht werden, so wirkt eine derartige Aussage ausgerechnet aus dem Munde eines Autoren, der unter weitestgehendem Verzicht auf Argumente zur Sache mit dem Generalverdikt der „unhaltbaren Polemik“ operiert, schon ein wenig erstaunlich. Und warum schließlich sollte eine Diskussion ganz losgelöst vom Inhalt der widerstreitenden Positionen die Zweckbestimmung haben, eine Vereinbarkeit der Standpunkte zu stiften? Sollte es in einem wissenschaftlichen Streitgespräch nicht vielmehr ausschließlich um die Wahrheit über die Sache gehen? Dabei mag sich als Resultat der Auseinandersetzung aufgrund einer neu hergestellten Einigkeit in der Sache oder des Ausräumens möglicher Missverständnisse eine Übereinstimmung ergeben oder aber auch nicht. Wer dieses Postulat der Einigkeit oder Annäherung als a-priori-Kriterium an eine Debatte anlegt, verfehlt grundlegend Sinn und Zweck eines wissenschaftlichen Streitgespräches. Zumindest darüber herrschte jedenfalls zu früheren Zeiten einmal Einigkeit unter Marxisten, dass es jenseits aller persönlichen Befindlichkeiten um nichts als die Klärung der Sache geht. Es stellt sich nach alledem die (schon beinahe rhetorische) Frage, warum Zander der interessierten Öffentlichkeit partout die Möglichkeit verwehren will, sich auf Basis eines Streitgespräches zwischen den Kontrahenten ein eigenständiges Urteil über die Überzeugungskraft der gegenseitigen Argumente zu bilden. Warum will er umgekehrt die Gelegenheit nicht einfach nutzen, um einer größeren Zuhörerschaft die Unhaltbarkeit der „Kritik der Psychologie“ vor Augen zu führen?“
Nachbemerkung der IVA-Redaktion
Die IVA-Redaktion hält die inhaltliche Auseinandersetzung über die Aussagen des Buches von Albert Krölls für wichtig. Dazu hat sie auf dem IVA-Blog bereits die beiden erwähnten Texte publiziert (IVA-Redaktion 2016a, Schillo 2016); zudem ist auf dem Blog eine Information zum Thema Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus erschienen (IVA-Redaktion 2016b), die auch auf das Thema „Geisteskrankheit“ als Diagnose von Psychiatrie und Psychopathologie eingeht und die die Position von Krölls dazu einbezieht. Da eine wünschenswerte Fortsetzung der Debatte im Rahmen der Jungen Welt in absehbarer Zeit wohl nicht zustande kommt, haben wir uns entschlossen, der Diskussion an dieser Stelle ein Forum zu bieten.
Krölls hat darüber hinaus angekündigt, die Kontroverse um die JW-Rezension im Zuge einer – zu einem späteren Zeitpunkt möglichen – aktualisierten Neuauflage nach bewährter Tradition in den Diskussionsteil seines Buches aufzunehmen. Bei dieser Gelegenheit will sich der Autor nicht nur vertieft mit dem Verhältnis von Marxismus und Psychologie, sondern auch mit dem Pseudobeweischarakter des psychologischen Experimentes befassen. Diesen Punkt hat Zander nämlich in der weiteren Korrespondenz zum Beleg für seine Determinations-These ins Feld geführt. Hier sein zentrales Argument: „Was die inhaltlichen Punkte betrifft, so machen die weiteren Ausführungen im Buch, die Sie, Herr Krölls, noch einmal gemailt haben, die Argumentation nicht richtiger. Nur so viel: Statistiken im Kontext von Experimenten sind kein bloßes ‚Zahlenwerk‘; wenn in einem Experiment die Ausgangsbedingungen verändert werden und die Teilnehmer sich dann anders verhalten, dann lässt sich nicht mehr sagen, es handele sich um einen bloßen Scheinzusammenhang á la Geburtenrate & Storchenpopulation; trotzdem kann die Zusammenhangserklärung natürlich falsch sein bzw. kritisiert werden, z.B. weil Versuchsleiter und Teilnehmer die experimentelle Situation unterschiedlich interpretieren. Wären Handlungen arbiträr, d.h. würden nur auf die nicht weiter zurückführbaren Größen ‚Willen‘ und ‚Bewusstsein‘ beruhen, dann wäre auch der historische Materialismus hinfällig.“
Für die Klärung solcher und anderer Einwände oder Nachfragen steht natürlich auch weiterhin die IVA-Website zur Verfügung. Voraussetzung für die Veröffentlichung von Diskussionsbeiträgen ist allerdings, das sie sich argumentativ auf die verhandelte Sache einlassen. Dazu noch ein Hinweis in eigener Sache: Zur ursprünglichen Buchinformation und dem Einspruch eines Kommentators, der auf das Psychologie-Kapitel im Buch von Meinhardt Creydt (2015) aufmerksam gemacht hatte, gab es auf dem IVA-Blog die Antwort „Creydt kritisiert Krölls?“. Diese kam nach Durchsicht von Creydts Einwänden in dem besagten Kapitel zu dem Schluss, dass von einer „grundlegenden Kritik“ an Krölls keine Rede sein kann, und erläuterte dies ausführlich. Daraufhin meldete sich Kommentator Georg auf contradictio.de („Zur Reduktion psychischer Prozesse auf Ideologie und Moral“, 22. April 2016), dem wiederum Anmerkungen von Jana (23. April) folgten. Der erste Kommentar zeigte sich unzufrieden mit diesem abschlägigen Bescheid, zugleich aber – neben einigen Textmissverständnissen – uninteressiert daran, die vermisste grundlegende Kritik an Krölls nachzuliefern.
Georg beschwerte sich in seiner Replik u.a. über die Behandlung der Sinnfrage durch die IVA-Autoren. Der von ihm entdeckte „prinzipielle Unwillen, sich auf psychische Prozesse als Thema einzulassen“, zeige sich auch daran, dass der IVA-Stellungnahme „zur Frage, was zum Thema ‚Sinn im endlichen Leben und das Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit‘ zu sagen ist, allein die wegwerfende Vokabel ‚pfäffisch‘ einfällt.“ Offenkundig hatte der Kommentator den Schluss des Textes, wo es um den „pfäffischen Stil“ ging, falsch gelesen. Das Missverständnis wurde auch von Kommentatorin Jana übernommen, allerdings nicht zum besonderen Problemfall gemacht. Vielleicht ist daher noch einmal eine Klarstellung zu der – zugegeben – lapidar angehängten Bemerkung angebracht. Dem ausführlichen IVA-Text war folgendes Postskriptum angefügt: „Creydt erwartet in seinem oben zitierten Resümee einer Psychologie, die ihre rationalistische Borniertheit überwindet, dass sie sich der ‚Erfahrungen und Probleme‘ annimmt, ‚die das In-die-Welt-kommen, die Integration partikularer psychischer Bestände, den Sinn im endlichen Leben und das Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit betreffen‘ (Creydt 2015, 112). Dass am Schluss auch noch ein religiöser Tonfall aufkommt, dass im pfäffischen Stil gegen den ‚Glauben an die Vernunft‘ (ebd.,) Stellung bezogen wird, ist kein Zufall. Die psychologische Seelenkunde ist eben im christlichen Abendland der Nachfahre der religiösen Seelsorge. Näheres kann man bei Krölls nachlesen, der seinem Buch ja den Untertitel vom modernen ‚Opium des Volkes‘ gegeben hat.“
Natürlich ist die Sinnfrage nicht pfäffisch, davon war im Text auch nicht die Rede, sondern von Creydts polemischem Fazit, dass der Horizont von Krölls und Co. in rationalistischer Manier durch den „Glauben an die Vernunft“ bestimmt, d.h. beschränkt sei. Die Sinnfrage ist topaktuell bei modernen Menschen, die sich von klerikaler Bevormundung frei gemacht haben. Die polemische Stoßrichtung von Krölls' Buch zielt ja, wie vermerkt, auf die heutige Situation, wo man eben nicht mehr zum Seelsorger geht, um sich geistlichen Beistand zu holen, sondern zum Seelendoktor, der einem mental auf die Sprünge helfen soll. Das entsprechende Fazit zieht das neue Schlusskapitel der dritten Auflage (siehe Krölls 2016, 167f: Das „persönliche Lebensglück“ soll nicht mehr durch die Befolgung religiös begründeter Vorschriften, sondern durch „Selbstverwirklichung“ realisiert werden.) Als „pfäffisch“ wurde die Rede vom „Glauben an die Vernunft“ aus folgendem Grund bezeichnet: Jeder – auch ein gläubiger Mensch – kennt die Entgegensetzung von Glaube und Vernunft. Wer sich zu seinem Gott (oder einer anonymen höheren Kraft) bekennt, will sich aus der verstandesmäßigen Relativität, die ewig auf Begründungen angewiesen ist, befreien und entscheidet sich willentlich für etwas Absolutes, das ihm im Leben Halt geben soll (vgl. Sohdorf 2016). Wer diese Entscheidung nicht trifft verzichtet auf den Glauben – jedenfalls im religiösen Sinne, im Alltagssinne des unsicheren Wissens kann er natürlich an alle möglichen Dinge glauben. Dass die Vernunft nun selber zum Glauben umgedeutet wird, ist eine Leistung von Theologen, d.h. von geschulten Gläubigen, die „Apologetik“ (so ein offizielles theologisches Fach) ihres Standpunkts betreiben. Dass sie selber sich entschieden haben zu glauben, soll eine menschliche Grundkonstante sein, die sie auch denen unterschieben, die offenkundig dieses Bedürfnis nicht teilen. So sagt der Theist zum Atheisten: Alle Menschen glauben, du glaubst eben an die Nicht-Existenz Gottes! Auf die Sinnfrage bezogen: Wer ablehnt, sie sich zu stellen, sie womöglich kritisiert, wird darüber belehrt, dass er den Sinn des Lebens eben in der Sinnlosigkeit gefunden habe… Dieser Kniff war gemeint. Aber zugegeben, den beherrschen nicht nur Pfaffen, sondern auch moderne Zeitgenossen.
Kommentatorin Jana war übrigens in diesem Zusammenhang auf die Ausbildungssituation von Psychotherapeuten, auf die Rolle der Psychoanalyse in der Psychologen-Zunft etc. zu sprechen gekommen. Damit sind weiter gehende Fragen angerissen, die so nicht im Fokus der Auseinandersetzung standen und hier auch nicht behandelt werden können. Dazu aber abschließend ein konstruktiver Vorschlag: IVA wird am 8. September 2016 im Kölner Bürgerzentrum Alte Feuerwache eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit einem Fachmann zum Thema „Behinderung im Kapitalismus und das Leitbild der Inklusion“ durchführen (siehe auf der IVA-Website unter „Veranstaltungen“, Interessenten können sich unter „Kontakt“ melden). Bei der Veranstaltung wird es zwar nicht unmittelbar um Psychologie und Psychotherapie gehen, aber um die Organisation einschlägiger Betreuungsmaßnahmen, was ja auch psychologische Aspekte einschließt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll die sozialstaatliche Regelung solcher Maßnahmen stehen, die für die betreuenden, therapeutischen u.a. Angebote den offiziellen Rahmen festlegt. Mit dem staatlichen Auftrag an die „helfenden Berufe“ ist nämlich schon Wesentliches darüber gesagt, was sie zu leisten haben – lange bevor wissenschaftliche Schulen sich über die Ausgestaltung einschlägiger Angebote Gedanken machen und ihre theoretischen Konzepte voneinander abgrenzen. Falls sich ein Kreis von Interessenten findet, könnte dies mit weiteren Veranstaltungen, etwa zu konkreten Fragen der Psychologie/Psychotherapie, fortgesetzt werden.
Literatur
- Meinhard Creydt, Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler – Interessenpolitik, Autonomie und linke Denkfallen. Hamburg 2015.
- IVA-Redaktion, Zur Kritik der Psychologie. In: IVA-Blog, http://www.i-v-a.net/index.php/blog, 2. April 2016a.
- IVA-Redaktion, Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus. In: IVA-Blog, http://www.i-v-a.net/index.php/blog, 13. Juni 2016b.
- Albert Krölls, Der Wille in Psychologie, Hirnforschung und Recht. Vortrag 2014. In: www.youtube.com/watch?v=WutDl26UkUA.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- Johannes Schillo, Creydt kritisiert Krölls? In: IVA-Blog, http://www.i-v-a.net/index.php/blog, 11. April 2016.
- Neg. Sohdorf, Sinn und Sittlichkeit. In: IVA-Blog, http://www.i-v-a.net/index.php/blog, 29. Juni 2016.
- Norbert Wohlfahrt, Rezension zu: Krölls, Kritik der Psychologie. In: Socialnet, https://www.socialnet.de/rezensionen/20727.php, 3. Juni 2016.
- Michael Zander, Unhaltbare Polemik – Neuauflage von Albert Krölls’ „Kritik der Psychologie“ im VSA-Verlag erschienen. In: Junge Welt, 6. Juni 2016.
Betrifft: Amoklauf
Seit den jüngsten Gewalttaten von Nizza, Würzburg oder München schwankt die Öffentlichkeit zwischen Terror-Panikattacken und der Beruhigung, dass es sich möglicher Weise „bloß“ um Amokläufe handelt. Dazu Literaturhinweise der IVA-Redaktion.
„Es gibt Sachverhalte, die werden durch die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion mit falschen Erklärungen, mit Mutmaßungen, Ideologien und moralischen Ergüssen dermaßen zugeschüttet, dass ihr Kern erst mühsam freigelegt werden muss, bevor überhaupt mit einer gescheiten Erklärung begonnen werden kann.“ Das schrieb Freerk Huisken 2002 zum Thema „Jugendgewalt“, nachdem kurz zuvor der Amoklauf eines Schülers in einem Erfurter Gymnasium mehr Menschen als bisher bei vergleichbaren Anschlägen das Leben gekostet hatte (Huisken 2002, 8). Bei diesem Fall habe man es mit einem solchen Sachverhalt zu tun. „In der Regel wird er durch die öffentliche Debatte so vollständig verrätselt, dass er kaum noch zu erkennen ist. Ohne den Sachverhalt selber genauer unter die Lupe genommen zu haben, werden erst einmal die üblichen Verdächtigungen aufgefahren: Die Gewaltvideos und Computerspiele werden problematisiert, eine gestörte Persönlichkeit diagnostiziert, das Aggressionspotenzial im Menschen angeführt usw.“ (ebd.).
All das ist jetzt nach den Münchner Ereignissen wieder da, nachdem die dortige Staatsanwaltschaft den 18-jährigen Schützen als „klassischen Amoktäter“ eingestuft hat. „In der Wohnung des jungen Mannes wurde nach Aussage de Maizières Material gefunden, das Verbindungen zum Amoklauf von Winnenden 2009 und zum Massenmord des Norwegers Anders Behring Breivik vor genau fünf Jahren vermuten lasse.“ (www.tagesschau.de, 23.7.2016) Und der Bundesinnenminister gibt Computerspielen mit Gewaltdarstellungen eine Mitschuld an der Tat, wie man es aus den Debatten über Jugendgewalt seit den 1990er Jahren kennt (vgl. Pfeiffer/Wetzels 1999). „Zurück in die Nullerjahre: De Maizière reanimiert Killerspiel-Debatte“ kommentierte die SZ (www.sueddeutsche.de, 23.7.2016): „Damit schwelt schlagartig wieder eine Debatte, die seit langem als beendet galt. Klar sei, dass das ‚unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung von Jugendlichen hat. Das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten‘, sagte de Maizière. Er implizierte damit: Der mutmaßliche Täter David S. habe sich von solchen Spielen inspirieren lassen.“
Und so blicken wir wieder, wie das Heute-Journal am 23. Juli 2016 meldete, in „die Abgründe der menschlichen Seele“. Es wird mitgeteilt, dass der 18-Jährige – „ein Opfertyp“, wie eine Schulkameradin erklärte – „in psychiatrischer Behandlung“ gewesen sei und dass die Beamten bei der Durchsuchung seines Zimmers „viele Unterlagen“ zum Thema Amoklauf gefunden hätten, darunter auch das Buch von Peter Langman „Amok im Kopf“ (2009), dessen Cover im Bild gezeigt wird. Der psychisch kranke Täter habe die Tat minutiös geplant, sich z.B. ein spezielles Facebook-Profil zugelegt, um potenzielle jugendliche Opfer anzulocken. Zwar wird in der ZDF-Nachrichtensendung ein Fachmann, Dr. Jens Hofmann vom Institut Psychologie & Bedrohungsmanagement, interviewt, der den Grund der Tat nicht in einer psychischen Störung sehen will. Aber der allgemeine Tenor der Kommentierung geht in die Richtung, dass hier ein geistig gestörter, wahrscheinlich depressiver Mensch gehandelt hat, möglicher Weise durch andere Wahnsinnige infiziert und durch diverse Risikofaktoren in seinem Krankheitsverlauf belastet. „Der Wahnsinn der Mörder ist ansteckend“, kommentiert die FAZ (www.faz-net, 23.7.2016): „Seit Werther und seinen Jüngern weiß man, dass Todeslust ansteckend ist.“ Wahnsinn, Mordlust, Todeslust, „Tötungslust“ (Theweleit 2015) – ist dann der Weisheit letzter Schluss. „Fest steht: Ali David Sonboly litt an Angstzuständen und Depressionen, befand sich 2015 zwei Monate lang stationär in einem Krankenhaus in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung.“ (www.bild.de, 25.7.2016)
Wie die Tat des Münchner Jugendlichen im Einzelnen zu erklären ist und welche Rolle sie in der öffentlichen Debatte spielt, ist hier nicht Thema. Es geht im Folgenden nur darum, die von Huisken kenntlich gemachte Tour der Verrätselung näher unter die Lupe zu nehmen und einige Hinweise auf Vorkommnisse der letzten Jahre sowie auf einschlägige Erklärungsbemühungen zu geben. Denn auch wenn die jetzigen Verbindungen mit Terrorgefahr, Islamismus und (deutscher) Flüchtlingspolitik neu sind, ist der grundlegende Sachverhalt der Tötung „Unschuldiger“ alles andere als ein „unfassbares“ Ereignis, das aufs Konto verirrter Einzeltäter ginge und das man aus der Normalität des bürgerlichen Konkurrenzbetriebs auszugrenzen habe.
Unfassbar? Unerklärbar?
Gerade das Buch des US-amerikanischen Psychiaters Langman – dessen sich der Münchner Täter kurioser Weise als Anleitung bedient haben soll – stellte nach diversen Aufklärungsleistungen über das schulische Gewaltproblem einen Rückschritt zur ‚Unfassbarkeits‘- und ‚Unerklärlichkeits‘-Pose dar. Diese Pose ist in der Öffentlichkeit bei den einschlägigen Gewalttaten üblich, sie gipfelt nach der Benennung der „Risikofaktoren“ Computerspiele, Gewaltvideos und Waffenliebhaberei in der fragwürdigen Erkenntnis, dass man es bei den betreffenden Jugendlichen mit „kranken Hirnen“ zu tun hat. Von einem Fachmann aus dem Land, das bei Amokläufen lange führend war, wurde es mit dem Buch amtlich gemacht: Die Täter sind Psychopathen, speziell zerfallen sie in die drei Krankheitsgruppen psychopathisch, psychotisch und traumatisch kranker Jugendlicher. Diese Psychopathologisierung des Problems ist im Grunde ein Analyseverbot, denn sie will den Blick von den betreffenden Institutionen ab- und auf den Einzelfall hinlenken (der Autor hatte zehn Fälle aus den USA untersucht). Dabei negiert sie die Tatsache, dass es sich beim „School Shooting“ inzwischen – Sympathisanten, Trittbrettfahrer und Nachahmer eingerechnet – um ein Dauerphänomen handelt und dass es, wie die verschiedenen Fälle aus Europa oder den USA zeigen, nicht auf das Schema vom ausrastenden computerspielsüchtigen männlichen Waffennarren reduziert werden kann. Speziell lenkt eine solche Diagnose von dem nahe liegenden Zusammenhang ab, der zwischen der Normalität der Leistungs- und Anerkennungskonkurrenz am modernen „Arbeitsplatz Schule“ mit seinen tausendfach belegten krankmachenden Wirkungen und dem abweichenden Verhalten von Jugendlichen besteht, die die breit geteilten Rachephantasien bis zu einer blutigen Ehrenrettung ihrer Persönlichkeit und einer letalen Gesamtabrechnung ihrer Konkurrenzbilanz treiben.
Huisken hat in zahlreichen Publikationen seit den 1990er Jahren eine solche Verbindung zum Arbeitsplatz Schule und zu den sonstigen Konkurrenzbemühungen Jugendlicher wie (junger) Erwachsener untersucht (vgl. das Literaturverzeichnis), und auch von anderen Schulkritikern wie Götz Eisenberg (2010) oder Hans-Peter Waldrich (2007) sind Analysen dazu beigesteuert worden. Dem steht als Haupteinwand die Berufung auf den Befund einer kranken Persönlichkeit entgegen, wobei es Varianten gibt. Klaus Theweleit (2015) z.B. spricht – im Blick auf den Breivik-Tätertypus und ähnliche, öffentlich agierende Selbstmordkommandos – von Menschen mit „fragmentiertem Körper“, die im Akt der Tötung eine „Selbstverlebendigung“, eine Ganzheitserfahrung ihrer beschädigten Persönlichkeit erleben. Ihre Urteile über die Welt, der sie massiv zuleibe rücken, brauche man nicht ernst zu nehmen, sie seien austauschbar (mal Religion, mal Nation…), „Ideologie ist Schnickschnack“ (Theweleit, zit. nach Mohr 2015). Dass sich ein solcher Tätertypus ausbildet, könne zwar etwas mit dem herrschenden gesellschaftlichen Zustand, möglicher Weise mit „sozialer Depravation“, zu tun haben; aber der Kern des Problems sei die ungefestigte Persönlichkeit. Auf diese Weise gelangt man am Schluss wieder zu dem herrschenden Konsens, dass es viele Risikofaktoren gibt, die eine psychische Störung hervorzurufen vermögen.
Man landet also beim deterministischen Paradigma, das die auf den Seelenapparat einwirkenden Kräfte zum ausschlaggebenden Punkt macht. Albert Krölls hat sich dieses Paradigma, wie auf dem IVA-Blog schon mehrfach thematisiert, in seiner „Kritik der Psychologie“ vorgenommen (vgl. Krölls 2016). Er liefert dazu eine ausführliche Kritik und bringt als Exkurs auch eine Erklärung ausländerfeindlicher Gewalttaten, die radikalisierte Nationalisten verüben. Solche Taten sind natürlich keine Amokläufe, auch wenn die Täter in einzelnen Fällen – wie beim Breivik-Attentat in Norwegen oder der Messerattacke auf die ausländerfreundliche Kandidatin der Kölner OB-Wahl im Herbst 2015 – mit einer gewissen Selbstaufopferung kalkulieren. Krölls macht deutlich, dass diese Taten zustande kommen, weil sich die Akteure politisch „ins Recht gesetzt“ (Krölls 2016, 146) fühlen. Ein Rechtsbewusstsein, das für sich die Verfügung über die Existenz von Mitmenschen beansprucht, zeigt sich ja offenkundig in solchen Taten. Der Ausländerfeind bekennt sich dazu explizit, wenn er unter Berufung auf höhere Werte die Islamisierung des Abendlands oder den Volkstod in Deutschland abwehren will. Ein Amokläufer, der nicht wie ein geistig Umnachteter durch die Gegend taumelt, sondern nach (oft minutiöser) Vorbereitung und Planung gezielt auf Mitschüler, Lehrer oder Kollegen schießt, bringt ein solches Rechtsbewusstsein mit seiner Tat ebenfalls zum Ausdruck. Insofern ist man nicht unbedingt auf seine Selbstauskunft angewiesen; die Tat selber hat einen Gehalt und offenbart eine Zwecksetzung.
Ein zentrales Argument beim Psychiatrisieren und Ausgrenzen der Tat aus dem Normalzusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft zielt dagegen auf die Unmöglichkeit, dem einzelnen Täter und seiner – durch ganz individuelle Momente bestimmten Tat – gerecht zu werden. Kay Sokolowsky z.B. hat sich anlässlich eines der letzten größeren US-Amokläufe gegen „dummschwätzende Schlaumeier“ gewandt, die „jeder Lüge aufsitzen bzw. selber lügen, nur um der unerträglichen Wahrheit auszuweichen, die in jedem Amoklauf steckt“ (Sokolowsky 2012b), dass er nämlich die „Negation jeder Ratio“ (Sokolowsky 2012a) ist. Die Polemik richtete sich hier vor allem gegen literarische Aufbereitungen, wie sie Ines Geipel zum Erfurter Schul-Amoklauf vorgelegt hatte (Geipel 2003) – und hat insofern eine gewisse Berechtigung. Denn der Versuch, sich in die Innenperspektive des Täters zu versetzen, ist kein analytisches Unterfangen. Hier wird vielmehr die Phantasie mobilisiert und eventuell das morbide Bedürfnis bedient, sich in „menschliche Abgründe“ zu vertiefen. Den ganz individuellen Werdegang eines solchen Täters nachzuvollziehen ist – theoretisch betrachtet – eine müßige Angelegenheit. Ein solches Bemühen gibt es praktisch als Standpunkt der Sicherheitskräfte, die wissen wollen, wann wer genau den Übergang vom Drohen oder (An-)Klagen zur Tat macht. Dazu erstellen Kriminologen „Leaking-Listen“, die die Kripo dann in Zusammenarbeit mit Lehrern, Eltern, Psychotherapeuten abarbeitet: Anhand welcher „Leaks“ lässt sich erkennen, ob Äußerungen eines Schülers eine Tatbereitschaft signalisieren? Ist der Punkt schon erreicht, wo man einschreiten muss? Etc.
So stellt sich die Praxis sehr verständnisvoll auf die Gefahr ein, begutachtet also die Normalverhältnisse, um mögliche Übergänge zu identifizieren. Die offizielle Beurteilung ändert das nicht. Wie beim Breivik-Fall durchexerziert ist sogar die Justiz gelegentlich daran interessiert, einen Täter, der sich ausführlich zur Rationalität seiner Tat bekennt, ja sie mit einer eigenen Schrift zur Bedeutung seines abendländischen Kreuzrittertums begründet, als Psychopathen einzustufen (vgl. Decker 2011, 2012). Im Prozess um den Kölner Attentäter Frank S. entschied sich die Justiz letztendlich dafür, das „fremdenfeindliche Tatmotiv“ anzuerkennen, und verurteilte den Täter zu 14 Jahren Gefängnis. Und das, obwohl auch hier der Befund der Geisteskrankheit ins Spiel gebracht worden war. „Der psychiatrische Gerichtsgutachter Norbert Leygraf stellte bei S. eine ‚paranoid-narzisstische Persönlichkeitsstörung‘ fest, gleichwohl sei er voll schuldfähig. Frank S. widersprach. Er sei ‚bei bester Gesundheit‘ und ‚bei klarem Verstand‘“ (www.spiegel.de, 1.7.2016). Interessant ist auch, dass die Richterin gewissermaßen die Berufung des Täters auf höhere Werte – wie sie oben bei der Analyse von Krölls zur Sprache kam – anerkannte: „Anders als die Bundesanwaltschaft sah das Gericht in dem Mordversuch … keine niedrigen Beweggründe. Der Angeklagte habe dabei keine egoistischen Motive wie Habgier und Mordlust verfolgt.“ (www.sueddeutsche.de, 1.7.2016)
Seinerzeit, beim ersten großen Schul-Amoklauf in Erfurt, hatte der Bundespräsident richtiggehend die Losung der Unerklärbarkeit ausgegeben. Dazu hieß es in einem Gegenstandpunkt-Artikel: „Auf den Amoklauf von Erfurt reagiert Deutschland prompt und unisono mit dem Ausdruck des Entsetzens, ‚unfassbar‘, ‚unerklärlich‘. Bundespräsident Rau, oberster Interpret des politisch Korrekten, spricht dasselbe als Vorschrift und Erklärungsverbot aus.“ (Held 2002, 41) Rau wörtlich: „Wir sind ratlos. Wir haben nicht für möglich gehalten, dass so etwas bei uns geschieht. Wir sollten unsere Ratlosigkeit nicht zu überspielen versuchen mit scheinbar nahe liegenden Erklärungen. Wir sollten uns eingestehen: Wir verstehen diese Tat nicht.“ (Zit.: ebd.) „Das ist freilich eine dicke Lüge“, fuhr der GS-Artikel fort. „Die bürgerliche Welt versteht diese Tat ganz ausgezeichnet, wie übrigens jeden Mord. Wie sonst könnten Krimis verstanden und genossen werden, wie könnte der Zuschauer mit dem Kommissar um die Entdeckung des Täters wetteifern, wenn er die Motive nicht verstünde, über die sich der Täter verrät. Entgegen der beschworenen Ratlosigkeit sind die Zeitungen voll mit einfühlsamen Erklärungen.“ (Ebd.) Der Artikel geht dann minutiös die Art der öffentlichen Besprechung durch, die in einem ersten Schritt alles nachvollziehbar macht, um es in einem zweiten – hier gerade unter Anleitung von Experten – zu widerrufen. Fazit: „Hundert Faktoren und kein Grund“ (Held 2009, 9).
Die aktuellen Fälle „nach Nizza“ – Würzburg, München, jetzt Ansbach… – sind natürlich mit solchen Hinweisen nicht geklärt. Auch zeigt sich die öffentliche Debatte zur Zeit an anderen Zusammenhängen interessiert, von der Rolle der deutschen Flüchtlingspolitik über verschärfte Internet-Kontrolle bis zum Bundeswehreinsatz im Innern. Doch dürfte klar sein, dass nichts dafür spricht, sich dem interessierten Dogma anzuschließen, die zugrunde liegenden Sachverhalte seien letztlich unerklärbar.
Literatur
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Das Attentat in Norwegen: Ein Blutbad zur Rettung des christlichen Abendlandes. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2011. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2011/3/gs20113c1….
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Schuld und Sühne im Rechtsstaat: Rechtsphilosophische Erörterungen zum Breivik-Prozess in Bild und FAZ. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2012. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2012/3/gs20123c0….
- Götz Eisenberg, Damit mich kein Mensch mehr vergisst – Warum Amok und Gewalt kein Zufall sind. München 2010.
- Ines Geipel, Für heute reicht's – Amok in Erfurt. Berlin 2003.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), 16+1 Leichen in Erfurt – Eine „unbegreifliche Tragödie“ und das Umdenken, das dennoch aus ihr folgt. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2002. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2002/2/gs20022c0….
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Amoklauf in der Schule: Schrittfolge eines fast normalen Wahnsinns – Hundert Faktoren und kein Grund. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2009. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2009/2/gs20092c0….
- Freerk Huisken, Jugendgewalt – Der Kult des Selbstbewusstseins und seine unerwünschten Früchtchen. Hamburg 1996.
- Freerk Huisken, z.B. Erfurt – Was das bürgerliche Bildungs- und Einbildungswesen so alles anrichtet. Hamburg 2002.
- Freerk Huisken, „Ein unauffälliger Schüler mit ganz normalen Mitschülern, in einer ganz normalen Schule in einer völlig normalen deutschen Kleinstadt.“ 2003. Online: www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Freerk Huisken, Über die Unregierbarkeit des Schulvolks – Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten usw. Hamburg 2007 (Neuausgabe für 2016 in Vorbereitung).
- Freerk Huisken, Zum Amoklauf von Winnenden: Die Schule ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. 2009a. Online: www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Freerk Huisken, School shooting (Vortrag). 2009b, online: https://soundcloud.com/arab-2/freerk-huisken-schoo….
- Freerk Huisken, Der Dopppelanschlag von Oslo: „Ist’s Wahnsinn auch, so hat es doch Methode.“ 2011. Online: www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Freerk Huisken, Was hat das Waffenrecht mit Amokläufen zu tun? Ein Schulmassaker in Newtown und schon tobt in den USA eine Debatte über das Recht der Amerikaner auf private Bewaffnung. Gegenrede 26. In: Auswege-Magazin, 2013, online: www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- Peter Langman, Amok im Kopf – Warum Schüler töten. Mit einem Vorwort von Klaus Hurrelmann. Weinheim und Basel 2009.
- Markus Mohr, Wann lacht ein Killer? Über NSU, „fragmentierte Körper“ und Ideologie. Ein Gespräch mit Klaus Theweleit. In: Junge Welt, 11. November 2015.
- Christian Pfeiffer/Peter Wetzels, Zur Struktur und Entwicklung der Jugendgewalt in Deutschland. Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, Hannover 1999.
- Kay Sokolowsky, Rauch über Aurora – Über den Amoklauf als Negation jeder Ratio. In: Konkret, Nr. 9, 2012a.
- Kay Sokolowsky, Spaßmacher und Totmacher. In: http://www.kaysokolowsky.de/tag/konkret/page/2/, 30. August 2012b.
- Klaus Theweleit, Das Lachen der Täter: Breivik u.a. – Psychogramm der Tötungslust. St. Pölten 2015.
- Hans-Peter Waldrich, In blinder Wut – Amoklauf und Schule. Köln 2007.
Nationalismus „im Aufwind“
Ausländerfeindlichkeit und ausgrenzender Nationalismus sind in der „Mitte der Gesellschaft“ angekommen – so lautet ein weit gehend übereinstimmender Befund der Sozialwissenschaften. Dazu ein Kommentar von Johannes Schillo.
„Es ist unbestreitbar: Auch in Deutschland bekommen ‚Rechtspopulismus‘ und Rassismus Aufwind.“ (Huisken 2016b) Seit der Ausrufung der deutschen „Willkommenskultur“ vor rund einem Jahr ist dieser Befund gewissermaßen amtlich und nicht mehr allein eine Diagnose aus der Sozialforschung, die sich traditionell mit extremen nationalen Varianten und neuerdings mit dem Erstarken von PEGIDA, AfD etc. befasst (vgl. Salzborn 2015, Decker u.a. 2016, Häusler/Virchow 2016, Rehberg u.a. 2016). Ja er ist nicht bloß eine verbindliche Sichtweise, sondern geradezu ein Auftrag an alle guten Patrioten, die sich dem ausländerfeindlichen „Dunkeldeutschland“ (Gauck) entgegenstellen sollen – und dies auch von der Bildzeitung über das Bundesjugendministerium bis zu lokalen, parteiübergreifenden Bündnissen gegen rechts tun (vgl. Huisken 2016a, Schadt 2016).
In der Sozialwissenschaft, speziell in den empirisch orientierten Abteilungen, sind Genese und Ausmaß dieses nationalistisch-rassistischen Potenzials seit längerem Diskussionsthema, und die Regierungspolitik hat sich auch schon gelegentlich auf die von Experten gelieferten Alarmmeldungen gestützt, etwa 2000 einen „Aufstand der Anständigen“ (Schröder) ausgerufen. Doch ist der sozialwissenschaftliche Umgang mit dem Thema nicht unumstritten. So hat die jüngste Studie von Oliver Decker u.a. (2016) über die „enthemmte Mitte“ wieder einigen Widerspruch geerntet. Kritiker – darunter die Ex-Familienministerin Kristina Schröder, die seinerzeit mit ihrer Extremismus-Klausel der Bildungsarbeit gegen rechts das Leben schwer machte – warfen den Autoren Alarmismus und Voreingenommenheit vor. „Leipziger Forscher sehen die deutsche Gesellschaft alle zwei Jahre am Rande des Faschismus“, hieß es z.B. in der FAZ (17.6.2016), die die Erstellung der Fragebögen und die Aufbereitung der Ergebnisse für unseriös erklärte.
Zugleich hat die Sozialforschung ihre eigenen, internen Schwierigkeiten bei der Befassung mit dem Thema Nationalismus. Im Folgenden wird daher ein (Rück-)Blick auf einschlägige Auseinandersetzungen und Probleme geworfen. Dies kann dazu dienen, den aktuellen Schwierigkeiten, die die Sozialwissenschaft mit der Einordnung des neuen, nicht nur auf Deutschland begrenzten „Rechtspopulismus“ hat, auf den Grund zu gehen.
Wie messen?
Das aufwändigste Forschungsprojekt aus dem Bereich Rassismus/Nationalismus war in der letzten Zeit die – durch ein Konsortium unter Federführung der Volkswagen-Stiftung geförderte – Bielefelder Langzeitstudie zu Erscheinungsweisen, Ursachen und Entwicklungen „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF)“ unter Leitung von Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld), die der Öffentlichkeit von 2002 bis 2012 in der Jahrbuch-Reihe „Deutsche Zustände“ ihre Ergebnisse vorstellte (vgl. Heitmeyer 2002-2012). Der Studie lagen jeweils repräsentative Erhebungen zugrunde, für die 2.000 Personen der deutschsprachigen Bevölkerung befragt wurden. Sie zielte auf ein „GMF-Syndrom“, also auf eine Reihe von Tatbeständen, die in lockerer Form miteinander zusammenhängen sollten, und ließ sich dies durch die Befragungen empirisch bestätigen. Dabei wurde – bemerkenswerter Weise – nicht eigens nach Nationalismus gefragt, dafür aber unter verschiedenen Rubriken nach Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit (zunächst unter dem Titel „Islamophobie) sowie nach der Abwertung bestimmter Volksteile (Behinderte etc.). Schon in Folge 3 registrierten die Forscher die Zunahme der Fremdenfeindlichkeit, die sich zu einer Mehrheitsmeinung entwickelt habe (60 Prozent waren der Auffassung, dass zu viele Ausländer in Deutschland leben…); dabei zeigte sich auch, „daß der Gesamtanstieg der Fremdenfeindlichkeit insbesondere auf Personen zurückzuführen ist, die sich selber der politischen Mitte zuordnen“. (Heitmeyer 2005, 18f)
2012 zog die Projektleitung für den gesamten Untersuchungszeitraum Bilanz und berichtete zusammenfassend über die Entwicklung menschenfeindlicher Einstellungen. Auch hier wurde bestätigt, dass sich eine mehrheitsfähige Volksstimmung zur Ausgrenzung von Ausländern herausgebildet habe. „Die Gesellschaft ist vergiftet“, resümierte Heitmeyer die Projektergebnisse in einem Interview (Der Spiegel, Nr. 50, 2011); „nur wer etwas leistet, wer nützlich ist, wer effizient ist, zählt etwas.“ Die weit reichende Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas zeige sich etwa daran, dass rechte Terroristen wie das Zwickauer NSU-Trio „ihre Legitimation zur Gewalt aus einem Vorrat an menschenfeindlichen Einstellungen in der Bevölkerung“ schöpfen können (ebd.). In seinem Überblick zum letzten Band Nr. 10 hielt Heitmeyer fest, „dass das zurückliegende Jahrzehnt von Entsicherung und Richtungslosigkeit im Sinne einer fehlenden sozialen Vision gekennzeichnet ist.“ (Heitmeyer 2012, 19) So finden fast 30 Prozent der befragten Personen, „daß eine Gesellschaft sich Menschen, die wenig nützlich sind, nicht leisten kann.“ (Ebd., 21) Ein anderer Befund besagt, „daß aktuell fast 53 Prozent der Befragten Probleme damit hätten, in eine Gegend zu ziehen, in der viele Muslime leben.“ (Ebd., 20) Heitmeyer sah in Deutschland eine „rohe Bürgerlichkeit“ am Werk, „die sich bei der Beurteilung sozialer Gruppen an den Maßstäben der kapitalistischen Nützlichkeit, der Verwertbarkeit und Effizienz orientiert und somit die Gleichwertigkeit von Menschen sowie ihre psychische wie physische Integrität antastbar macht und dabei zugleich einen Klassenkampf von oben inszeniert.“ (Ebd., 35) Der Grund dafür liege in der Herausbildung eines „autoritären Kapitalismus“, d.h. darin, „daß es einen Kontrollverlust der nationalstaatlichen Politik und einen Kontrollgewinn des Kapitals gegeben“ habe (ebd., 18).
Diese Interpretationen sollen hier nicht weiter Thema sein, es geht vielmehr darum, die spezielle Art der Datenerfassung unter die Lupe zu nehmen. Die Konstruktion des GMF-Syndroms und die Auswertung der Befragung werfen nämlich einige Probleme auf. Das betrifft einmal die theoretische Ebene, etwa die Aufspaltung der rassistischen Grundhaltung in viele Einzelrassismen, also in lauter Fragmente, die dann seltsamer Weise neben der Kategorie Rassismus figurieren und z.B. als staatsbürgerlicher Rassismus („Fremdenfeindlichkeit“ genannt, gefragt wird aber nach der Einstellung gegenüber „Ausländern“) oder Islamfeindlichkeit ein Eigenleben führen, wobei, wie erwähnt, Nationalismus selber gar nicht Thema ist. Die Aufspaltung in radikale nationalistische Varianten führt natürlich zu der Frage, ob und wie die einzelnen Momente des als „Syndrom“ bezeichneten Sammelsuriums zusammenhängen. Zusatzuntersuchungen, die dann später vom Projektteam angestellt wurden, erbrachten die geniale Antwort: „Im Kern des Syndroms steht eine Ideologie der Ungleichwertigkeit“ (ebd., 10, vgl. 16). Also das, was im staatsbürgerlich-rassistischen Standpunkt eingeschlossen ist, dass er nämlich Völker und Volksgruppen nach ihrer Höher- oder Minderwertigkeit sortiert, wird jetzt, wo man ihn in viele Einzelteile zerlegt hat, dank einschlägiger Korrelationsverfahren als das einigende Band wiederentdeckt.
Zum andern führt die Aufbereitung des empirischen Materials zu Deutungsproblemen. Ein Beispiel: Die aus dem rassistischen Weltbild bekannte Ausgrenzung von Volksschädlingen und Kostgängern, die der Volksgemeinschaft zur Last fallen, firmiert im GMF-Syndrom als die Rubrik „Abwertung von behinderten Menschen“ (ebd., 39). Sie weist für die Jahre 2009-2011 (siehe das Item: „Für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben“) eine steigende Tendenz auf (von 5,3 über 6,8 bis zu 7,7 Prozent). Demzufolge nimmt die rassistische Abwertung weniger nützlicher Bevölkerungsteile zu, denn solche Menschen sind es den Befragten anscheinend nicht wert, dass Aufwand für sie getrieben wird. Aber ist das ein Befund, den man festhalten kann? Nicht wirklich, denn zur selben Rubrik gehört auch das Item: „Behinderte erhalten zu viele Vergünstigungen.“ Hier sind die Werte fallend (von 6,5 über 6,2 auf 4,2 Prozent). Also nimmt die Abwertung ab, denn die Missgunst gegenüber dem sozialhilferechtlichen Status Behinderter ist rückläufig. Was hat das alles zu bedeuten? Schwer zu sagen. Man weiß nicht, was sich die Forscher bei dem subtilen Unterschied von Aufwand und Vergünstigung gedacht haben, und noch weniger weiß man, was in den Köpfen der Befragten vorgegangen ist. So hat man zwar viel Zahlenmaterial und eine hohe Genauigkeit bis auf eine Stelle hinterm Komma, aber die Aussagekraft bleibt trotzdem zweifelhaft.
Das Problem der empirischen Forschungspraxis noch einmal von einer anderen Seite her beleuchtet: Was wird eigentlich zur nationalen Einstellung abgefragt? Dazu hat Klaus Ahlheim eine aktuelle Bilanz vorgelegt (Ahlheim 2016). Ahlheim hat selber empirisches Material zu Ausländerfeindlichkeit oder „Nation und Exklusion“ (Ahlheim/Heger 2010) erhoben und sich dabei, anders als Heitmeyer, auf die „Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) gestützt, also kein kompliziertes Syndrom konstruiert. Zusammen mit Bardo Heger legte er auf Basis von ALLBUS 2008 eine Studie vor, die im Prinzip in dieselbe Richtung wie die anderen Erhebungen wies: Für Deutschland ist – parallel zu den von der politischen Klasse (unter Einschluss der PDS) geführten Nationalstolz-Debatten – die Zunahme eines mit Selbstbewusstsein und Aggressivität auftretenden, ausgrenzenden Nationalismus zu verzeichnen. Zentrales Ergebnis der Analyse war auch, dass sich die beliebte Aufspaltung der nationalen Orientierung in ein versöhnliches patriotisches Wir-Gefühl und eine abwertende Haltung gegenüber anderen Nationalitäten empirisch nicht bestätigen lässt: „Die Betonung des Nationalen, die Überbetonung zumal, ist ohne Exklusion, ohne Ausschluss der Anderen, ohne Ausschluss auch der unbequemen Vergangenheit nicht zu haben.“ (Ahlheim/Heger 2010, 112) Mit dem Vergangenheitsaspekt sprachen die Autoren die deutsche Sondersituation an, in der sich, trotz offizieller Bekundung einer singulären nationalen Schuld, eine Schlussstrichmentalität und eine stabile antisemitische Tendenz breit machten. Dabei wiesen sie aber auch darauf hin, ohne dies als entschuldigende Relativierung gelten zu lassen, dass sich Deutschland bestens in einen gesamteuropäischen Trend einfügt, „denn das geeinte Europa ist – paradox genug – ein Europa der Nationalismen.“ (Ebd., 79)
Ahlheim hat diese Forschungen in seiner neuen Publikation noch einmal resümiert (Ahlheim 2016) und festgehalten, dass die nationalistischen Tendenzen in SPD, CDU und CSU ihre Heimat haben; speziell an den Sozialdemokraten Sarrazin und Steinmeier sowie den Christdemokraten Gauck und von der Leyen hat er verdeutlicht, wie die Volksstimmung aktuell betreut und gelenkt wird. Im Großen und Ganzen stimmt er mit den Diagnosen von Heitmeyer oder den „Mitte“-Studien der Universität Leipzig (Oliver Decker u.a.) überein, wobei Decker jetzt wieder in der Mitte der Gesellschaft Differenzierungen nach unterschiedlichen Milieus vornimmt (vgl. dazu Schröder 2016). Diese ebenfalls seit 2002 regelmäßig in einem Zweijahres-Rhythmus erstellten – von der Friedrich-Ebert-Stiftung (bis 2012) sowie der Heinrich-Böll- und Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützten – Studien haben seit der ersten Erhebung erbracht, dass nationalistische Einstellungen in allen Bevölkerungsschichten anzutreffen sind. Die hohen Zustimmungswerte zu ausländerfeindlichen Positionen hätten allerdings kaum Niederschlag in der Wahl rechtsextremer Parteien gefunden. „Sowohl ausländerfeindlich Eingestellte, wie auch manifest Rechtsextreme blieben über die Jahre seit 2002 weiterhin den großen demokratischen Parteien SPD und CDU verbunden“, schreiben Decker und der Psychologe Elmar Brähler in einem Statement zur Auseinandersetzung um die 2016er Studie „Die enthemmte Mitte“ (http://home.uni-leipzig.de/decker/).
Ahlheim hat aber auch Probleme des Forschungsprozesses offen gelegt. Wie er bereits 2005 in einem Aufsatz berichtete, geht nämlich die Gemeinde der Rechtsextremismusforscher mit der Zeit. Seit der im Auftrag des Bundeskanzleramtes erstellten Sinus-Studie von Ende der 1970er Jahre war z.B. das Item ‚Ich bin stolz auf Deutschland‘ fester Bestandteil der Fragebögen. Hieran machte man – in Kombination mit anderen Punkten – fest, ob eine nationalistische Einstellung vorliegt, die dann grundsätzlich dem rechtsradikalen Lager zugeordnet wurde. In dem Maße, wie sich die Zustimmungswerte für dieses Item vor allem seit der „Wende“ erhöhten, wurde den Empirikern ihr Vorgehen aber zweifelhaft. „Inzwischen ist die Frage nach dem Stolz, Deutscher bzw. Deutsche zu sein, aus den Rechtsextremismus-Fragebogen der meisten ForscherInnen verschwunden, es wäre ja auch nicht leicht zu begründen, warum eine Haltung, die von fast drei Vierteln der Bevölkerung geteilt, die regelmäßig von PolitikerInnen bekundet und in den Medien zustimmend kommentiert wird, gleichwohl und immer noch eine extreme sein sollte… In einem Fragebogen, der im März 2001 auf einer ‚Expertenkonferenz‘ entwickelt und der Wissenschaftlergemeinschaft zur weiteren Nutzung empfohlen wurde (vgl. Stöss u.a. 2004), kommt der Stolz aufs Deutschsein jedenfalls nicht mehr vor. Und es kennzeichnet das aktuelle politische Meinungsklima hierzulande, wenn die wissenschaftliche Expertenkommission den Begriff ‚Nationalismus‘ vermeidet und jene Fragen, die eben den nationalistischen Aspekt rechtsextremer Ideologie erfassen sollen, lieber unter dem Oberbegriff ‚Chauvinismus‘ zusammenfasst, um, wie Richard Stöss u.a. berichten, ‚eine klare Grenzziehung zu patriotischen oder nationalen Gesinnungen, die sich nicht gegen Demokratie richten, zu erreichen‘…“ (Ahlheim 2016, 33f).
Auch bei Decker u.a. wird mittlerweile mit der Kategorie „Chauvinismus“ gearbeitet. Alarmierend genug waren freilich laut Ahlheim die Ergebnisse, die Stöss u.a. im April 2003 in einer großen repräsentativen Stichprobe mit dem neuen Fragebogen ermittelten. Hier forderten 41 Prozent der Befragten, wir „sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben“, 44 Prozent teilten die Position, „was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland“ und 45 Prozent meinten, es sollte das „oberste Ziel der deutschen Politik“ sein, „Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht“. Selbst der Begriff der „Volksgemeinschaft“ wirkte demnach kaum abschreckend, sondern traf im Gegenteil bei gut einem Drittel der Deutschen auf Zustimmung: 37 Prozent der Befragten waren davon überzeugt, Deutschland brauche „eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“ (ebd.).
Es ist schon eine elegante Lösung (die allerdings nach Auskünften aus der Forschergemeinde nicht von allen Beteiligten praktiziert wird): Je mehr sich nationalistische Urteile ausbreiten und – auch nach offizieller politischer Ansage – zur Normalität gehören, desto vorsichtiger wird der jeweilige Forscher, wenn er ausgrenzenden, rassistischen Nationalismus bzw., so der neuerdings beliebte Terminus, „Rechtspopulismus“ messen will. Das liegt ganz in der Logik der Extremismusforschung. Verfassungsschutz-Dozent Armin Pfahl-Traughber hat dies jüngst noch einmal deutlich gemacht. Bei einer Übersicht zur Ausbreitung extremer Gesinnung, speziell zu den Erfolgen extremer Parteien in ausgewählten europäischen Ländern, kam er zu einem tendenziell beruhigenden Fazit. Er konstatierte, „dass einige extremistische Parteien einen Demokratisierungsprozess vollzogen“ hätten (Pfahl-Traughber 2015, 152). Die Entwarnung, die mit dem Stichwort „Demokratisierungsprozess“ gegeben wird, ist bemerkenswert. Nicht nur, dass sie ganz disparate Erscheinungen zusammenfasst – z.B. die eher undemokratische Mäßigung eines „linksradikalen“ Bündnisses á la Syriza, das sich zum Exekutor der EU-Forderungen im Land entwickelt –, vor allem aber erscheinen dem Extremismus-Experten der allgemeine Stimmungswandel und der dazu gehörige Vormarsch rechtspopulistischer oder -radikaler Positionen in der Parteienlandschaft, wo sich neofaschistische Formationen wie der französische Front National oder die italienische Alleanza Nationale ordentlich zur Wahl stellen oder Koalitionsbereitschaft zeigen, als Anzeichen der Mäßigung.
Die These von der zu beobachtenden Deradikalisierung, wie sie hier vorgetragen wird, verweist also im Grunde auf ihr Gegenteil: In vielen europäischen Ländern wird Nationalismus, auch in seiner aggressiven, ausländerfeindlichen Form, hof- und koalitionsfähig – und Forscher passen sich dieser Entwicklung an, indem sie Nationalismus erst da identifizieren, wo er sich am Rande des offiziell Zugelassenen, etwa als Mitgliedschaft in einer „Protestpartei“ oder Teilnahme an „Ausschreitungen“, betätigt. Auf solche Punkte sollte man aufmerken und nicht gleich darauf zielen, dass Meinungsumfragen nur von „Kosmodeppen“ alias Demoskopen gemacht und geglaubt würden (Schilling 2016, 10f). Es ist ja nicht so, dass – wie Michael Schilling vermutet – nur Trottel „einem dahergelaufenen Abfrager Antworten geben, mit denen sie sich als die outen, die im aktuellen Diskurs als Rassisten und Nazis gelten“, während die braven Untertanen mit ihrer Meinung hinterm Berg halten. Wie die Studien von Ahlheim und Co. belegen, lässt sich wohl auch nicht behaupten, dass „die antisemitische Mehrheit der Deutschen sich seit Jahren vorsieht, wenn ein Demoskop naht“ (ebd.). Die Demoskopie sieht sich da schon – einerseits – selber vor, dass sie das Volk nicht allzu schlecht macht. Andererseits, wenn nur gezielt genug etwa nach der wachsenden islamischen Gefahr gefragt wird, macht das Volk aus seinem ausländerfeindlichen Herzen keine Mördergrube.
Wie erklären?
Das Problem, das sich hier zeigt, ist nicht Messgenauigkeit oder -zuverlässigkeit, es verweist vielmehr auf die Notwendigkeit, den Tatbestand Nationalismus theoretisch zu klären. Bestünde Klarheit, womit man es zu tun hat, wäre es ein Leichtes, einen zuverlässigen Fragebogen zu erstellen, von dem man nachher weiß, was man damit – zumindest zu diesem Zeitpunkt bezogen auf die jeweiligen Fragestellungen bei dieser speziellen Bevölkerungsgruppe – abgefragt hat. Und das Problem stellt sich heute in einer neuen Form, da ja der Kampf gegen eine ausgrenzende, völkische Nationalideologie in Deutschland zur politischen Chefsache geworden ist, der sich alle Patrioten anschließen sollen. Wie gehabt wird an die Bevölkerung appelliert, im Geiste einer verantwortungsbewussten Nation Stellung zu beziehen gegen rückständige Elemente – gar nicht so sehr für die Flüchtlinge, sondern für das gute Deutschland. Das braucht aber, anders als Ahlheim nahe legt, den Vergangenheitsaspekt, also die NS-Herrschaft, nicht auszuklammern. Oder vielleicht wird ein Schlussstrich gezogen, ohne dass man es ausspricht, etwa nach dem Vorbild des aktuellen Papstbesuchs in Auschwitz: Man behält die Vergangenheit, die „Opfer des Unsagbaren“ (FAZ, 30.7.2016), so im Gedächtnis, dass man keine Worte mehr darüber verlieren muss. Es reicht, dass man des „unfassbaren“ Ereignisses als „singuläres“ deutsches Verbrechen eingedenk bleibt – ja man kann sich sogar noch zu einem weiteren Völkermord aus der deutschen Kolonialvergangenheit bekennen –, und hat damit alles Recht der Welt, anderen, etwa türkischen Völkermördern die Leviten zu lesen und überhaupt auf dem Globus nach dem Rechten zu sehen oder Verantwortung zu übernehmen, dass es nur so kracht…
Ahlheim hatte als Ergebnis seiner Untersuchung 2008 festgehalten, dass nicht nur die These von einem neuen, harmlosen, weltoffenen Nationalismus, der als deutsche Normalität spätestens seit dem Fußballsommer 2006 um sich gegriffen haben soll, haltlos ist. Vielmehr sollte man, so sein Votum, überhaupt die Unterscheidung von Nationalismus und Patriotismus in Zweifel ziehen. Dazu können empirische Befunde Hinweise geben, es zu klären ist aber eine theoretische Angelegenheit. Und da ist leider in der aktuellen Lage weithin Fehlanzeige anzumelden, gerade auch in der Linken. Huisken hat in seinen Thesen zur Podiumsdiskussion mit Andreas Zick in der Universität Bielefeld vom Juni 2016 („Rechtspopulismus und Rassismus im Aufwind?“) diese Fehlanzeige an den Anfang gestellt, dass nämlich Nationalismuskritiker gegenwärtig in der AfD und ihrem Anhang das entscheidende Problem sehen; dort wird jetzt die Gefahr des Nationalismus ausgemacht und nicht in den etablierten Parteien, die dem zu allen möglichen Ausgrenzungen fähigen Nationalstolz eine Heimat geben und weiter geben wollen; und eine Linke schließt sich – mehr oder weniger explizit – dem offiziellen Bekenntnis zum „hellen Deutschland“ an (vgl. KeinOrt 2016), wenn sie nicht wie Sahra Wagenknecht bei der nationalen Volksstimmung Punkte zu machen versucht.
Oder die neue Lage wird sozialwissenschaftlich so aufgenommen, dass im Zuspruch zur AfD ein – fehlgeleiteter, manipulierter, im Kern aber verständlicher – sozialer Protest zum Ausdruck kommen soll. Soziologie-Professor Klaus Dörre hat dazu fünf Thesen vorgestellt, deren erste lautet: „Der neue Rechtspopulismus ist vor allem eine Bewegung gegen die Zumutungen und Zwänge des Marktes.“ (Dörre 2016, 12) Huisken macht dagegen auf die Verwechslung aufmerksam, die dem zu Grunde liegt. Es gebe zwar auch soziale Forderungen bei dieser Partei, aber „was die AfD damit anprangert sind nicht die materiellen Lebensverhältnisse der Bürger. Nichts davon, was sie einklagt, würde denen das Zurechtkommen mit Lohn und Arbeit, mit Mieten und Preisen erleichtern“ (Huisken 2016). Im Gegenteil, diese Partei tritt nicht als soziale, sondern als nationale Alternative an. Sie führt lautstark (An-)Klage darüber, dass die ausgrenzende Gewalt nationaler Souveränität in Deutschland verspielt wird, da die Merkel-Regierung den Deutschen ihr höchstes Gut, die exklusive Zugehörigkeit zu ihrer deutschen Heimat, bestreitet. Alle sozialen Aspekte, die in der Programm-Debatte der Partei herumgeistern, sind davon abgeleitet.
Die Stärkung der nationalen Macht ist das Programm. Es wird aber grundfalsch, wenn man allein AfD, PEGIDA und Co. mit dem „Aufwind“ des Nationalismus identifiziert und ansonsten in der offiziellen welt- und europapolitischen Linie der BRD ein Heilmittel gegen die Gefahr der Renationalisierung sieht. Die Ausgrenzung der AfD aus dem demokratischen Parteienspektrum und die Behauptung, hier hätte man es mit einem faschistischen Aufbruch zu tun, übersieht geflissentlich die Übereinstimmung, die diese Partei bei aller Polemik gegen die „Volksverräterin“ Merkel mit der Großen Koalition und den Oppositionsparteien bis in die Reihen der Linken hinein aufweist. Denn die regierenden Parteien sind sich, wie Huisken schreibt (2016, vgl. dazu grundsätzlich Huisken 2012), mit der AfD „durchaus einig in dem Urteil, dass nichts über nationale Souveränität geht. Die freie, ungestörte Ausübung von Herrschaft gemäß nationaler Interessen ist höchste Leitlinie von Staatsgewalten: Nach innen geht es um die Erzwingung der Anerkennung dieser Staatsinteressen durch das Staatsvolk, also durch diejenigen, die für deren Erfüllung – mehrheitlich als arbeitende Bevölkerung – gerade stehen müssen. Und es kann kein Zweifel daran aufkommen, dass hierzulande über die Jahrzehnte ein uneingeschränkt gültiges Gewaltmonopol errichtet worden ist. Allerdings stößt jede freie Herrschaftsausübung nach außen zwangsläufig auf Grenzen. Jeder Staat hat es da mit Seinesgleichen zu tun und kann nicht einfach auf der Erzwingung nationaler Interessen bestehen: Staatsgewalt stößt auf Staatsgewalt, weswegen das Interesse, fremdes Land und fremde Leute für eigene Interessen einzuspannen, um Konzessionen an die konkurrierende Macht – erst einmal – in Form der Anerkennung fremder Souveränität nicht herum kommt. Die Staatsgewalt sieht sich genötigt, Abstriche am eigenen Interesse in Kauf zu nehmen, wenn der Reichtum fremder Mächte für nationale Anliegen angeeignet werden soll.
Erst auf Basis dieses Konsenses kommt es zum Streit – und die Gemeinsamkeit wird auch durch die Tatsache dokumentiert, dass in den Reihen der Christ- und Sozialdemokraten wie der Grünen dieselbe Differenzen zu Tage treten und allem Anschein nach längst noch nicht ausgestanden sind. „Nach Nizza, Würzburg, München…“ sind alle diese Streitpunkte wieder in verschärfter Form auf dem Tisch. Dabei gilt es zu beachten, dass die genannten Untaten nur in der interessierten Perspektive der Politik ihre Bedeutung für die Flüchtlingspolitik erlangen. Der Streit um die Flüchtlingspolitik braucht nicht auf Anschläge – von wem auch immer verübt – zu warten. Bereits vor der blutigen „Terrorwoche“ im Juli äußerte z.B. eine ehemals entschiedene Vertreterin der deutschen Willkommenskultur, NRW-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft, ihre Erleichterung darüber, „dass zurzeit nur noch wenige Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Natürlich müsse man weiterhin möglichst vielen Menschen helfen, aber andererseits seien die Aufnahmekapazitäten einfach erschöpft gewesen“ (General-Anzeiger, 19.7.2016). Kraft wörtlich: „Wir waren in den Strukturen überfordert… Deshalb bin ich schon froh, dass die Grenzen jetzt erst mal dicht sind.“
Die Differenzen, die die AfD mit den etablierten Parteien hat, beruhen auf anerkannten politischen (und politologischen) Positionen. Soll Deutschland z.B. in der EU weiter seine auf Machtzuwachs hin kalkulierte Beschränkung von Souveränität – Ersetzung des nationalen Geldes durch eine Gemeinschaftswährung, Unterwerfung unter die Geldpolitik der EZB, Mitbestimmung von Brüssel bei Fragen des nationalen Haushalts, Mitgliedschaft in einer NATO, die mit „Säbelrasseln“ (Steinmeier) für Unsicherheit an Deutscheuropas Ostflanke sorgt… – praktizieren? Führt dies zu weiterem Erfolg oder zu Machtverzicht? Wie muss eine Nation, die Globalisierung gestalten will, „nationale Identität“ definieren? Dabei führt sich die AfD eher als rückwärts gewandter Imperialismus auf, der in der Einbindung Deutschlands in die einschlägigen Bündnisse nicht den Aufstieg zur Führungsmacht sehen will, sondern den verhängnisvollen Verzicht auf die Bewahrung all dessen, was das „gute alte Deutschland“ einst ausgezeichnet haben soll – dass es nämlich exklusiv nur den Deutschen gehörte. Wer erst in diesem „Rechtspopulismus“ Nationalismus entdeckt, hat das Entscheidende verpasst.
Literatur
- Klaus Ahlheim, Das Ausmaß ist auch eine Frage der Messung – Eine Glosse aus Anlass neuerer Erhebungen zum Rechtsextremismus. In: Praxis Politische Bildung, Nr. 4, 2005, S. 275–278.
- Klaus Ahlheim/Bardo Heger, Nation und Exklusion – Der Stolz der Deutschen und seine Nebenwirkungen. Schwalbach/Ts. 2010.
- Klaus Ahlheim, Kritik der Nation und politische Bildung. In: Horst Adam (Hrsg.), Kritische Pädagogik. Fragen – Versuch von Antworten. Band 3, Berlin 2016, S. 29-48.
- Oliver Decker/Johannes Kiess/Elmar Brähler (Hrsg.), Die enthemmte Mitte – Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland. Gießen, 2. Aufl. 2016.
- Klaus Dörre, Fremde – Feinde. Der neue Rechtspopulismus deutet die soziale Frage in einen Verteilungskampf um. Thesen über Pegida, AfD und darüber, wie der wachsende Zuspruch für sie zustande kommt. In: Junge Welt, 27.6.2016, S. 12-13.
- Alexander Häusler/Fabian Virchow (Hrsg.), Neue soziale Bewegung von rechts? Zukunftsängste – Abstieg der Mitte – Ressentiments. Eine Flugschrift. Hamburg 2016.
- Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustände – Folge 1 - 10. Frankfurt/M. und Berlin 2002-2012.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012.
- Freerk Huisken, Abgehauen – Eingelagert aufgefischt durchsortiert abgewehrt eingebaut. Neue deutsche Flüchtlingspolitik. Eine Flugschrift. Hamburg 2016a.
- Freerk Huisken, Thesen zur Veranstaltung: Rechtspopulismus und Rassismus im Aufwind? Deutsche Zustände im Kontext der „Flüchtlingskrise“. Überarbeitetes Thesenpapier für die Podiumsdiskussion mit Prof. A. Zick in Bielefeld vom 1. 6. 2016b, online: http://www.fhuisken.de/ThesenAfD_d.pdf. (Ein Mitschnitt der Veranstaltung findet sich unter: https://soundcloud.com/asta-bielefeld/rechtspopuli….)
- KeinOrt, Die Linke beschwert sich über den AfD-Erfolg: Dürfen Arbeiter und Arbeitslose AfD wählen? Online: KeinOrt – Kommentare aus dem Niemandsland, 26. 7. 2016, http://keinort.de/.
- Armin Pfahl-Traughber, Die Gefahr des Extremismus durch links- und rechtsextremistische Parteien – Darstellungen und Einschätzungen zur Entwicklung in Europa. In: Eckhard Jesse (Hrsg.), Wie gefährlich ist Extremismus? Gefahren durch Extremismus, Gefahren im Umgang mit Extremismus. Zeitschrift für Politikwissenschaft, Sonderband, Baden-Baden 2015, S. 137-160.
- Karl-Siegbert Rehberg/Franziska Kunz/Tino Schlinzig (Hrsg.), PEGIDA – Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Analysen im Überblick. Bielefeld 2016 (erscheint zum September).
- Samuel Salzborn, Rechtsextremismus – Erscheinungsformen und Erklärungsansätze. 2., akt. u. erw. Auflage, Baden-Baden 2015.
- Peter Schadt, „Abgehauen… Neue deutsche Flüchtlingspolitik“ – Ein Interview mit Freerk Huisken zu seinem neuen Buch und zur derzeitigen Flüchtlingspolitik. In: Auswege-Magazin, 5. 4. 2016, online: http://www.magazin-auswege.de/2016/04/abgehauen-ne….
- Ralf Schröder, Heim und Suchung – Bedrohtes Volk: Eine Studie dokumentiert, wie der autoritäre Charakter Deutschland wieder heilmachen will. In: Konkret, Nr. 8, 2016, S. 16-18.
- Michael Schilling, Kosmodeppen. In: Konkret, Nr. 8, 2016, S. 10-11.
- Richard Stöss/Michael Fichter/Joachim Kreis/Bodo Zeuner, Projekt „Gewerkschaften und Rechtsextremismus“, Abschlussbericht. Berlin 2004.
Juni 2016
Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus
Anfang Juni 2016 ist im Gegenstandpunkt-Verlag das Buch „Gesundheit – ein Gut und sein Preis“ von Sabine Predehl und Rolf Röhrig erschienen (siehe IVA-Startseite). Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
Am 7. Juni 2016 ist im Gegenstandpunkt-Verlag (Homepage: http://www.gegenstandpunkt.com/) das Buch „Gesundheit – ein Gut und sein Preis“ von Sabine Predehl und Rolf Röhrig erschienen. Das Buch befasst sich mit medizinischer Wissenschaft und Praxis, mit der staatlichen Gesundheitsversorgung, mit dem Krankengut und mit dem Geschäft, das sich im Kapitalismus der Fragen von Gesundheit und Krankheit annimmt. Geboten wird so eine systematische Abhandlung der modernen kapitalistischen Realität im Blick auf Gesundheitsverbrauch und Krankheitsbekämpfung. Dies geschieht in Fortführung grundsätzlicher wie aktuell fallbezogener Beiträge, die in der Zeitschrift Gegenstandpunkt erschienen sind (vgl. Held 1994, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, Decker 2012).
Im Vorwort des Buchs heißt es: „Wer heutzutage krank ist, der ist nicht mehr einem kaum beherrschten und noch weniger begriffenen Naturprozess ausgeliefert. Theoretisch ist schon ganz gut erforscht und wird mit großem Aufwand und einigem Erfolg weiter erforscht, was da abläuft im geschädigten Organismus. Und in der Praxis ist, in den meisten Ländern jedenfalls, die Versorgung von Kranken ziemlich flächendeckend organisiert. Der Staat kümmert sich um beides, um die medizinische Wissenschaft wie um ein effektives Gesundheitswesen.“ (Predehl/Röhrig 2016, 3) Den Fortschritten der Naturbeherrschung korrespondiert aber – als scheinbares Paradoxon – ein Fortschritt bei menschlicher Gebrechlichkeit, bei Volksseuchen und Zivilisationskrankheiten. „Vieles, was in früheren Zeiten 'die Natur' – und da auch schon nicht bloß die, sondern mitentscheidend die Natur ihrer gesellschaftlichen Beziehungen – den Menschen in Sachen Krankheit, Seuchen und Siechtum angetan hat, hat die moderne Medizin zurückgedrängt. In den Zentren des gesellschaftlichen Fortschritts hat sie es dafür umso mehr mit den direkten und indirekten Konsequenzen einer gar nicht naturwüchsigen Beanspruchung der menschlichen Naturausstattung zu tun.“ (Ebd., 3f)
Demgemäß beginnt das in drei Teile gegliederte Buch mit den „modernen Volksseuchen“, also den Zivilisationskrankheiten, die als unvermeidliche Nebenwirkung des gesellschaftlichen Fortschritts gelten. Der erste Teil behandelt zunächst die relevanten Krankheitsbilder der Gegenwart (Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs, Allergien, Muskel- und Skeletterkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, psychische und psychosomatische Störungen…) und ihren „Grund: die moderne Klassengesellschaft“ – aufgeschlüsselt nach den Krankheitsursachen Lohnarbeit, Rentabilität des deutschen Wirtschaftsstandorts, Konkurrenz, Freizeit sowie der Krankheitsursache „Drittwelt“-Armut. „Belastungen, Strategien des Aushaltens und erst recht die daraus resultierenden Krankheiten treten allemal auf in Form von – mehr oder minder schweren – Einzelschicksalen“, heißt es dazu (ebd., 15). Der allgemeine Charakter, die gar nicht individuelle, vereinzelte Notwendigkeit dieser Schicksale, sei natürlich bekannt. „Für den bürgerlichen Verstand und seinen medizinischen Forschungsdrang ist das alles jedoch das Allerunwesentlichste. Denn Kritik ist unpraktisch, hilft innerhalb der kritisierten Verhältnisse nicht weiter und macht schon gar niemanden wieder gesund, den die Klassengesellschaft kaputtgemacht hat.“ (Ebd., 28)
Der zweite Teil widmet sich den „großartigen Leistungen des Medizinbetriebs“. Es geht im ersten Schritt um die „theoretischen Glanzleistungen“ der medizinischen Wissenschaft – was nicht ironisch gemeint ist, wie man, angesichts des verbreiteten Misstrauens gegenüber der „Schulmedizin“, betonen muss. Der Grundfehler, den die Medizin macht, liegt nämlich nicht, so der Nachweis, in einer Unzulänglichkeit ihres Forschungsprozesses begründet, sondern in der systembedingten Ignoranz gegenüber den gesellschaftlichen Krankheitsursachen – Ursachen, die sie gleichwohl kennt und in ihrer Praxis gegenüber dem Patienten auch in entsprechende Ratschläge übersetzt. Diese zwiespältige Leistungsbilanz wird in einem Exkurs an den drei Bereichen Infektionskrankheiten, Arbeitsmedizin und Expertenratschlägen für eine etwas medizingerechtere Welt noch einmal verdeutlicht. Weitere Abschnitte widmen sich den Erkenntnissen der Psychiatrie und Psychotherapie sowie der zweifelhaften „Weisheit der Alternativ-Medizin“. Im zweiten Schritt werden dann die praktischen Hilfeleistungen des Medizinbetriebs zum Thema – von der medizinischen Grundversorgung über die Betreuung seelischer Leiden bis zu „Kneipp & Co“. Abschließend gibt es ein Resümee zum „Staatsziel Volksgesundheit“. Es hält fest, dass die modernen Sozialstaaten den Medizinbetrieb zielstrebig so eingerichtet haben, wie er heute existiert, nämlich „als eine Welt für sich, die, professionell gleichgültig gegen Gründe und Zwecke der erbrachten Dienstleistungen, das kranke Individuum als Fall behandelt. Die Abstraktion vom Inhalt der kapitalistischen Konkurrenz und der privaten Existenzkämpfe, die die Gesundheit der Leute strapazieren und ruinieren und für die sie wieder fit gemacht werden wollen und sollen, ist Standpunkt der Medizin, weil er von Staats wegen institutionalisiert ist. Ohne Ansehen der Person, also – richtiger – ausschließlich mit Blick auf das individuelle Leiden soll therapiert werden; Krankheit und Gesundheit sollen den Charakter der Privatsache selbstverantwortlicher Privatpersonen annehmen und so behandelt bzw. wiederhergestellt werden.“ (Ebd., 74f)
Der dritte Teil trägt die Überschrift „Gesundheit als Ware“. Hier werden zwei Punkte abgehandelt, erstens die „vom Patienten getrennte Zahlungsfähigkeit als sichere Basis für das sozialpolitisch gewollte und kontrollierte Geschäft mit der Krankheit“ (ebd., 79ff) und zweitens das medizinische Geschäftsleben als „eine harmonische Einheit von Helfen und Kasse-Machen“ (ebd., 83ff). Schlusspunkt ist die Würdigung der Pharma- und Medizintechnik-Industrie, bevor ein kurzes Postskriptum die Figur ins Visier nimmt, die natürlich stets im Mittelpunkt des gesamten demokratischen Gesundheitswesens steht: den Patienten. „Für sein kompensatorisches Interesse an Gesundheit“, heißt es da, „hat er das freie Geschäftsinteresse der Ärzte, der Krankenhausbetreiber und der sonstigen Gesundheitsindustrie auf seiner Seite.“ (Ebd., 93) Als abhängige Variable des modernen Gesundheitssystems komme er zu seinem Recht, das z.B. – wenigstens im Prinzip – die freie Arztwahl einschließt. Und auf den Einzelnen kommt ja bei der Prävention die öffentlich wie privat gestellte Frage nach den Krankheitsursachen zielstrebig zurück. „Denn eins ist sicher: Kein Exemplar dieser Gattung lebt so, dass es nicht noch gesünder leben könnte. Das soll jeder als Anspruch verstehen, seine Vergnügungssucht bremsen, seine Gesundheitsparameter 'tracken' und sich um seine Fitness kümmern. So bleibt er, ein jeder an seinem Platz und mit seiner Portion Verschleiß, der konstruktiv an sich arbeitende nützliche Idiot der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft.“ (Ebd.)
Das Buch will also nicht – das muss man vielleicht eigens vermerken – alternative Möglichkeiten aufweisen, wie man sich jenseits des herrschenden Betriebs und seiner Verlängerung in allgemein verbreitete Fitness- oder Wellness-Programme um die eigene Gesundheit kümmern kann. Es gehört definitiv nicht zur Ratgeber-Literatur, die den Buchmarkt überschwemmt. Es will aber auch nicht einen heute anzutreffenden Gesundheitswahn zum Skandal machen, der sich, so der Tenor kritischer Analysen, aus einer neuen „Biomoral“ speist: „Biomoralität ist die moralische Aufforderung, glücklich und gesund zu sein.“ (Cederström/Spicer 2016, 12). In einer solchen Perspektive wird Gesundheit selber zu einem ideologischen Imperativ. „'Die Dicken, die Schlaffen und die Verzweifelten sind ungesund', schreibt Jonathan M. Metzl in Anti-Körper, 'nicht wegen einer Krankheit oder eines Gebrechens, sondern weil sie sich weigern, die glänzenden Insignien der Gesundheit anderer zu tragen, zu fetischisieren oder danach zu streben'.“ (Ebd., 10) Das Streben nach Gesundheit ist im Kapitalismus zwar nicht mehr allein Sache des Individuums, da hier der Standpunkt der Volksgesundheit regiert, also die physische Intaktheit des Volkskörpers als Voraussetzung für dessen Benutzung bestimmend ist. Aber die Sorge ums physische (und psychische) Wohlbefinden wird dem Einzelnen nicht oktroyiert, er ist hier schon im eigenen Interesse unterwegs – und es wäre zynisch, ihm mit einer antimedizinischen (oder antipsychiatrischen) Absage ans herrschende „Gesundheitssystem“ zu kommen.
Dieser Hinweis ist auch deshalb angebracht, weil sich hartnäckig das Gerücht hält, in marxistischen Analysen würden speziell die psychischen Leiden der modernen Werktätigen – wie der 'subjektive Faktor' überhaupt – ignoriert oder verdrängt. „Seit jeher stehen Marxisten der Psychologie skeptisch gegenüber“ (Zander 2016). Meinhard Creydt schreibt: „Psychische Probleme gelten dem rationalen Subjekt, so wie es sich linke Rationalisten vorstellen, als 'Sorgen, die einem egal sein können'…“ (Creydt 2016, 114f). Der letzte Halbsatz, so teilt der Autor mit, sei ein Zitat aus der „Psychologie des bürgerlichen Individuums“ der Marxistischen Gruppe (MG 1981, 127). Dort steht in der Tat diese Formulierung, aber nicht im Text, der „vom Standpunkt einer rationellen Psychologie“ aus (ebd., 8) die wichtigsten Fragen, so in § 11 die „seelischen Krankheiten“, abhandelt. Das Zitat stammt vielmehr aus einer Buchwerbung des Verlags auf der vorletzten Seite, wo die Schrift „Die Bundesrepublik Deutschland 1980“ aus der Resultate-Reihe empfohlen wird. Dort geht es überhaupt nicht um psychische Probleme, sondern um eine Polemik gegen den verbreiteten Kritik-Modus, der sich die Rede von den politischen Problemen, die uns alle betreffen und die sich jeder zu eigen machen soll, positiv aufnimmt. Zu dem so gekennzeichneten Mitmacher-Standpunkt mit seinem Hineindenken in die Sorgen der Macher heißt es abschließend: „Da hilft doch nur eines: es statt der hergestellten Übernahme von Sorgen, die einem egal sein können, und der in der Psychologie der Macht beflissenen Charakterkunde der Figuren, denen umgekehrt dieser Maßstab egal ist, einmal mit der Kenntnisnahme der Resultate zu probieren, die sich aus der Betrachtung der tatsächlich realisierten Zwecke in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ergeben“ (ebd.).
Aber sei's drum. Anscheinend ist es nicht ganz überflüssig, gegen solche (gewollte) Missverständnisse erst einmal rein sachlich darauf zu verweisen, worin die Kritik an den heilenden und helfenden Berufen besteht und was der Ausgangspunkt ihrer jeweiligen Tätigkeit ist. Daher soll im Folgenden eine Zusammenfassung der Überlegungen gegeben werden, mit denen sich Sabine Predehl und Rolf Röhrig der erwähnten psychischen und psychosomatischen Störungen annehmen.
Die Leiden der Seele
Diese Störungen sind, wie oben skizziert, in dem Buch ein eigenes Thema. Zunächst werden sie im ersten Teil als ein Fall der „modernen Volksseuchen“ aufgeführt, und zwar in dem Sinne, wie sie die Experten des Gesundheitssystems als Problemfall bilanzieren. Dabei ist es, so die beiden Autoren aus dem Gegenstandpunkt-Verlag, gar nicht das große Rätsel, woher sie kommen. Das sei der Medizin nicht nur beim Burn-out – „da steckt die Sache schließlich schon in der Bezeichnung“ (Predehl/Röhrig 2016, 12) – durchaus bekannt. So führen nach der Diagnose der Bundespsychotherapeutenkammer, die zitiert wird, „chronische Überforderung und Stress … zu psychischen und psychosomatischen Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen, Rückenschmerzen, Tinnitus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ (ebd., 13). „Psychische Belastungen, Überforderung, Angst, Stress, Aufregung, warum auch immer ungelöste Konflikte“, heißt es dazu bei Predehl/Röhrig, „können Menschen fertig machen, auch ohne körperliche Schäden anzurichten: sie werden unfähig, mit sich und der Welt etwas Brauchbares anzufangen – womöglich, in dieser Gesellschaft der GAU, arbeitsunfähig. Ganz häufig wirkt sich das 'gestörte' Seelenleben aber auch auf ihre Physis aus: Belastungen und die andauernden Versuche, damit fertig zu werden, führen zu einer Aktivierung des vegetativen Nervensystems, was in die Regulation der meisten Organe eingreift. Ist das von Dauer und können die physiologischen Folgen vom Organismus nicht kompensiert werden, schlägt sich die chronische Aktivierung des vegetativen Nervensystems in unterschiedlichen Krankheiten nieder.“ (Ebd.)
Die Kritik am modernen Gesundheitswesen beginnt hier damit, dass seine Leistung aufs Korn genommen wird, angesichts der gewussten Ursachen dann doch im Einzelfall, mit dem es die klinische Praxis zu tun hat, nach lauter Risikofaktoren zu suchen – von genetischen Bedingungen bis zu Freizeitaktivitäten –, die für Ausbruch oder Verschlimmerung der Leiden oder für das Nicht-mehr-Aushaltenkönnen der Belastungen verantwortlich sein können. Denn, so der Pseudo-Beweis, es werden ja nicht alle krank, die denselben Beanspruchungen ausgesetzt sind. Um diese Art der Individualisierung zu widerlegen, widmet sich der Rest des ersten Teils den Krankheitsursachen, wie sie die moderne Klassengesellschaft hervorbringt und wie sie der Medizinbetrieb trotz seiner Ratschläge für eine gesündere Welt, die er ebenfalls im Repertoire hat, systematisch ausblendet. Nachdem dieser grundsätzliche Fehler abgehandelt ist, geht der zweite Teil über die Leistungen der heutigen Medizin in einem ersten Schritt detailliert den Erkenntnissen der Psychiatrie und Psychotherapie nach. Zur allgemeinen Charakterisierung der Krankheitsgenese heißt es einleitend: „Es ist eine Anstrengung eigener Art, die Anforderungen der Konkurrenzgesellschaft an der Stelle, an die es einen verschlagen hat, nicht bloß auszuhalten, sondern so zu bewältigen, dass Zufriedenheit einkehrt. Mit dieser Anforderung an Wille und Bewusstsein werden die Insassen der 'modernen Leistungsgesellschaft' auf nicht besonders unterschiedliche Art und Weise, aber unterschiedlich gut fertig. Nicht wenige so schlecht, dass am Ende ihre Brauchbarkeit für die ihnen zugänglichen Posten Schaden nimmt und – oder – ein halbwegs brauchbares Privatleben nicht mehr zustande kommt. Wo ein Mensch damit auffällig wird oder selbst daran so leidet, dass er Hilfe sucht, weiß die medizinische Wissenschaft sich zuständig.“ (Ebd., 52)
Diese Zuständigkeitserklärung kritisieren Predehl/Röhrig in dreierlei Hinsicht. Die erste Leistung, die die hier einschlägige Pathologie zu bieten hat, die Definition von Krankheitsbildern, wird wegen ihrer Subsumtion unter den medizinischen Krankheitsbegriff kritisiert. Der Hauptpunkt lautet: „Mit der Definition der Geistesleistungen, die einer vollbringt, der nicht mehr angemessen funktioniert, als Symptome einer Krankheit erspart sich die Psychopathologie vollständig die Beurteilung dieser Geistesleistungen“ (ebd., 54) – und sie erspart sich gleichzeitig die Beurteilung der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen das Individuum funktionieren soll. „Die zweite Leistung der psychiatrischen Wissenschaft besteht darin, die Leerstelle, die sie mit der Frage danach schafft, was hinter den gestörten Gedanken, Taten und Gefühlen steckt, durch 'Modelle' zu füllen, in denen sie dann alle möglichen verdächtigen Befunde und kundigen Mutmaßungen über die 'Disposition' bestimmter Individuen zu seelischen Schwachheiten und Entgleisungen, von der Erbanlage bis zur Stoffwechselkomplikation, samt allen möglichen Wechselwirkungen zwischen ihnen als Faktoren berücksichtigt.“ (Ebd., 55f) Entscheidend ist, dass hier von Kräften ausgegangen wird, die hinter dem Bewusstsein wirken, ja den ganzen seelischen Apparat bestimmen. Albert Krölls hat dieses deterministische Modell in seiner „Kritik der Psychologie“ (2016) zum Thema gemacht. Eine dritte Leitung der Psychopathologie wird abschließend kritisch gewürdigt, nämlich die neurowissenschaftliche Mode, die ins Therapiewesen Einzug hält.
Im zweiten Schritt ist dann die praktische Betreuung seelischer Leiden das Thema. „Wo der Hausarzt bei der 'psychosomatischen Grundversorgung' seiner Patienten zeitlich und fachlich an seine Grenzen kommt, da übernehmen die Fachleute der Psychiatrie und Psychotherapie mit ihrer Kunst der 'sprechenden Medizin'. Die greifen ganz fachmännisch den Widerspruch auf, den ihnen der Klient präsentiert, der sich mit seinem Denken und Fühlen in eine ganz eigene Welt ver-rückt hat: Der kommt nicht einfach mit einem besonders falschen Bewusstsein von sich und den Verhältnissen um ihn herum in die Praxis, sondern mit einer Fixierung auf Vorstellungen von und Einstellungen zu der Welt und sich selbst, die so, als hätten diese Gedanken von seinem Willen und Urteilen Besitz ergriffen, eine nach den herrschenden Maximen – die der Patient in der Regel teilt – normale Lebensführung verhindert; mit einer Überzeugung, die Urteile, Willen und Gefühle so bestimmt und von dem Kandidaten nicht selten auch so erlebt wird, als wäre er durch sie determiniert. Das Erste, was der Fachmann seinem Gegenüber zu bieten hat, ist die Anerkennung dieses Widerspruchs, nämlich mit der Diagnose eines geistigen oder seelischen Leidens, einer Krankheit.“ (Ebd., 71) Zu seiner schmerzlichen bis unaushaltbaren Vorstellungswelt soll sich der Patient so stellen, dass er sie in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten – dies die Ausgangsbedingung des Heilungsprozesses – als eine Krankheit nimmt, die ihn, sein auf Gesundheit bedachtes Ich, beeinträchtigt und die er loswerden will.
Zu den Verfahren, die dabei zum Zuge kommen, heißt es im Text resümierend: „Auf der Basis erfolgt das Angebot, dem als 'gestört' identifizierten Menschen in fachmännisch von überlegener Warte aus geführten Unterredungen aus seiner vorgestellten und empfundenen Determiniertheit herauszuhelfen. Praktisch geschieht das, indem der Therapeut in Konkurrenz zu der Willensleistung seines Patienten tritt und durch die gezielte Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit, also des Willens, der Gefühle, des Urteilsvermögens des Klienten, bei ihm für eine neue Einstellung zu den Vorstellungsinhalten wirbt, die ihn so unheilvoll ausfüllen…“ (Ebd.) Der Klient „soll – wenn schon nicht anstelle, dann doch immerhin neben seinen 'fixen Ideen' – den Verstandes- und Willensakt leisten, sich aus einer theoretischen Distanz heraus als Fall zu sehen und praktisch von seinen Phobien, Idiosynkrasien oder Wahnvorstellungen zu distanzieren.“ (Ebd.) Dabei treten dann je nach therapeutischer Richtung Medikamente zum Therapieprozess hinzu, werden zum Hauptmittel der Heilung oder zumindest der Ruhigstellung des Patienten, der mit der Dauermedikation im Alltagsleben wieder funktionieren kann.
Diese Hinweise belegen, dass von einer marxistischen Ignoranz gegenüber dem seelischen Leiden der modernen Menschheit keine Rede sein kann. Es verhält sich eher umgekehrt: Die als Teil des Gesundheitssystems institutionalisierte Psychopathologie bzw. Psychiatrie zeigt ihre Anteilnahme am Leiden des Patienten dadurch, dass sie es auf eine Stufe mit physischen Funktionsstörungen stellt, es also gar nicht als geistige Leistung ernst nimmt, sondern in dieser Hinsicht ignoriert. Unter dem Ideal einer raschen Behandlung, die das Leiden des Patienten abkürzt, soll etwa mit einer systematischen Desensibilisierung die Störanfälligkeit weg- oder mit einem entsprechenden Psychopharmakon ein zufriedenstellender Zustand hinmanipuliert werden. Die Gleichsetzung mit physischer Krankheit – die für den krank-, d.h. arbeitsunfähig geschriebenen Patienten natürlich eine entlastende Funktion hat – bedeutet eine grundlegende ideologische Umdeutung, sofern nicht der spezielle Sachverhalt einer hirnorganischen Störung gemeint ist. Ein Terminus wie „Geisteskrankheit“ verbietet sich daher zur allgemeinen Kennzeichnung seelischer Leiden. Michael Zander hat übrigens seine Kritik an Krölls' Buch über Psychologie und Psychotherapie u.a. an solchen terminologischen Fragen festgemacht: Kategorien wie „verrückt“ oder „geisteskrank“ hätten „in der Fachdebatte nichts zu suchen“ (Zander 2016). Mit diesem Einwand wird aber mehr ein Standpunkt der Political Correctness zum Ausdruck gebracht. Und für die Psychiatrie gilt ja eher das Gegenteil, dass sie nämlich den Krankheitsbegriff in der Fachdebatte verankert. Von „Verrücktheit“ zu sprechen, wie es kritische Analysen, so die erwähnte MG-Publikation (MG 1981), gelegentlich tun, mag heute als umgangssprachlich gelten. Es ist damit aber keine Abwertung gemeint, sondern die schlichte Tatsache, dass beim seelischen Leiden kein Defekt im Sinne des medizinischen Krankheitsbegriffs vorliegt, sondern gegenüber den geistigen Leistungen der Normalbürger eine Verschiebung oder Verrückung stattgefunden hat.
Literatur
- Carl Cederström/André Spicer, Das Wellness-Syndrom – Die Glücksdoktrin und der perfekte Mensch. Berlin 2016.
- Meinhard Creydt, Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler – Interessenpolitik, Autonomie und linke Denkfallen. Hamburg 2015.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Sinkende Lebenserwartung bei Geringverdienern: Methodisch unsauber, selbstverschuldet und theoretisch völlig unnötig. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2012.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Die Pflegeversicherung – Der Sozialstaat stockt seine Finanzquellen auf. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 1994.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Andrea Fischers „Gesundheitsreform 2000“ – Ein neuer Budgetdeckel auf die alte Wahrheit: Krankheit und Gesundwerden – für Lohnarbeiter einfach zu teuer. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 1999.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Pharmakonzerne klagen gegen die Republik Südafrika – Aidsbekämpfung nach den Regeln des internationalen Geschäfts. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2001.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Noch ein Skandal: Feinstaub schadet der Gesundheit … von Bund, Ländern und Gemeinden, Industrie, Handel und Konjunktur. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2005.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Die Ford AG investiert ins Humankapital: Verschleiß ganzheitlich. In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2006.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Anmerkungen zur politischen Ökonomie der Wachstumsbranche Volksgesundheit sowie zu Grund und Zielen der aktuellen Reform des bundesdeutschen Gesundheitswesens. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2007.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- MG – Marxistischen Gruppe, Die Psychologie des bürgerlichen Individuums. München 1981 (4. Auflage 1990).
- Michael Zander, Unhaltbare Polemik – Neuauflage von Albert Krölls’ „Kritik der Psychologie“ im VSA-Verlag erschienen. In: Junge Welt, 6.6. 2016.
Betrifft: Industrie 4.0
Experten erwarten von der Verbreitung digitaler Technologien eine neue industrielle Revolution – „disruptive soziale und ökonomische Folgen“ inklusive. Was es mit dem Schlagwort „Industrie 4.0“ auf sich hat, analysiert die neue Ausgabe der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
„Industrie 4.0“ lautet ein aktuelles Schlagwort, das eine neue, nach der Dampfmaschine, der Massenfertigung am Fließband und der Automatisierung der Produktion vierte industrielle Revolution ankündigt oder konstatiert. „Die digitale Revolution ist in vollem Gange“, schreiben Mitarbeiter des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (Rinne/Zimmermann 2016, 3). In Deutschland wird dazu seit einigen Jahren eine Debatte geführt, an der sich die Bundesregierung in Form des Arbeits- oder Wirtschaftsministeriums maßgeblich beteiligt (http://www.arbeitenviernull.de/, https://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-…). „Industrie 4.0 ist kein betrieblicher Begriff,“ betont deshalb ein gewerkschaftsnaher Fachmann, „sondern der Name eines von der Bundesregierung geförderten Forschungsprogramms“ (Schwarzbach 2016a, 11), die Regierung finanziere einschlägige Projekte „bislang mit mehr als 120 Millionen Euro und hat weiteres Geld in Aussicht gestellt“ (Schwarzbach 2016b, 50). Wirtschaft wie Wirtschaftsverbände sind natürlich mit von der Partie. Es handelt sich folglich um mehr als eine Technikphantasie oder die bekannte Beschwörung von Fluch und Segen des technischen Fortschritts, die man aus dem Feuilleton kennt.
Experten gehen angesichts der zunehmenden Verbreitung digitaler Technologien davon aus, „dass sich mit ihnen geradezu disruptive soziale und ökonomische Folgen verbinden… dass ein neues Niveau produktionstechnologischer Entwicklung erreicht sei, dessen zentrale Merkmale die Verknüpfung der virtuellen mit der realen Welt durch 'Cyber-physikalische Systeme', der breite Einsatz von Sensoren und Systemen zur Datenerfassung sowie die systematische Nutzung der damit verfügbaren großen Datenbestände auf der Basis von Big-Data-Methoden seien. Hiernach eröffnen sich grundlegend neue Potenziale für die gleichzeitige Automatisierung und Flexibilisierung von Produktionsprozessen, die Optimierung überbetrieblicher Wertschöpfungsketten sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit bislang nicht gekannten intensiven Kundenbeziehungen.“ (Hirsch-Kreinsen 2016, 10) Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Gegenstandpunkt (GS 2/16) hat dem Thema eine umfangreiche Analyse gewidmet (vgl. Decker 2016), die im Folgenden in ihren Grundzügen und ihrer Stoßrichtung vorgestellt werden soll.
Ökonomie und Politik
„Unter dem Titel 'Industrie 4.0' wird nicht weniger als eine Zeitenwende verkündet, die zwar dem Namen nach nur die Industrie betrifft, aber der Sache nach die ganze Art und Weise verändern soll, wie in Zukunft produziert und konsumiert wird.“ (Ebd., 23) Decker und Co. greifen eingangs die landläufigen Charakterisierungen des stattfindenden industriellen Wandels auf, die sich auf der üblichen Schiene von erwarteten Chancen und befürchteten Risiken bewegen. In diesem Hin und Her könne „ein Machtwort der deutschen Kanzlerin, die die Sache … zur Chefsache erklärt, für Klarheit“ sorgen, nämlich Merkels Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2015, in der es hieß: „Wir müssen die Verschmelzung der Welt des Internets mit der Welt der industriellen Produktion schnell bewältigen, weil uns sonst diejenigen, die im digitalen Bereich führend sind, die industrielle Produktion wegnehmen werden.“ (Ebd., 24) Die Bundeskanzlerin erinnerte in ihrer Rede daran, dass sich die wunderbaren technologischen Innovationen in einer Welt der grenzüberschreitenden Konkurrenz abspielen und dass es dabei nicht einfach auf den Zugewinn an Naturbeherrschung ankommt, sondern auf den Vorsprung, den sich ein Kapital oder ein Standort verschafft. „Hat man den nicht, ist die Technik nicht nur nichts wert: Sie wird umgekehrt zu einer existenziellen Bedrohung, die von denen ausgeht, die 'uns' voraus sind. Wenn deutsche Unternehmer an der digitalen Hauptfront nicht entschlossen vorangehen, dann laufen nicht nur sie, sondern auch 'wir alle' Gefahr, 'den Anschluss zu verpassen' und bald endgültig 'abgehängt' zu werden.“ (Ebd.) Damit ist ein grundlegender Punkt der ganzen Angelegenheit festgehalten: Industrie 4.0 ist, wie es im Politjargon heißt, eine Herausforderung, bei der alles davon hängt, sie als Erster zu meistern. So wird das Publikum – beschließt der Gegenstandpunkt die einleitenden Bemerkungen – zwar kaum darüber aufgeklärt, womit man es bei dieser „Revolution“ zu tun hat, aber immerhin darüber, worauf es bei ihr ankommt.
Diese Notwendigkeit, den technischen Fortschritt wegen und in der Konkurrenz um Profit zu betreiben, ist keine neue Erscheinung des Kapitalismus, die auf eine neuartige industrielle Revolution schließen ließe. Marx hat sie im ersten Band des „Kapital“ im Abschnitt über die Produktion des relativen Mehrwerts abgehandelt; eine kurz gefasste, aufs aktuelle Erwerbsleben bezogene Darstellung dieser Erklärung bieten Margaret Wirth und Wolfgang Möhl im dritten Kapitel von „Arbeit und Reichtum“, das „die Rolle des technischen Fortschritts in der Marktwirtschaft“, nämlich „die Produktivkraft der Arbeit als Waffe im Konkurrenzkampf der Unternehmen um Rendite“, zum Thema macht (Wirth/Möhl 2014, 40ff). In diesem Sinne greift der erste Teil des GS-Artikels das Unterfangen „Industrie 4.0“ auf. Er stellt die ökonomische Interessenlage dar und charakterisiert sie – zunächst – als business as usual. Die großartig angekündigte digitale Revolution wird hier auf den Boden der (ökonomischen) Tatsachen zurückgeholt, sie ist eine weitere Offensive in der endlosen Kette von Rationalisierungsmaßnahmen, mit denen industrielle Kapitalisten seit eh und je ihren Kampf um Extraprofit betreiben.
Die Einsparung von bezahlter Arbeit durch den Einsatz von Robotern oder ähnliche Maßnahmen, die fortschreitende Automatisierung, die durch die Digitalisierung einen neuen Schub erhält, stehen am Anfang des ersten Teils. Dieser geht dann allerdings die weiteren Maßnahmen und Vorhaben durch – Einsparung von Zirkulationskosten, Innovationen in Management und Marketing; Flexibilisierung und Vernetzung der Produktion; „Internet der Dinge“ und neue Geschäftsmodelle –, um festzuhalten, dass man es hier nicht einfach mit einer Rationalisierungsmaßnahme zu tun hat, wie man sie aus der Geschichte des Kapitalismus kennt, also mit der Erringung eines technischen Fortschritts durch einzelne Kapitalisten, die damit in die Lage versetzt werden, eine Kostensenkung durchzuführen, um sich auf dem Markt zu behaupten und durchzusetzen, wobei dieser Erfolg bei der Verallgemeinerung des neuen Produktivitätsstandards wieder verloren geht, daher zur nächsten Modernisierungs-Anstrengung anstachelt.
Die jetzige Innovation, die unter dem Stichwort Digitalisierung läuft, hat ihre Besonderheit. Sie führt erstens zu einer „neuen, folgenreichen Form der Kooperation zwischen kapitalistischen Konkurrenten. Zwischen Industrieunternehmen und Zulieferern bzw. Abnehmern, aber auch zwischen Betrieben, die im Prinzip das Gleiche herstellen, entstehen 'Wertschöpfungsnetzwerke': Der Bedarf des einen Unternehmens – an Zulieferung oder Übernahme eines Teils der eigenen Produktion… – setzt unmittelbar die Produktion in einem anderen Unternehmen in Gang, und zwar in genau der benötigten Menge und Qualität. Ihre jeweiligen Produktionsprozesse greifen also automatisch ineinander, sie überschreiten die Unternehmensgrenzen und relativieren damit die exklusive Verfügung der Betriebsherren über ihr produktives Eigentum“ (Decker 2016, 27f). Und die Umwälzung bisheriger Methoden der Produktion und Distribution ist zweitens kein Fall einer mehr oder weniger gelungenen Implementierung technologischer Verfahren in den einzelnen Firmen, sondern hat es mit einem fertigen Medium, dem Internet, zu tun, das sich in der Hand finanzstarker Unternehmen befindet. Mit den harten und soften Bedingungen dieses Mediums haben diese schon seit längerem einen geschäftlichen Aufstieg vollzogen, und zwar als Objekte einer Spekulation, die sich der möglichen Zukunftsbedeutung der noch gar nicht im Einzelnen feststehenden Geschäftsfelder annahm – und sie besetzte, um anderen Wettbewerbern zuvorzukommen. Diese Felder haben mittlerweile konkrete Gestalt angenommen, nämlich als „eine Art virtuelles Gesamthandelskapital“, das einen „virtuellen Gesamt-Marktplatz“ für Einkauf und Verkauf, für die Erschließung weltweiter Märkte und für die Möglichkeit, Käufer an sich zu binden, stiftet (ebd., 28). Die global agierenden IT-Unternehmen (Google, Facebook, Amazon…) repräsentieren dabei nicht nur Kapitalmacht, sondern auch die Macht des Standorts USA, von dem aus sie die Welt erobern.
In einem weiteren Schritt geht daher der erste Teil, der aber im Rahmen der ökonomischen Praktiken verbleibt, auf die Widersprüche und Probleme ein, die sich kapitalistische Konkurrenten mit ihrer „Revolution“ einhandeln, d.h. auf den Widerspruch zwischen der Vernetzung, die über Unternehmensgrenzen hinweggeht, und ihrem Zweck, der ausschließenden Verfügung über den mit ihr angepeilten Ertrag (ebd., 30ff), sowie auf das Problem, das konkurrierende Kapitale mit der Verschmelzung von IT und Industrie haben (ebd., 36ff). Was mit „Industrie 4.0“ in die Wege geleitet wird, ist ein Umbau von Unternehmen und Standorten, und zwar nicht im technischen Sinne, sondern in politökonomischer Hinsicht. Der Widerspruch, den sich Konkurrenten mit ihrer Kooperation einhandeln, erhält die Verlaufsform, dass sich die Konkurrenz auf eine neue Ebene verlagert, nämlich auf eine um „Standards“ bzw. „Daten“ und die damit anstehende Klärung, wer sie bestimmt bzw. wem sie gehören. So „stehen die Konkurrenten vor der aparten Aufgabe, das, was sie im Interesse ihres Geschäfts unbedingt freisetzen wollen, zugleich zu begrenzen“ (ebd., 34). Und auch das mit dem Stichwort Verschmelzung aufgeworfene Problem findet seine vorwärtsweisende Lösung: Es beginnt der Kampf um die Beherrschung der gesamten industriell-digitalen „Wertschöpfungskette“. Die 'traditionellen' Industriekapitale, so etwa die global agierenden Automobilkonzerne, die bislang als Schlüsselindustrien die Macht des deutschen Standorts verbürgen, nehmen „die Konkurrenz um das verschmolzene Geschäft auf – und die dreht sich jetzt um die Frage, wer über die zunehmende Verzahnung zwischen IT, Industrie und Handel, also über den digitalisierten Produktionsprozess überhaupt bestimmt.“ (Ebd., 37) Dabei geht es nicht bloß darum, einer Abhängigkeit von (amerikanischen) IT-Firmen zu entgehen, sondern um eine Offensive, die sich der Frage stellt, wer den Kampf um die Industrie und das Weltgeschäft der Zukunft gewinnt.
Sowohl mit der rechtlichen Regelung von Standardisierungen und Datensicherheit als auch mit den neuen Konkurrenzoffensiven, die die etablierte Hierarchie der Unternehmen und Standorte in Frage stellen (wollen), ist natürlich nicht mehr allein die ökonomische Sphäre angesprochen. Hier ist die Standortpolitik, also der Staat, gefragt und involviert. Das heißt, alle politischen Subjekte, die auf dem Weltmarkt ein Wort zu sagen haben (wollen), sehen sich durch den ökonomischen Fortschritt – lange bevor sie die Konsequenzen für ihre nationale „Arbeitsgesellschaft“ bilanzieren – herausgefordert. Der GS-Artikel thematisiert dies anhand der deutschen Politik, die ja, siehe oben, die wirtschaftliche Sache nicht einfach der Wirtschaft überlässt. Er zitiert dazu Merkels Rede auf dem Kongress „Wirtschaft 4.0“, die noch einmal klarstellt, dass es hier nicht um ein wissenschaftlich-technisches Problem der Modernisierung geht, sondern um eine Frage, die „volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung“ ist, ob nämlich „die klassische industrielle Produktion eines Tages der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung zu erreichen, mit der wir dann auch weiter weltweit reüssieren können… Das ist nämlich im Kern der Kampf, der zurzeit ausgefochten wird“ (so Merkel, zit. nach ebd., 39).
Wie Deutschland diesen Kampf auszufechten gedenkt und was es dafür in die Wege geleitet hat, ist Gegenstand des zweiten Teils des GS-Artikels: von der Herstellung gesamteuropäischer Rechtssicherheit – natürlich unter deutscher Federführung – über die Herrichtung eines europäischen Binnenmarkts für Unternehmen entsprechende Kapitalgröße (hier sind Monopole ein Segen und kein Schaden, wie sonst von nationalen Wettbewerbshütern moniert), über die Bereitstellung von Infrastruktur, von Bildungs- und Qualifizierungsleistungen, die staatliche Moderation des widersprüchlichen Kooperations- und Vernetzungswesens bis hin zum Aufwerfen der Souveränitätsfrage. Hier wird abschließend noch einmal betont, dass die Behauptung der eigenen Souveränität im „digitalen Raum“ kein defensives Programm ist. Ziemlich nahtlos gehe „so die Standortpolitik zur Beförderung der Geschäfte der deutschen IT-Kapitale zum Auftrag über, ihrem staatlichen Förderer auch alle nötigen Mittel zur Absicherung seines nationalen Besitzstandes und Gewaltbedarfs bereitzustellen.“ (Ebd., 45)
Diesen beiden Teilen schließt sich ein dritter und letzter Teil an, der die Überschrift „Die Arbeitswelt 4.0“ trägt. Er geht zurück zum Ausgangspunkt der ganzen Überlegungen, die von „Industrie 4.0“ als einer Rationalisierungsmaßnahme handelten. Auch wenn die jetzt angelaufene industrielle Revolution über die technologisch ermöglichte Einsparung bezahlter Arbeitskraft weit hinausgeht – mit dem Aufwerfen digitaler Souveränitätsfragen gehört sie ja schon in die imperialistische Konkurrenz auf dem Globus –, behält dieser Ausgangspunkt für die ökonomische Praxis seine Relevanz. An Kostenersparnis beim Faktor Arbeit kommt kein Unternehmen, das in der Konkurrenz bestehen will, vorbei. Dafür leistet das neue, „digitale“ Geschäftsmittel genauso seinen Dienst wie die früheren. „Diesen Wegfall von Arbeitsplätzen und die damit einreißende Verarmung als Wirkung, als eine Art ungewolltes Nebenprodukt oder 'Schattenseite' der anrollenden Automatisierungswelle zu besprechen, ist eine bodenlose Dummheit. Das ist schon der Sinn der Sache, wenn Unternehmer die notwendige Arbeit für Produktion und Verkauf ihrer Waren reduzieren.“ (Ebd., 46) Es ist aber auch nicht der ganze Sinn der Sache, denn so werden nicht bloß bestehende Arbeitsplätze abgebaut, sondern ein neues Regime über die Arbeit – Stichwort: Erosion des Normalarbeitsverhältnisses – auf- bzw. ausgebaut. „'Revolutionär' ist das alles nicht“, resümieren Decker und Co.; „dass ein Arbeitsplatz nichts anderes ist als ein Ensemble vergegenständlichter Leistungsanforderungen für seinen ‚Besitzer‘, wird bei dieser 'industriellen Revolution' nur besonders anschaulich…“ (Ebd., 47) Den Schlusspunkt der Abhandlung bilden dann die „sozialstaatliche Folgenbewirtschaftung“ und (ebd., 50ff) ein „gewerkschaftlicher Epilog zu Fluch & Segen des technischen Fortschritts“ (ebd., 52ff).
Die Welt der Arbeit
Mit dieser Analyse, ihrer Gliederung und ihren Schlüssen liegt der Gegenstandpunkt quer dazu, wie normale Weise die Problematisierung von „Industrie 4.0“ geht. Der genannte Autor Marcus Schwarzbach, der als Berater für Gewerkschaften und Betriebsräte tätig ist, hat hierzu ein ganzes Buch verfasst, das der Frage nachgeht, wie sich die Zukunft der Arbeit gestalten wird und welche Aufgaben auf die Gewerkschaften zukommen. Das Buch stellt die Zukunftsfrage in den Mittelpunkt, so als ob es sich um eine offene Frage handeln würde. Es will realistisch Eingriffsmöglichkeiten abschätzen: „Ziel ist es nicht, Horrorszenarien aufzubauen oder unrealistische Visionen zu formulieren.“ (Schwarzbach 2016a, 9) Wenn z.B., referiert Schwarzbach Überlegungen von Betriebsratseite, „der Einsatz kooperierender Roboter dazu führt, anstrengende Routinetätigkeiten zu automatisieren, ohne dass damit Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen… – dann immer gerne, dann spricht nichts gegen deren Einsatz.“ (Ebd., 23) Über die zukünftige Rolle von computergestützten Assistenzsystemen – bleibt hier der „Mensch das Maß aller Dinge“ oder werden leicht austauschbare, unqualifizierte Kräfte eingesetzt? – teilt der Fachmann mit: „Noch ist nicht ausgemacht, in welche Richtung die Entwicklung geht“ (ebd., 35). Oder es werden Fragen gestellt wie: „Wer entscheidet bei der Kooperation zwischen Mensch und Roboter? Gibt die Technik dem Arbeiter vor, was zu tun ist?“ (Schwarzbach 2016c, 13). Und das wird dann mit einer grundsätzlichen Antwort der IG Metall abgeschlossen: „Entscheidend ist für uns, wie die Entwicklung gestaltet wird. Die Beschäftigten müssen frühzeitig in die Veränderungsprozesse einbezogen werden. Und der Mensch muss die Maschine steuern und nicht umgekehrt.“ (Ebd.)
Das ist gar nicht so weit entfernt von der Position des arbeitgebernahen Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), dessen Autoren ebenfalls von einer offenen Entwicklung sprechen, wobei jedoch schon eine ganze Menge feststehen soll. Auf Grund bisheriger Studien sei es halbwegs sicher, dass das Arbeitsvolumen in der Industrie insgesamt nicht abnehme, d.h., dass Jobverlust an der einen Stelle anderswo kompensiert werde. Was natürlich, wie man weiß, von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. „Allerdings finden sich gleichwohl Hinweise auf einen Rückgang von Arbeitsvolumen und Lohnniveau für Beschäftigte mit geringer bis mittlerer Qualifikation.“ (Rinne/Zimmermann 2016, 5) Beiläufig wird später erwähnt, dass die fortschreitende Digitalisierung „jedoch zunehmend auch die Perspektiven von besser Qualifizierten (bedroht)“. (Ebd., 6) Es gebe Studien, denen zu Folge in den USA 47 % aller Beschäftigten in Berufen arbeiten, die zumindest mittelfristig davon bedroht sind, durch Automaten ersetzt zu werden (ebd.). Zu den vom Aussterben bedrohten Berufsbildern gehören demnach etwa Telefonverkäufer, einfache Büroangestellte, Köche und Packer, aber auch Piloten und Richter (vgl. Staab/Nachtwey 2016, Boes u.a. 2016). Fraglich bleibe überhaupt, wie sehr das Leitbild des „Normalarbeitsverhältnisses“ in Zukunft noch bestimmend sein werde (Rinne/Zimmermann 2016, 7). Am Schluss ist dann aber laut IZA-Einschätzung der Weg, der mit „Industrie 4.0“ eingeschlagen wird, grundsätzlich offen und speziell die Mitwirkung der Gewerkschaften gefragt, da „diese den Wandel aktiv begleiten und gestalten können“ (ebd., 9).
Auch die Problematisierungen, die von der politischen Opposition kommen, bewegen sich in diesem Fahrwasser. Bernd Riexinger, Vorsitzender der Linkspartei, stellt fest: „Der neue Schub der Digitalisierung könnte zu weitreichenden Umbrüchen in der Arbeit und im Alltagsleben führen. Oft wird dies eher als Bedrohungsszenario diskutiert. Die deutliche Steigerung der Arbeitsproduktivität und neue Formen der Produktion können aber auch Chancen eröffnen für ein stärker selbstbestimmtes Arbeiten und Leben, für eine sozial gerechtere und ökologische Gestaltung der Wirtschaft – und für neue Formen der Demokratie, die Alltag und Arbeit einschließen.“ (Riexinger 2016, 60) Anscheinend ist dem ehemaligen Gewerkschafter Riexinger nicht bekannt, wozu Unternehmen Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität ergreifen. Der ökonomische Grund dafür, dass sie sich um die Produktivität kümmern, gerät jedenfalls in solchen Prognosen völlig in den Hintergrund. Von der Politik über die Gewerkschaften bis zu Medien und Wissenschaft erhält man letztlich die Auskunft, dass hier ein eigenständiger Fortschrittsprozess wirkt – die ominöse Digitalisierung –, der auch seine Schattenseiten hat bzw. haben kann: „Neue Technologien sollen Arbeit reduzieren, können aber auch das Gegenteil bewirken.“ (Carstensen 2016, 42) Als Fazit der diversen Studien halten Experten allen Ernstes fest, es sei „unstrittig, dass die Arbeitsfolgen der Digitalisierung uneindeutig sind und das Verhältnis zwischen digitalen Technologien und menschlicher Arbeit von Widersprüchen und Barrieren geprägt ist.“ (Hirsch-Kreinsen 2016, 16)
„Auffällig ist“, schreibt eine Sozialhistorikerin, dass sich sowohl im amerikanischen wie deutschen „Industrie 4.0“-Diskurs „bestimmte Topoi finden, die die Debatte seit ihrem Beginn in den 1950er Jahren kontinuierlich prägen. Sie wirken merkwürdig vertraut und wenig überraschend. Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind es ähnliche Argumentationsfiguren, Versprechungen, behauptete Notwendigkeiten und Befürchtungen, die mit der Automatisierung der Arbeitswelt einhergehen und die nur leicht variieren.“ (Heßler 2016, 17f). Und bereits im Kontext des so genannten Maschinensturms zu Beginn der Industrialisierung sollen sich vergleichbare Muster der Argumentation finden lassen… Diese Auffälligkeit verweist eben darauf, dass sich die Interessenlage des Kapitals seit den Zeiten der ersten, zweiten oder dritten industriellen Revolution nicht verändert hat, wenn es darum geht, die Arbeit produktiver zu machen. Nur wenn man die Arbeit von ihrer politökonomischen Grundlage abkoppelt, also von ihrer grundlegenden Bestimmung der Rentabilität absieht, erscheint die Welt der Arbeit angesichts fortschreitender Digitalisierung als ein Prozess, von dem man mit Eindeutigkeit nur sagen kann, dass er uneindeutig ist – also offen für alle möglichen Gestaltungsaufgaben, um die sich die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft zu kümmern haben.
Literatur
- Andreas Boes u.a., Digitalisierung und „Wissensarbeit“: Der Informationsraum als Fundament der Arbeitswelt der Zukunft. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 32-39.
- Tanja Carstensen, Ambivalenzen digitaler Kommunikation am Arbeitsplatz. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 39-46.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), „Industrie 4.0“ – Ein großer Fortschritt in der „Vernetzung“ und in der Konkurrenz um die Frage, wem er gehört. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2016, S. 23-53.
- Martina Heßler, Zur Persistenz der Argumente im Automatisierungsdiskurs. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 17-24.
- Hartmut Hirsch-Kreinsen, Zum Verhältnis von Arbeit und Technik bei Industrie 4.0. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 10-17.
- Bernd Riexinger, Für eine demokratische Zukunftswirtschaft – Überlegungen zu einer linken digitalen Agenda. In: Marxistische Blätter, Nr. 3, 2016, S. 60-67.
- Ulf Rinne/Klaus F. Zimmermann, Die digitale Arbeitswelt von heute und morgen. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 3-9.
- Marcus Schwarzbach, Work around the clock? Industrie 4.0, die Zukunft der Arbeit und die Gewerkschaften. Köln 2016a.
- Marcus Schwarzbach, Die modernen Clickarbeiter. In: Marxistische Blätter, Nr. 3, 2016b, S. 46-53 (Auszug aus Schwarzbach 2016a).
- Marcus Schwarzbach, Überwachtes Maschinenanhängsel – Technologische Innovationen im Rahmen der „Industrie 4.0“ dürften die Gängelei am Arbeitsplatz verschärfen. Bereits jetzt sind in den Betrieben gravierende Veränderungen sichtbar. In: Junge Welt, 7.6. 2016c, S. 12-13.
- Philipp Staab/Oliver Nachtwey, Die Digitalisierung der Dienstleistungsarbeit. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18-19, 2016, S. 24-31.
- Margaret Wirth/Wolfgang Möhl, „Beschäftigung“ – „Globalisierung“ – „Standort“. Anmerkungen zum kapitalistischen Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum. München 2014.
Die Macht der Moral
2015 ist von Georg Loidolt ein Abriss zur Kritik der Moralphilosophie erschienen. Dem ist jetzt der Band „Begehrte Dogmen und ihre unerwünschte Widerlegung“ gefolgt. Dazu ein Text des Autors.
2015 ist von Georg Loidolt ein Abriss zur Kritik der Moralphilosophie „Ewig lockt die Bestie“ (Loidolt 2015) erschienen. Eine philosophische Begründung der Moral ist natürlich ein Luxus, den sich der Normalbürger in den seltensten Fällen leistet: Er schätzt einfach die Sittlichkeit und weiß aus seinem Daseinskampf im marktwirtschaftlichen Betrieb, dass es ohne sie nicht ginge. Dabei kann er sich, wenn er dazu aufgelegt ist, auch Rückendeckung bei einem berühmten deutschen Philosophen, bei Immanuel Kant, holen, der den vielleicht noch berühmteren „kategorischen Imperativ“ formulierte. „Mit der Fassung dieses Imperativs“, heißt es in einer marxistischen Analyse, „ist Kant das wohl populärste Stück Philosophie überhaupt gelungen. Dieser Gedanke hat die Massen ergriffen – oder war es umgekehrt? Jedenfalls kann jeder bessere Politiker und Studienrat zitieren: 'Handle stets so, daß du zugleich wollen kannst, daß die Maxime deiner Handlung allgemeines Gesetz werde.' Wer nicht studiert hat, kennt den kategorischen Imperativ darum aber nicht schlechter, nur eben volkstümlich und gereimt: 'Was du nicht willst, daß man dir tu',/das füg' auch keinem andern zu.' Alle Schichten des Volkes aber schätzen die absolute Kurzfassung der probehalber verallgemeinerten Handlung: 'Wenn das jeder täte!' Diese Moralprobe auf jede Handlung scheint so überzeugend zu sein, daß sich die Nachfrage 'Was wäre dann?' allemal erübrigt.“ (MG 1990, vgl. auch www.wissenschaftskritik.de/name/immanuel-kant/)
Loidolt hat solche und ähnliche Nachfragen an die großartige philosophische Tradition, der man sonst mit Respekt begegnet, gestellt. Das Thema spielt jetzt auch eine Rolle in seiner neuen Veröffentlichung „Begehrte Dogmen und ihre unerwünschte Widerlegung“ (2016; nähere Informationen zu den Publikationen finden sich unter: http://lektoratsprofi.com/buecher-2/). Sie versammelt lauter landläufige moralische und ideologische Vorurteile zu heutzutage angesagten Themen (z.B. Antifa, Asyl, das Böse, Demokratie, Feminismus, Flüchtlinge, Gewalt, Gewinnstreben, Holocaust, Islam, Kommunismus, Linke Moral, Meinungsfreiheit, Nationalismus, PEGIDA, Religion, Schule, Toleranz, Verhetzung, Wahlen, Würde) und widmet ihnen eine meist kurze Kritik, die auch Hinweise zu weiterführender Lektüre gibt. Im Folgenden veröffentlicht IVA einen Text des Autors aus diesem Band.
Macht der Moral
Ein Egoist und Materialist zu sein, gilt in der bürgerlichen Gesellschaft als Vorwurf. Zunächst hält sie es für ihr Gütezeichen, das „gesunde Erwerbsstreben“ zu pflegen, wodurch jeder im Streben nach seinem Vorteil das allgemeine Wohl hervorbringe, als wäre er von einer unsichtbaren Hand geleitet. Bleibt dieses Gemeinwohl jedoch aus, so lastet sie dies ebenso dem von ihr gehegten Erwerbsstreben an, das nun plötzlich als egoistische Gier verdammt wird, welche zu verhindern es einer entsprechenden Moral bedürfe. Zum einen sorgt ohnehin der Staat mit seinen Gesetzen dafür, dass sich das Erwerbsstreben innerhalb gewünschter Grenzen bewegt, zum anderen sollen sich seine Bürger diese Grenzen zu eigen machen, um die staatlichen Institutionen durch vorauseilenden Gehorsam zu entlasten. Dies zu leisten ist die Aufgabe dessen, was allgemein als Moral bekannt ist.
Immer Rücksicht auf andere zu nehmen und nicht selbstsüchtig und eigennützig die anderen je nach Bedarf als Mittel zu gebrauchen und auch wieder fallen zu lassen, lautet die Grundregel der Moral. Die Formel dazu hat Kant aufgestellt, dass man andere Menschen nicht nur als Mittel, sondern auch als Zweck behandeln solle: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“ (Kant 1983, 61, Hervorh. i.O.). Diese Forderung ist keineswegs so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Schließlich ist nicht einzusehen, weshalb der Gebrauch anderer Menschen als Mittel zur Befriedigung eigener Bedürfnisse von vornherein für diese schädlich sein sollte, wenn die von der Moral geforderte Rücksichtnahme ausbliebe. Auch ist nicht nachvollziehbar, weswegen bei einer Zusammenarbeit der gegenseitige Gebrauch, den Menschen voneinander machen, dazu führen sollte, sich gegen die Anliegen der Arbeitspartner gleichgültig zu verhalten und diese je nach Bedarf zu nutzen oder unbeachtet zu lassen. Eine solche Forderung ist daher ein Indiz für gegensätzliche Verhältnisse, in welchen die Menschen sich in einer Konkurrenz zueinander befinden, nicht aber ein Merkmal von Kooperation oder von menschlichen Beziehungen im Allgemeinen.
Die Gegensätze, die den Bürgern mit der Festlegung des Privateigentums als Mittel ihres Erfolges auferlegt sind, dürfen aber nicht bis zur letzten gewaltsamen Konsequenz ausgetragen werden. Dafür sorgt der Staat mit seiner Polizeigewalt und verbucht die dennoch stattfindenden Verstöße gegen dieses Gebot des Gewaltverzichts in seinen Kriminalitätsstatistiken. Darüber hinaus scheint es auch unerträglich zu sein und als Kennzeichen eines zynischen Machiavellisten zu gelten, wenn man aus diesen Interessengegensätzen kein Hehl macht und sich ungeniert zur rücksichtslosen Durchsetzung der eigenen Interessen bekennt. Das Bedürfnis einer heuchlerischen Beschönigung der Interessengegensätze verleiht der Moral daher eine solche Macht, dass selbst ein Machiavellist sich dieser nicht entziehen kann, sondern sich ihrer zur Durchsetzung seiner Interessen bedienen muss. „Und weil die Moral so mächtig geworden ist, wird kein Machiavellist von heute darauf verzichten, seine eigennützigen Interessen moralisch zu verbrämen“, stellt Otfried Höffe daher fest (Höffe 2013, 119; vgl. Loidolt 2015, 103). Das freut ihn einerseits, weil seine Begeisterung für Moral den Charakter einer weltfremden Schwärmerei verliert, wenn sich diese als handfeste Wirklichkeit erweist. Andererseits stößt er sich an dem hier seiner Auffassung nach vorliegenden Missbrauch, für den er diesen Gebrauch der Moral hält, denn dadurch versagt sie ihm die nützlichen Dienste, die er ihr andichtet. Derartig als Vehikel zur Beförderung der eigenen Interessen brauchbar, bewirkt Moral nämlich gar nicht jene Einschränkung dieser Interessen, die sie leisten sollte.
Soll man deswegen nun darüber klagen, dass die Moral nicht jene Entsagung bewirkt, die Höffe gerne von ihr hätte, dass sie vielmehr sogar zur Bemäntelung von Interessen statt zu deren Einschränkung taugt? Oder sollte man nicht besser zur Kenntnis nehmen, dass jeder die moralische Mäßigung immer nur bei anderen vermisst, während er diese allein sich als Verdienst zuspricht? Weil jeder sich selbst für ein Wunder an Selbstlosigkeit und Rücksichtnahme hält, leitet er daraus umgekehrt das moralische Recht ab, jene in die Schranken zu weisen, denen es seiner Auffassung nach an dieser beispielhaften Selbstlosigkeit mangelt. So setzt jeder seine Interessen mit dem moralischen Rechtsbewusstsein durch, dass damit zugleich ein unmoralisches Subjekt die ihm gebührende Quittung erhalte. Für dieses Selbstbewusstsein der Rechtschaffenheit und diese Selbstdarstellung ist Moral allerdings gut und dies stellt auch keinen Missbrauch derselben dar. In diesem Sinne hat ja auch Nietzsche festgestellt, dass das Lob der Selbstlosigkeit „jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen“ ist (Nietzsche 1960, 53).
Nietzsche und Hegel haben den Nachweis erbracht, dass es gar keinen Missbrauch von Moral geben kann. Vielmehr kann nahezu jede Handlung gleichermaßen als Verstoß gegen moralische Prinzipien wie als deren Verwirklichung dargestellt werden. Jede Gewalt kann als gerechte Bestrafung eines bösen Menschen, der diese verdient hat, behauptet werden, so unglaubwürdig das auch in einzelnen Fällen erscheinen mag. Solche unglaubwürdigen Fälle bestehen in Züchtigungen „unfolgsamer“ Kinder, die ohnehin von Kindesmissbrauch kaum zu unterscheiden sind, wobei der Anspruch auf bedingungslosen Gehorsam bereits einen Akt der Gewalt darstellt. Für Gewalt, die nicht bloß der Notwehr dient, gibt es ohnehin kein Argument und man muss sich daher fragen, wie ein Erwachsener in die Lage kommen soll, einem Kind gegenüber Notwehr anwenden zu müssen. Dennoch sind ertappte Übeltäter um moralische Selbstdarstellungen hier selten verlegen. So hat auch der berüchtigte Josef Fritzl, der seine Tochter im Keller seines Hauses in Amstetten 24 Jahre lang gefangen hielt, seine Fürsorge als eines der Motive seines Handelns ausgegeben, sodass man schon beinahe geneigt gewesen wäre, von einem tragischen Fall von Überbehütung zu sprechen.
Die Verdienste Hegels und Nietzsches um die Kritik der Moral habe ich ja bereits ausführlich in meinem Buch „Ewig lockt die Bestie“ (Loidolt 2015) vorgestellt, auf welches ich daher hier verweisen will. Dort wird auch das Geheimnis gelüftet, wie die einen sich souverän der Moral bedienen, um ihren finanziellen und sozialen Status als gerechten Lohn ihrer Verdienste um das allgemeine Wohl darzustellen, während andere die ihnen aufgenötigte materielle Bescheidenheit als Ausweis ihrer moralischen Vortrefflichkeit gewürdigt wissen wollen. Letztere halten sehr viel von der Macht der Moral, ist diese doch die einzige, die sie noch zu besitzen glauben. Darauf sind sie dann ähnlich stolz wie auf ihre Teilhabe an einer Nation, die zu den Ordnungsmächten dieser Welt zählt.
Literatur
- Otfried Höffe: Ethik – Eine Einführung. München 2013.
- Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kant-Werke (hg. von W. Weischedel), Bd. IV, Darmstadt 1983.
- Georg Loidolt, Ewig lockt die Bestie – Eine Kritik der Moralphilosophie. Wien 2015.
- Georg Loidolt, Begehrte Dogmen und ihre unerwünschte Widerlegung. Wien 2016.
- MG – Marxistische Gruppe, Immanuel Kant – Königsberger Klöpse. (Reihe Kritik bürgerlicher Wissenschaft) München 1990, online: http://gegenstandpunkt.com/mszarx/phil/kant/kantix….
- Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, in: ders.: Werke (hg. von K. Schlechta), Bd. I, 2. Aufl., München 1960.
Internet
- Die Adresse der Website von Georg Loidolt lautet: http://lektoratsprofi.com/.
- Weitere Texte zur Kritik der (Moral-)Philosophie finden sich unter: http://www.wissenschaftskritik.de/.
- Von Peter Decker gibt es jetzt eine technisch verbesserte Version des Vortrags-Mitschnitts „Die Moral – Das gute Gewissen der Klassengesellschaft“ (2005). Die Gesamtaufnahme steht als Download unter http://www.argudiss.de/node/244 zur Verfügung.
Sinn und Sittlichkeit
„Die Fragestellung nach dem Sinn des Lebens ist offenbar nur dem Menschen zu eigen.“ (Wikipedia) Das kann man nicht bestreiten. Ob man sich die Frage aber stellen muss, schon. Dazu ein Statement von Neg. Sohdorf.
Dass Religionen sowie Sinnsuche und -stiftung aller Art nach der wissenschaftlichen „Entzauberung der Welt“ (Max Weber) und der weitgehenden technischen Beherrschung der Natur nicht abgestorben sind, sondern weiterhin, zunehmend auch öffentlich in der bürgerlichen Gesellschaft grassieren, verweist auf den Tatbestand, dass dort ein entsprechendes individuelles und gesellschaftliches Bedürfnis verankert ist. Vom Studenten oder Unternehmer über den Berufsphilosophen bis hin zum Ministerpräsidenten und Papst sind sich alle einig in der Wertschätzung von Sinn:
- Ein 24 Jahre alter Student: „The meaning of life is about spreading my genes.“ (Süddeutsche Zeitung, 11.10. 2004)
- „Wir beobachten eine zunehmende Suche nach Sinn und Werten nach Jahren der Säkularisierung“. (Carel Halff, Geschäftsführer der Verlagsgruppe Weltbild, Westdeutsche Zeitung, 29.4. 2005)
- Für den Philosophen Nicolai Hartmann ist die Sinnfrage die „vielleicht lebensmächtigste Frage“: „Die Ablehnung einer sinnwidrigen Welt darf vielleicht überhaupt als stärkste Triebfeder der Metaphysik gelten.“ (Historisches Wörterbuch der Philosophie 1995, 822)
- Peer Steinbrück, damals Ministerpräsident von NRW: „Beide christlichen Kirchen sind wichtig für eine Werte- und Sinnstiftung in unserer Gesellschaft.“ Beide Institutionen geben dadurch „unserer Gesellschaft Stabilität“. (Westdeutsche Zeitung, 23.4. 2005)
- Benedikt XVI. alias Joseph Ratzinger formulierte seine Wertschätzung der Sinnfrage so: „Der Sinn ist das Brot, wovon der Mensch im Eigentlichen seines Menschseins besteht. Ohne das Wort, ohne den Sinn, ohne die Liebe kommt er in die Situation des Nicht-mehr-leben-könnens, selbst wenn irdischer Komfort im Überfluss vorhanden.“ (Ratzinger 1968, 47)
Warum das so ist und welche unterschiedlichen Gründe der Wertschätzung im Einzelnen vorliegen, soll im Folgenden geklärt werden. Dabei kann man allgemein festhalten: Sinnsuche und erfolgreiche Sinnfindung erfüllen – so die vorweggenommene Schlussfolgerung der Überlegungen – den Tatbestand des Selbstbetrugs. Der enthält folgenden Widerspruch: Verteilen sich beim ordinären Betrug noch Vorteilnahme und Schaden auf zwei Protagonisten – der Betrüger hat schließlich den Betrogenen durch „Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen“ (vgl. StGB, § 263) mit einem falschen Bewusstsein in bestimmter Hinsicht versorgt und daraus seinen Vorteil gezogen –, so ist der Selbstbetrug ein Ein-Personen-Stück, in dem der Protagonist sowohl den Betrüger als auch den Betrogenen in einer Person gibt. Wo immer es zur Aufführung kommt, also tagtäglich, findet es jede Menge Freunde, auch von Seiten der verschiedenen Abteilungen des „objektiven Geistes“ (so Hegels zusammenfassender Titel für Recht, Moralität und Sittlichkeit), die diese Sorte Umgang mit sich selbst gutheißen, fordern und fördern. Warum ist das so?
Jeder kommt zu dem Seinen?
Zur Beantwortung der Frage nach der andauernden Sinnsuche und -stiftung ist ein Blick auf die Lebensweise der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft angebracht. Sie werden in eine Gesellschaft mit einer vergleichsweise fix und fertigen Ordnung geboren, sie genießen Grundrechte, die der Staat seinen Bürgern gewährt und auf die er sie festlegt. Wesentliche Grundrechte sind die persönliche Freiheit, die Gleichheit und das private (materielle wie geistige) Eigentum – siehe die einschlägigen Artikel 2, 3 und 14 des Grundgesetzes.
Mit dem Recht auf Freiheit anerkennt der bürgerliche Staat in gewisser Weise den freien Willen seiner Bürger, dem er zugleich Vorschriften macht. Er erkennt ihn als abstrakt freien Willen an – so wieder Hegel, der in seiner Rechtsphilosophie schreibt: „Der abstrakte Begriff der Idee des Willens ist überhaupt der freie Wille, der den freien Willen will.“ (Hegel 1970, 79). Unter Absehung von allen weiteren Bestimmungen des Willens erlaubt der Staat das Wollen und Handeln seiner Bürger unter der Bedingung, dass sie dabei das von ihm gesetzte Recht akzeptieren. Damit macht sich der Staat zur Existenzbedingung des sich frei betätigenden Willens. Es gilt der Wille mit seinen Zwecken, soweit sie erlaubt sind; er gilt nicht, wenn sie unerlaubt sind – Verfolgung und Bestrafung sind hier die Konsequenz. Anders gesagt: In der bürgerlichen Gesellschaft betätigen die Bürger ihre anerkannte Freiheit, indem sie sich gehorsam ans Recht halten.
Die Hauptauflage, die der Staat als rechtlich kodifizierte Bedingung erlässt, ist die Anerkennung des Eigentums. Den Bürgern ist es erlaubt, ja sogar geboten, ihren Interessen nachzugehen und ihr Glück zu machen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sie die Rechtsvorschriften des Staates respektieren. Das heißt, dass sie ihre Interessen nur nach Maßgabe der Mittel verfolgen dürfen, über die sie als Eigentümer verfügen. Ein Gebot ist dies deshalb, weil jeder Bürger für sich sorgen muss, weil sich der Staat für das materielle Wohl seiner Bürger unzuständig sieht – zunächst jedenfalls, als Sozialstaat kümmert er sich später um die, die ihre materielle Reproduktion systembedingt nicht hinkriegen.
Die unter den bürgerlichen Rechtsprinzipien von Freiheit, Gleichheit und Eigentum lebenden Bürger verfolgen – so wie ihre jeweiligen Mittel und das Gesetz es erlauben – ihre materiellen Interessen, d.h., sie versuchen, an Geld als das allgemeine und anerkannte Zugriffsmittel auf Reichtum aller Art heranzukommen, und begegnen sich dabei als freie Eigentümer auf dem Markt. Da zeigt sich ein entscheidender Unterschied. Die einen verfügen über Geld und Produktionsmittel, die andern nur über sich selbst, also über ihre Arbeitsfähigkeit. Diese bloßen Eigentümer eines Arbeitsvermögens sind doppelt frei. Sie sind weder Sklaven, gehören also keinem Herrn, der sich um sein lebendiges Eigentum kümmert, noch verfügen sie über die Verwirklichungsmittel ihrer Arbeit, sind davon 'freigesetzt'. Die Produktionsmittel befinden sich in der Hand der Eigentümer, denen ihrerseits Arbeitskräfte fehlen, um den vorhandenen materiellen Reichtum zu erhalten bzw. zu vermehren.
Auf der einen Seite gibt es also Eigentümer, die Arbeitskräfte brauchen, auf der anderen Seite der Form nach ebenfalls Eigentümer, denn diese können genau so etwas in den Äquivalententausch einbringen, nämlich ihre Arbeitskraft. Letztere sind dem Inhalt nach aber Eigentumslose, da sie nicht über Geld bzw. über die Verwirklichungsmittel ihrer Arbeit verfügen – wobei diese Trennung kein historischer Zufall und auch nicht das Werk einer Vorsehung ist, sondern, wie Marx formulierte, „in die Annalen der Menschheit eingeschrieben (ist) mit Zügen von Blut und Feuer.“ (MEW 23, 743). Wenn sich nun beide Parteien auf dem Markt treffen, müsste doch bei den Anliegen dieser freien Bürger etwas zusammen gehen, könnte man denken. Und so ist es ja auch. Beide mit gleichen Rechten ausgestattete Seiten – es gilt ja Gleichheit vor dem Gesetz – treffen sich auf besagtem (Arbeits-)Markt und handeln je nach ihren Interessen Kontrakte aus, in denen jeder sein Interesse einbringt. Dabei beziehen sich beide auf den Staat als den Garanten des Vertragsrechts: „Kein Vertrag ohne das Schwert“ (Thomas Hobbes)!
Die eine Seite bietet Arbeitsplätze, die andere Seite Arbeitskraft (= Leistungsbereitschaft und -vermögen). Beide kontrahieren darüber frei und gleichberechtigt im Arbeitsvertrag. So scheinen beide zu bekommen, was sie wollen. Die einen wollen einen Gewinn erzielen, die anderen einen Lohn erhalten. Damit geht die Produktion von Waren los. Die einen stellen sie her und bekommen dafür einen Lohn, die andern lassen sie herstellen und versilbern sie mit Gewinn auf dem Markt. Alles scheint harmonisch und gerecht zuzugehen. Doch der Schein trügt, wie im Grunde jeder weiß. Die Zwecke beider Klassen gehen unterschiedlich auf. Was im Arbeitsvertrag als Äquivalententausch unterstellt und anerkannt war, zeitigt sehr unterschiedliche Resultate. Das verweist auf den Tatbestand, dass im Arbeitsvertrag eben nur der Form, nicht dem Inhalt nach Äquivalente getauscht werden, vielmehr ein bestimmtes Quantum Geld (Lohn) gegen die Quelle von Geld überhaupt (Arbeitskraft) hingegeben wird. Deshalb bewegen sich die Einkommen der Unternehmer (und ihrer Funktionäre: der Manager) in einer ganz anderen Klasse als die der gewöhnlichen Arbeitnehmer.
Praktisch geht das so: Die Klasse der Eigentümer stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, was sie sich als besondere Dienstleistung an der Klasse der Arbeit Suchenden hoch anrechnen lässt. Kriterium der Einrichtung von Arbeitsplätzen ist die Spekulation auf Gewinn. Ob ein Suchender einen solchen Platz findet und somit an einen Lohn kommt, hängt ganz von den Kalkulationen der so genannten Arbeitgeberseite ab. Entscheidend dafür ist der zu erwartende Gewinn, also die Differenz zwischen dem vom Arbeitgeber geleisteten Vorschuss zur Finanzierung der Warenproduktion und dem durch Verkauf der Waren auf dem Markt erzielten Überschuss in Geld. Wird der zu erwartende oder realisierte Gewinn für zu gering befunden oder bleibt er ganz aus, werden erst gar keine Arbeitsplätze eingerichtet, bestehende abgebaut oder in ihren Anforderungen an die Arbeitskraft so umgebaut, dass sie einen Gewinn abwerfen.
Da der Gewinn das entscheidende Maß ist, kommt andauernd alles auf den Prüfstand, was zu seiner Erzielung verausgabt wird. Kosten für Grund und Boden, Maschinerie, Rohstoffe, Hilfsstoffe etc. und Lohnkosten werden ständig am Markt verglichen und ihr Anteil an den Stückkosten möglichst gesenkt. Lohn, das Lebensmittel der Arbeitnehmer, ist für die Unternehmerseite der spezielle Kostenfaktor, der bezogen auf die Stückkosten ständig gesenkt werden muss, um mit der geringeren Kost pro Stück auf dem Markt gegen die Konkurrenten, die nichts anderes machen, zu bestehen. Für die Arbeitnehmerseite heißt das, dass sie dauerhaft in ihrer Existenz bedroht ist und um ihre Existenzmittel kämpfen muss. Die Lohnabhängigen werden den Widerspruch im Lohn, der für sie das einzige Lebensmittel und für ihre Anwender ein Kostenfaktor ist, dessen Höhe über Anwendung oder Nichtanwendung ihrer Arbeitskraft entscheidet, auch mit staatlich gewährtem Tarifrecht und Gewerkschaften einfach nicht los. Jede neue Tarifrunde legt davon Zeugnis ab.
Im Resultat und Durchschnitt wird die Klasse der Eigentümer immer reicher und die der abhängig Beschäftigten oder Eigentumslosen tritt im besten Fall auf der Stelle bzw. wird im Verhältnis zum produzierten gesellschaftlichen Reichtum immer ärmer. Arbeitnehmer bzw. ihre verschiedenen Anwälte beklagen das als ungerecht und wenden sich an den Staat. Von ihm fordern sie mehr Verteilungs- und Chancengerechtigkeit und halten dabei unbeirrt (und relativ unbelehrbar) am Lohnsystem und Eigentum fest. Warum ist das so? Dazu im Folgenden einige Hinweise.
Vom Materialismus zum höheren Streben
Ausgangspunkt der Überlegung war das Freiheitsgebot des Staates, der damit jedem Untertanen, also auch dem lohnabhängigen, das Recht zusprach, auf der Grundlage des jeweiligen Eigentums und unter Respektierung der bestehenden Gesetze den privaten Materialismus zu verfolgen und sein Glück zu machen. Weil sie im Verkauf der Arbeitskraft das Mittel zur Bestreitung ihres Lebens sehen (müssen), wollen die lohnabhängig Beschäftigten aus eigenem Interesse für Lohn, d.h. für den Reichtum anderer arbeiten. Dass sie neben ihrem Lohn zugleich den Reichtum der anderen Seite herstellen, ist anerkannt und entgeht ihnen nicht. Ihnen erscheint aber in der Regel das Lohnarbeitsverhältnis, das sie aktiv suchen und wollen, gar nicht als das, was es ist: als die Herrschaft des Staates und der Unternehmer-Klasse über sie (vgl. Krölls 2014, 11; Krölls 2007, 14ff).
Für moderne Arbeitnehmer ist der gerechte Lohn für ein gerechtes Tagewerk die Leitlinie. Demgemäß machen sie sich per Ausbildung und Lebensführung zurecht, halten sich für ihren Dienst bereit und sehen im Lohn das Mittel, das – eigentlich – dafür taugen muss, einen gerechten Anteil am großen „Kuchen“ des produzierten gesellschaftlichen Reichtums zu erlangen. Sich dienstbar zu machen unter Inkaufnahme des eigenen Schadens – früher einmal in bestimmten Kreisen ganz selbstverständlich Ausbeutung genannt –, ist also in der bürgerlichen Gesellschaft so organisiert, dass die Ausnutzung der Arbeitskraft in eins fällt mit der Verfolgung der eigenen Interessen der Ausgebeuteten. Damit und auf solche Weise ist das falsche Bewusstsein dieser Klasse grundgelegt. Indem beide Klassen ihre von Staatsseite erlaubten und anerkannten Interessen betätigen und bei deren Verfolgung notwendiger Weise in Widerspruch zueinander wie untereinander geraten, brauchen sie zur Klärung solcher Widersprüche das Recht und die Gewalt des Staates – darüber hinaus aber auch fürs Gelingen des großen Ganzen eine dazugehörige Moral: Alle sollen sich ans Sittengesetz halten, damit die Gegensätze befriedet werden und die Rechnungen aufgehen. Wer in der Sittlichkeit lebt und ihr gemäß seine subjektive Freiheit betätigt, anerkennt die allgemein gültigen Prinzipien, die in einer Gesellschaft herrschen, als eine höhere Notwendigkeit. Wenn er in Übereinstimmung mit Recht und Moral handelt, zollt ihm die Gesellschaft ihrerseits dafür Anerkennung. Welche materiellen Resultate damit abgesegnet werden, wurde oben ausgeführt.
Bei der am Recht und der dazu passenden Moral orientierten Verfolgung der eigenen Interessen und Zwecke im Reich der Freiheit – auf dem Markt – kommt es regelmäßig für die Mitglieder beider Klassen, jedoch ganz augenscheinlich viel häufiger und systembedingt für die der Eigentumslosen, zu Negativerfahrungen: Die Marktteilnehmer sind unzufrieden, weil ihre Interessen nicht aufgehen. Weil dies aber nach ihrer Auffassung von Rechts wegen eigentlich gelingen müsste – schließlich war Äquivalententausch der Ausgangspunkt –, drängt sich ihnen die Frage nach dem Warum auf. Um mit den Resultaten der gewährten Freiheit, die flächendeckende Unzufriedenheit nach sich zieht, ideell zurechtzukommen, sind jetzt Antworten gefragt. Und hier gewährt der bürgerliche Staat seinen Bürgern als Erstes ein weiteres Grund- oder Menschenrecht: die Freiheit der Meinungsäußerung (GG, Art. 5), die zur Artikulation von Unzufriedenheit genutzt werden darf und soll.
Die geistigen Anstrengungen, die angestellt werden, um die gestellte Frage zu beantworten, produzieren in der Regel Ideologien, d.h. notwendig falsches Bewusstsein. Notwendig sind die anfallenden Erklärungen, weil sie nicht zufällig auftreten, sondern systemischen Gründen folgen; falsch sind sie, weil sie sich über den in Frage stehenden Sachverhalt täuschen und ihm nicht auf den Grund gehen. Weil die Akteure der marktwirtschaftlichen Konkurrenzordnung in der Sittlichkeit leben und ihre Freiheit nutzen wollen und so die Identität von bürgerlicher Freiheit und Unterwerfung verkennen bzw. die eingerichteten Freiheitsverhältnisse nicht als letzte Ursache des Scheiterns ihrer Interessen wahrhaben wollen, brauchen, produzieren und konsumieren sie jede Menge Rechtfertigungswissen. Das kommt in vielfältigen Darbietungsformen (Nationalismus, Moral, Philosophie, Psychologie, Religion, esoterische Formen der Sinnfindung…) unter Anleitung von Schule, Universität, Medien, Kirchen daher.
Die Vielfalt der Sichtweisen und Meinungen – Eigentum und sein Schutz sind ein Segen; Leistung lohnt sich; Misserfolg liegt an mangelnder Leistungsbereitschaft oder fehlender Fähigkeit; ohne Moos nichts los; Ausländer raus, Deutschland den Deutschen… – hat einen gemeinsamen Nenner, sie trägt dazu bei, am Willen zur gelebten Sittlichkeit festzuhalten. Sie hilft, unsachliche Erklärungen für das Scheitern oder Nichtaufgehen der eigenen Zwecke aufrecht zu halten. Die Konsequenzen mögen unterschiedlich sein. Man stürzt sich womöglich in falsche (nationalistische, rassistische) Kämpfe oder hält sich als schöne Seele für moralisch sauber und die andern für Schweine. Jedenfalls sind es stets die anderen, die sich nicht an die Regeln halten und dadurch Verwerfungen ins System bringen, die man selbst auszubaden hat. Der ganze Bestand der gesellschaftlich durchgesetzten Ideologien gehört in die Abteilung Sinnstiftung im weiteren Sinne. Die Sinnsuche, die Sinnangebote und die Sinnfindung im engeren Sinne ergänzen nur das gewöhnliche Rechtfertigungswissen als ein Angebot an all die, die damit nicht zufrieden sind und individuell für sich mehr beanspruchen.
Weil die Resultate des tagtäglichen Einsatzes enttäuschend und unbefriedigend sind, verlangen die Betroffenen nach einem Weiß-warum und finden es in der Regel auch im vorhandenen Sinnangebot, sodass sie sich mit den beklagten Resultaten arrangieren können. Dabei wird die Suche nach Sinn übrigens klassenübergreifend betrieben. Natürlich haben die Mitglieder der verschiedenen Klassen für ihre Unzufriedenheit unterschiedliche Gründe. Der lohnabhängig Beschäftigte hat in der Regel zu viel zu leisten, zu wenig Geld und eine unsichere Einkommensquelle, muss sich und seine Angehörigen also dementsprechend einschränken. In dem Sinne hat der gut situierte Bürger kein Problem. Ob sein Geld aber ausreicht, um im Vergleich mit Seinesgleichen zu bestehen, und ob sein geschäftliches Engagement noch genügend Zeit lässt für ein befriedigendes Privatleben, ist gar nicht ausgemacht. Im Prinzip hat der Reiche weniger objektive Gründe für seine Unzufriedenheit als der Arme, steht diesem aber in seiner subjektiven Unzufriedenheit in nichts nach, wie Boulevard-Blätter und der rege Besuch von teuren Psychologen etc. zeigen.
Die Sinnsucher werden auch relativ leicht fündig, denn es ist ziemlich einfach, einen Sinn im Leben zu finden. Das liegt nicht so sehr am umfangreichen und überzeugenden Sinnangebot, das gemäß der Nachfrage in Umlauf gebracht wird, sondern am Begriff des Sinns selbst. Inwiefern? Sinn ist – so ein philosophisches Lexikon – der „Wert und die Bedeutung (das Interesse), die eine Sache oder ein Erlebnis für mich und andere hat. Im Unterschied zum Wesen gehört der S. nicht zur Sache selbst, sondern er wird ihr vom Menschen beigelegt, so dass eine Sache für den einen Menschen sinnvoll, für den andern sinnlos sein kann, oder für mich heute sinnvoll und ein Jahr später sinnlos.“ (Schischkoff 1974, 602) Wer über den Sinn einer Sache oder eines Erlebnisses spricht, geht nicht auf ihre Erklärung, das „Wesen“, ein. Wer nach ihrem Sinn sucht, will nicht die Beschaffenheit der speziellen Gegenstände ermitteln, sondern sortiert sie bzw. ihr Vorkommen durch seine subjektive Deutung nach Maßgabe seines Interesses in seinen Geisteshorizont ein.
Nehmen wir das Erlebnis des Jobverlustes: Wer ihn sich erklären wollte, müsste notwendiger Weise auf die Kalkulationen der Unternehmerseite mit der Arbeitskraft zu sprechen kommen und würde sich dann als deren abhängige Variable begreifen. Denn (Mit-)Arbeiter werden freigesetzt, weil ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert, ins Ausland verlegt oder wegen Betriebsaufgabe vernichtet wurde, weil die Betreffenden in ihrer Einsatzfähigkeit (Alter, Krankheit) oder ihrem Einsatzwillen für die Unternehmerseite unbefriedigend waren. Und das heißt, es geht stets, in der einen oder anderen Form, um die Profitabilität des Geschäfts. Der Betroffene ist mit Grund frustriert, er verliert schließlich die Geldquelle, auf die er angewiesen ist. Er könnte jetzt einen Schluss darauf ziehen, dass Lohnarbeiter zu sein kein Glück, sondern ein Pech ist (wie Marx schreibt, vgl. MEW 23, 532), gegen das man sich praktisch aufstellen müsste. Mag sein, dass er die Erklärung sogar nachvollzieht und den Schluss theoretisch teilt. Wenn er sich dann aber damit zu trösten beginnt, dass seine sozialstaatlich betreute Arbeitslosigkeit – die ja mit einschneidendem Geldmangel verbunden ist – auch in der einen oder anderen Hinsicht positiv gesehen werden kann (mehr Zeit für Kinder, Partner, Schrebergarten o.ä.) und das in den Vordergrund rückt, macht er einen Übergang. Wenn er sich diese Vorteile einleuchten lässt, gewinnt er seiner Arbeitslosigkeit einen Sinn ab und versöhnt sich halbwegs mit ihr – halbwegs deshalb, weil dies seine materielle Notlage praktisch nicht zum Verschwinden bringt. In der charakterisierten Denkweise dokumentiert sich vielmehr ein Wille, der trotz negativer Erfahrungen nicht mit den eingerichteten Verhältnissen brechen, sondern sich mit ihnen als seiner Heimat arrangieren will.
Wie die Deutung der Sache oder des Erlebnisses geht, kann dem obigen Beispiel ebenfalls entnommen werden. Sie ist vom Inhalt her ziemlich willkürlich und hängt ganz vom Bedürfnis des Subjekts ab, das einen Sinn sucht. Da der Sinn und seine Zuweisung nicht zum Begriff der Sache oder des Erlebnisses gehören, sondern in die subjektive Freiheit des Sinnsuchers fallen, kann der Sinn alles Mögliche sein und x-beliebige Gestalt annehmen. In jedem Fall sorgt er für eine gewisse Art von geistiger Befriedigung. Dabei unterliegt der Sinn allerdings dem Vorbehalt, dass die in ihm gefundene Rechtfertigung nicht die Grundlage dafür abgeben darf, sich über die geltenden Rechtsverhältnisse zu erheben. Solange sie sich der bestehenden Rechtsordnung unterordnet und sie als Ganzes nicht infrage stellt, darf jede Art Sinnstiftung mit Toleranz rechnen.
Der Markt der Sinnstiftung und Lebensbewältigung
Es lassen sich mehrere große Abteilungen der Sinnsuche und Sinnfindung unterscheiden, denen je nach sozialem Status und Bildung gefrönt wird: Die schlichten Sinnangebote (Mutter sein, Schalke-Fan…), die Sinnangebote der Religion, der Sinn, den die psychologische Weltanschauung liefert, oder die vornehm tuende Sinnstiftung als Philosophie und Metaphysik.
- In den Kindern den Sinn des Lebens zu entdecken, ist meist, aber nicht nur bei Frauen verbreitet. Ihnen wird dabei von höherer Stelle Recht gegeben: „Kinder zu haben, ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs eine zentrale Sinngebung des Lebens.“ (Süddeutsche Zeitung, 27.11. 2015) Bei solchen Menschen dreht sich ihr ganzes Sinnen und Trachten um den (zahlenmäßig heutzutage meist spärlichen) Nachwuchs. Fast jede Härte des Alltags wird wegen der Kinder ertragen. Opfer werden gebracht und alles für den Erfolg des Nachwuchses getan. Ist dieser dann in Schule und Hochschule erfolgreich, erfüllt das die Eltern mit Stolz und Glücksgefühlen. Misserfolg stürzt sie in Trauer und Verzweiflung. Der zufällige Tod eines Kindes, etwa durch ein Verbrechen, oder ein andauerndes familiäres Zerwürfnis zerstören nicht selten die psychosoziale Lebensgrundlage der Eltern; das Leben verliert seine Grundfesten: „'Das eigene Kind durch diese entsetzlichen Umstände (Mord, d. Verf.) zu verlieren, zu Grabe zu tragen und den Verlust lebenslang zu ertragen', lasse ihn nach dem Sinn des Lebens fragen, sagt Uwe R. vor Gericht mit stockender, leiser Stimme.“ (Westdeutsche Zeitung, 31.5. 2016) Psychologen, Psychiater und Geistliche sind dann gefragt…
- Die Zumutungen der Arbeitswoche nimmt der Fußballfan hin, weil am Wochenende seine Mannschaft wieder aufläuft, mit der er und seinesgleichen sich – trotz der oft gewaltigen Einkommensunterschiede zu den Fußballstars – identifizieren. Und das so sehr, dass sie bereit sind, mit ihrem Verein durch Dick und Dünn zu gehen. In Gesängen, Kleidung und Transparenten demonstrieren sie ein Höchstmaß an Identifikation und Vereinstreue, das keine Kosten scheut. Hier zählt das Aufgehobensein im Kollektiv der Gleichen, die Teilhabe an den rituellen Abläufen in der Nord- oder Südkurve, die kollektive Trauer in der Niederlage, der Glücksrausch des Sieges, der auch schon mal zum biographischen Höhepunkt erklärt wird („Das ist so toll, das ist neben meinem Sohn der größte Moment meines Lebens“ – ein Fan von Leicester City im Video-Clip von Kicker-TV „Das Wunder ist perfekt und Leicester feiert“, YouTube, 3.5. 2016). Dazu gehört oft die lebenslange Treue zum eigenen Verein wie die lebenslange aggressive Ab- und Ausgrenzung von konkurrierenden Vereinen und ihren Fankollektiven, deren provokante Äußerungen sachgerecht als Schmähungen verstanden werden und zu Fan-Schlägereien führen. All das erfüllt das Herz eines Fans so sehr, dass er darin den Sinn seines Lebens sieht, der ihn vollständig entschädigt und die Zumutungen und Enttäuschungen des Arbeits- und sonstigen Alltagslebens vergessen macht – zumindest am Wochenende, wenn er ein ganz anderer wird. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten: „Auf Schalke ist Fußball eine Religion“ (Brandt 2004, 165), um am Ende doch zu bezweifeln, ob die Fan-Gemeinde im Fußball eine ebenso tiefe Sinnstiftung erleben kann, wie sie der religiöse Kultus bietet.
- Die Religion (vgl. Huisken 2008) ist eine zum System entwickelte und von einer Gemeinde gelebte Denkweise, die auf Glaubenssätzen beruht und deren rationale Überprüfung zurückgewiesen wird. Eine solche Prüfung gilt den Gläubigen als Hochmut und Eitelkeit gegenüber der undurchschaubaren Weisheit des höchsten Herrn. In der Religion wird die Welt verdoppelt in ein Diesseits, in dem wir leben und uns scheinbar frei gemäß den Regeln der Religion oder unabhängig von ihr betätigen, und eine jenseitige Welt, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Doch alles, was in der ersten Welt geschieht und so aussieht, als sei es zweckmäßiges Menschenwerk, ist für den Gläubigen in Wahrheit das Werk des allmächtigen höchsten Willens. Hat jemand Erfolg im Leben, soll er dem höchsten Herrn dafür dankbar sein. Anscheinend hat er den göttlichen Erwartungen gemäß gehandelt. Ist es anders herum und hat sich Misserfolg eingestellt, dann hat er wohl die Gebote des Herrn nicht ernst genommen und nun die Quittung dafür bekommen. Hat er das Gebotene nach eigener Einschätzung sehr wohl beachtet und trotzdem Misserfolg, kann eine von Gott gewollte Prüfung vorliegen, der man sich würdig erweist, indem man gläubig durchhält. Denn „dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden!“ Was auch immer geschieht, in allem waltet der Wille des höchsten göttlichen Herrn, was der Gläubige zwar nicht immer mit seinen (begrenzten) menschlichen Verstandesmitteln nachvollziehen kann – und ihn auch manchmal in Zweifel am „lieben Gott“ stürzt –, dem er sich aber freudig ergeben soll. Denn am allerhöchsten Willen kommt keiner, ob Weltmachtführer oder Kellner, vorbei. Wer durch die Brille des Glaubens die reale Welt und seine Erfahrungen mit ihr betrachtet, hat für alle ihm in die Quere kommenden Nöte und Probleme und die sich daraus ergebenden Fragen – vor jedem anderen Erklärungsversuch – eine Antwort. Wo das einmal nicht gelingt, bekennt man sich bescheiden und demütig als schwaches Licht, das nicht in der Lage ist, den unendlichen Willen des Herrn zu durchleuchten, weshalb der umso mehr anerkennungswürdig ist. Insofern ist die Religion die perfekte Sinnmaschine. Und weil dem Staat als dem wirklichen Herrn auf Erden Scheitern und Unzufriedenheit der großen Mehrheit seiner Bürger bekannt sind und er die Betreuung ihres Willens für notwendig hält, schätzt er die Leistungen der Religion. Bedingung seiner Anerkennung ist allerdings, dass die Religionen sich mit Grundgesetz, Art. 4 (Religionsfreiheit), arrangieren und ihre praktische Unterordnung unters staatliche Gesetz anerkennen. Die Funktion der Religionen, für deren katholische und evangelische Kirchen der deutsche Staat dankbar die Steuern einsammelt, besteht neben der praktischen Mildtätigkeit (Caritas und Diakonie) in der Bereitstellung von Orientierung im unübersichtlichen Leben und Trost für die Gebeutelten. Wo beides von anerkannten Glaubensvereinen institutionell, d.h. dauerhaft gegeben bzw. gespendet wird, verweist das auf entsprechend orientierungsdefizitäre und trostlose gesellschaftliche Verhältnisse. Die gläubige Denkweise hilft bei deren Aushalten und stellt zugleich eine jenseitige Entschädigung in Aussicht. Dieses äußerst reduzierte Zugeständnis an den Materialismus der Menschen verweist noch einmal auf den sehr weltlichen Grund der Religionen und ihre weltliche Bedeutung: Sie trösten die Unzufriedenen in ihrer Not, indem sie diese als Werk des Höchsten deuten und Kompensation in Aussicht stellen, wenn man die Gründe für Unzufriedenheit geduldig erträgt und im Glauben fest bleibt. So tragen die großen Glaubensgemeinschaften ihren Teil zum Gelingen stabiler Herrschaft bei.
- Die Gefolgschaft der Religionen und ihrer Kirchen ist zumindest in Deutschland ziemlich zurückgegangen (siehe www.Kirchenaustritt.de). Parallel dazu hat sich mit der Psychologisierung der Moral ein Kult des Selbstbewusstseins entwickelt, der zwar mit der demütigen Haltung des Gläubigen unvereinbar ist, im Resultat aber auch nichts anderes zustande bringt als Rechtfertigungswissen (vgl. Krölls 2016). Unterwirft sich der gläubige Wille bedingungslos dem Willen des Höchsten, verlangt die moderne psychologisierte Moral die unbedingte Anerkennung des Selbstbewusstseins. Diese Denkweise unterstellt die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse als die Sphäre, in der jeder zu dem Seinen kommen kann, wenn er sich nur redlich darum bemüht. Wer dieses Dogma teilt – warum das Erfolgsstreben nicht für alle aufgehen kann, wurde oben erklärt – und mit unbefriedigenden Resultaten zu kämpfen hat, verlangt nach Erklärung. Die diesbezüglichen Beiträge der religiösen Vereine sind zwar nicht von der Hitliste verschwunden, aber von der psychologischen Weltanschauung auf weiter hinten liegende Ränge verdrängt worden. Sie führt das Scheitern der Konkurrenzbürger in Beruf und Privatleben auf je eigene Defizite im Seelenhaushalt zurück, die allerdings durch therapeutische Eingriffe behoben werden können. Damit ist nicht versprochen, dass sich dann Erfolg automatisch einstellt – wie auch, er liegt ja fast durchweg nicht in der Hand der Betroffenen. Therapieziel ist vielmehr, die Betroffenen zu einem Verständnis ihrer selbst zu bringen, das sie zur Bedingung ihres (Miss-)Erfolgs erklärt: Misserfolg resultiert aus seelischer Störung, Erfolg wird zurückgeführt auf seelische Tüchtigkeit bzw. ein Gleichgewicht. Dieses herzustellen oder, wenn es nicht gelingt, die fehlende innere Balance als Grund des eigenen Scheiterns anzuerkennen und sich damit selbstbewusst zu arrangieren, ist die Leistung der psychologisierenden Denkweise. Wo die Religion das Weiß-warum des Aushaltens aller Drangsale ins Jenseits verlegt, schafft es die psychologische Denkweise, die Harmonie der Seele schon im Diesseits anzubieten. Auf diese Weise erweitert sie das Sinnangebot kolossal. (Für die Psychologen sind Sinn und Sinnstiftung, Sinnerweiterung oder Sinnaustausch ein Mittel ihrer therapeutischen Wahl. Ein ausdrückliches Bekenntnis zu dieser Vorgehensweise hat Viktor E. Frankls sogenannte Dritte Wiener Schule der Psychologie abgelegt: Sie hält Sinn für das bedeutendste Lebensmittel und sein Abhandenkommen für den seelischen Krankheitsgrund schlechthin. (Vgl. Frankl 1990)
Metaphysik – die Methodologie der Sinnsuche
Der Wille zum Sinn bestimmt nicht nur das Alltagsbewusstsein, sondern ebenso das gelehrte Bewusstsein, insbesondere der Philosophenzunft. Ihre Metaphysik-Entwürfe waren schon immer Sinn-Märchen zum Zweck der Rechtfertigung gesellschaftlicher und staatlicher Verhältnisse. Sie bedienten damit das Sinnbedürfnis von Menschen gehobener Bildung und sind weiterhin als Fundgrube für Zitate bei feierlichen Staatsaktionen oder entsprechenden Sonntagsreden gefragt. Für das Alltagsbewusstsein sind solche intellektuellen Sinn-Märchen nicht verfasst worden. Es hat dafür keinen Bedarf, weil es mit Rechtfertigungswissen schon immer ausreichend versorgt ist. Die diesbezügliche Orientierungslosigkeit des Alltagsmenschen ist eine Philosophenerfindung.
Dabei ist das Bemerkenswerte an der Philosophie nicht einmal ihre Affirmation des alltäglichen Sinnbedürfnisses. Das macht sie nebenbei, sie gibt in ihrem Namen den Dummheiten des Alltagsbewusstseins recht. Sie pflegt vielmehr den Wahn einer Verantwortung für das große Ganze und inszeniert sich zur maßgeblichen Institution für den richtigen Umgang mit der Sinnfrage. Dabei fühlt sich die Metaphysik auch berufen, die Einzelwissenschaften zu kritisieren. „Während wissenschaftliche Erkenntnisse auf je einzelne Gegenstände gehen, (…) handelt es sich in der Philosophie um das Ganze des Seins, das den Menschen als Menschen angeht, um Wahrheit, die, wo sie aufleuchtet, tiefer ergreift als jede wissenschaftliche Erkenntnis.“ (Jaspers 1958, 10) Ohne an irgendeiner Wissenschaft irgendetwas zu kritisieren, wird ihnen generell ein Mangel attestiert: Es gehe ihnen nur um die Erkenntnis der Gegenstände und nicht um deren Einordnung ins große Ganze. Das wissenschaftliche Defizit besteht also darin, keine Metaphysik zu sein und sich so aus der Verantwortung für das zu stehlen, was den Menschen als Menschen angeht, nämlich die Sinnfrage zu beantworten.
Die Fragen und Themen der Metaphysik sind weit gefasst. „Als Gegenstände der Metaphysik gelten insbesondere: Sein, Nichts, Freiheit, Unsterblichkeit, Gott, Leben, Kraft, Materie, Wahrheit, Seele, (Welt-)Geist, Natur. Das Fragen nach diesen Problemen macht die geistige Art des Menschen aus und ist insofern, mit Kant, ‚unhintertreibliches Bedürfnis’ des Menschen.“ (Schischkoff 1974, 428) Es soll sich hierbei um „geballte Ladungen“ (Marquart 1978, 88) handeln, schließlich geht es bei der Metaphysik um „nichts Geringeres (…) als das ganze Deutungs- und Sinnstiftungs- und Tröstungssystem der abendländischen Tradition“ (Frank 1993, 84); „deshalb gehören diese Probleme in die Obhut der Metaphysiker“ (Marquart 1978, 88). Denn ohne sie „reden nur noch Dichter, Prediger und Betrunkene von Gott, Gemüt und Welt. Eine Regelung, die das erreicht, kann nicht vernünftig sein.“ (Specht 1987, 176)
Die modernen Metaphysiker halten sich dagegen für die Garanten eines professionellen, insofern seriösen und korrekten Umgangs mit den Themen Gott, Freiheit, Unsterblichkeit der Seele etc. Denn sie „sind die einzigen Menschen, bei denen – weil sie es gelernt haben – man sich darauf verlassen kann, dass sie mit ihnen (den Problemen der Metaphysik, d. Verf.) nicht fertig werden: sie lösen die Probleme nicht, sie lassen aber auch nicht ab von ihnen und liquidieren sie nicht: beides wäre viel zu gefährlich: darum auch ist das Nichfertigwerden kein Mangel, sondern eine Qualität.“ (Marquart 1978, 88) Neben der Hochschätzung der eigenen Bedeutung – die Metaphysik ist der Damm gegen die Flut des Nihilismus der falschen geistigen Führer, und der professionelle Metaphysiker ist der Deichgraf, dem die Überwachung des Damms zukommt – verrät der Philosoph auch einiges darüber, wie der korrekte Umgang mit den metaphysischen Problemen auszusehen habe: Gelöst werden dürfen sie nicht, weil sie sich seit Kant als unlösbar herausgestellt haben; so viel wissen die modernen Metaphysiker. Fallen lassen darf man sie aber auch nicht. Denn dann bliebe das allenthalben verbreitete und gerade von den Metaphysikern als ihre Daseinsnotwendigkeit angesehene und anerkannte Sinnbedürfnis unbetreut. Vielmehr sollen sie in der Schwebe gehalten werden durch methodologische Überlegungen von „höchsten Rationalitätsansprüchen“ darüber, wie Metaphysik noch möglich ist, sodass die Hoffnung genährt wird, doch einen Weg zu finden, Glaubensinhalte als Wissensinhalte erweisen zu können.
Wie Metaphysik noch möglich ist, stellt das Hauptthema der Metaphysik seit Kant dar. Darauf hat es verschiedene Antworten gegeben, die jedoch letztlich gleichgültig sind – gemessen an der Tatsache, dass immer Metaphysik das Thema ist. Dass sie tausendfach kritisiert wurde und dennoch immer noch gefragt ist, wird als Beweis genommen, dass man als Mensch um Metaphysik nicht herumkommt. Indem die moderne Metaphysik-Apologie sich nicht die Mühe macht, das von ihr unbedingt anerkannte Faktum des Bedürfnisses nach Sinn rational zu erklären – und das wäre etwas anderes als die Überhöhung zum anthropologischen Faktum, wie sie seit Kant verbreitet ist, nämlich das Begreifen einer affirmativen Geisteshaltung zu einer als widersprüchlich erfahrenen Welt –, macht sie als eine moralisch, psychologisch und staatsbürgerlich inspirierte Denkungsart eine intellektuelle Daueranstrengung, die zu keinem Ende kommt, weil rational eine „Versöhnung mit der Welt“ auf allen Ebenen nicht zu haben ist. Ihre Gegenstände bleiben Projektionen des subjektiven Geistes. Dagegen halten die Freunde der Metaphysik ihren Rationalitätsfortschritt, den sie in der Geschichte ihrer Kritik und Selbstkritik entdeckt haben wollen (vgl. die Einleitung I von Geyer in: Oelmüller 1983). Doch so urteilen nur Parteigänger der Metaphysik. Deren Kritik hat dagegen den Nachweis der Fehlerhaftigkeit der metaphysischen Denkweise und der Unwirklichkeit, Erfundenheit und Bodenlosigkeit ihrer Gegenstände erbracht.
Das Geschäft und die Aufgabe der modernen Metaphysiker soll ihrem eigenen Verständnis nach darin bestehen, den Menschen neben den Religionen, die ihr Fundament im Glauben haben, „rationale“ Beiträge zur „Kontingenzbewältigung“ (Ruth Dölle-Oelmüller) anzubieten. Kontingenz – darunter versteht man gewöhnliche Zufälligkeit, die im Gegensatz zur Notwendigkeit steht – gilt in dem Zusammenhang als der Gegenbegriff von Sinn. Weil die Menschen in eine kontingente Welt geboren sind, sollen sie das Bedürfnis nach Sinn haben, worum sich die Metaphysik kümmert. Abgesehen von der fehlenden Überzeugungskraft des Übergangs von der Kontingenz der Welt zur Metaphysik – praktisch ist die Kontingenz für das Werktagsleben der Menschen völlig irrelevant –, ist der Gedanke als solcher eine petitio principii. In der Realität gibt es nirgendwo Kontingenz. Alles hat seinen Grund bzw. seine Ursache. Kontingenz als Problem entspringt allein der metaphysischen Sicht auf „Mensch und Welt“. Es gibt sie nur im subjektiven Urteil des Sinnsuchers, der keinen guten Grund zum Einverständnis weiß und an dessen Stelle die Kontingenz des Vorhandenen beklagt. Diese hat also ihren Ursprung im metaphysischen Bedürfnis und keinen sachhaltigen Grund, sie ist das Resultat eines Denkfehlers.
Um mit der von ihr erfahrenen Kontingenz fertig zu werden, bemüht sich die moderne Metaphysik, den Sinnsuchern „philosophisches Orientierungswissen“ (Willi Oelmüller) zur Verfügung zu stellen. „Metaphysik heute wäre also für mich, wenn sie gelingt, die gesuchte Wissenschaft, die letzte inhaltliche Antworten zu geben versucht auf die Frage nach letzten Orientierungen für das Erkennen, Handeln und Erleiden des Menschen.“ (Oelmüller 1983, 167) Von welcher Art und Qualität ein solches Orientierungswissen ist, davon hier eine Kostprobe: Manfred Frank ist einer der Berufsphilosophen, der sich öffentlich Sorgen um die heutige Sinn-Versorgung der Bevölkerung macht. Er konstatiert mit dem Ableben der Metaphysik eine gesellschaftliche Situation, die durch Sinnkrise und „transzendentale Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács) gekennzeichnet sei. Der Metaphysik wird (in Anlehnung an die romantische Kritik) vorgerechnet, dass sie Opfer ihrer selbst sei, weil ein ihr innewohnender destruktiver Zug – gemeint ist der analytische, d.h. auflösende, zersetzende Geist – den Geltungsanspruch synthetischer Weltbilder, Positivitäten, Traditionen, Totalitäten zerstört habe. „Allen voran (…) wird die Formation des Feudalismus geschleift: Ihr Anspruch, die bürgerlichen Massen ‚von Gottes Gnaden’ (also aufgrund einer religiösen Legitimation) zu regieren und auszubeuten, erweist sich vor dem Richterstuhl der analytischen Vernunft als haltlos.“ (Frank 1993a, 80)
Nun könnte man meinen, dass die modernen Bürger dem Zerstörungswerk der analytischen Vernunft durchaus applaudieren; schließlich soll sich die Menschheit bis dahin aus lauter ideologischen Gründen in ihre Verhältnisse geschickt haben, wobei man allerdings von den maßgeblichen, d.h. gewalttätigen Nötigungen ihrer Herrschaft vornehm absehen muss. Nach dem „Tod der sozialen Bindekräfte tradierter Hochreligionen und der von ihnen verbürgten Daseinsorientierung“ (ebd., 82) hätten die betroffenen Menschen ja endlich einmal Gelegenheit, sich ganz sachlich ihren praktischen Lebensverhältnissen zuzuwenden und sie so einzurichten, dass sie jedem Gesellschaftsmitglied gleichermaßen nützlich und durchschaubar sind; dann würden sich auch ihre Verhältnisse von selbst verstehen und bräuchten nicht eine Legitimation neben dem befriedigten Materialismus ihrer Mitglieder. Sind es doch erst die erfahrenen Schäden, die Menschen nach Legitimation, Trost, Sinn etc. rufen lassen. Die Endlichkeit des menschlichen Lebens, die vielen als Hauptmotiv der Sinnfrage gilt, ist natürlich ein unbestreitbares Faktum. Erklären lässt sie sich aus physiologischen Gesetzmäßigkeiten. Aber etwas zu problematisieren, dass sicher feststeht, ist absurd. Das Faktum fordert vielmehr dazu heraus, sich für befriedigende Inhalte der begrenzten Lebenszeit stark zu machen, sich z.B. nicht schädlichen Benutzungs- und Herrschaftsinteressen zu unterwerfen. Dann könnte es durchaus dazu kommen, am Ende alt und lebenssatt aus dem Leben zu scheiden.
Der gesicherte Nutzen, der befriedigte Materialismus fragt nicht nach Tröstung und Orientierung: ein Gedanke, der Frank nicht geläufig ist. Das Bedürfnis nach Sinn und Rechtfertigung erscheint ihm vielmehr als eine vom realistischen Blick auf die Geschichte diktierte Konstante des menschlichen Daseins. Deshalb hält er – mit den Argumenten des Romantikers Friedrich Schlegel – der Aufklärung vor, „dass sie mit dem unhaltbaren Legitimationsanspruch falscher Positivitäten zugleich den Gedanken der Legitimierbarkeit von Lebens- und Sozialverhältnissen als solchen aus der Welt schaffe. (…) Fortan lebt die bürgerliche Gesellschaft in einem Rechtfertigungsvakuum.“ (Ebd., 82) Nichts davon ist wahr: Die Rechtfertigung der bürgerlichen Verhältnisse geht eben nicht mehr (nur) religiös, sondern über das politische Credo von Freiheit und Demokratie. Da wird sogar noch die Herrschaft über die Bürger zu ihrem freien, weil durch Wahlen zustande gebrachten Werk. Und die Psychologie stiftet eine Hinterwelt, die Gründe dafür liefert, warum die Betätigung in den Freiheitsverhältnissen für viele keine genießbaren Resultate erbringt – wo man seines Glückes Schmied ist, wird auch das fehlende Glück zum eigenen Werk. Kirche und Schule, Kultur und Feuilleton leisten ihr Übriges.
Auch an dem im Gefolge der deutschen Romantik konstatierten Verlust wäre nichts bedauerlich, wenn es nichts zu rechtfertigen und niemanden zu trösten gäbe. Den entgegengesetzten Zustand unterstellt Frank jedoch, wenn er feststellt, dass „die Sinnforderungen der Bürger (…), schritthaltend mit den Konformitätsforderungen des funktionierenden Staats an seine Bürger beständig spürbarer (werden) und (…) sich heute bereits als Krisenpotential (enthüllen).“ (Ebd., 93) Der BRD gebricht es „an einem Gefühl der Verbindlichkeit des Sinnes, wie es das war, was die Romantiker im Namen der Mythologie einforderten.“ (Frank 1993b, 44) Unter Anspielung auf die – sich selbst zugeschriebene oder eingebildete – Verantwortung für das Gemeinwesen stellt sich der Philosoph die Frage, „ob es eine Möglichkeit zur (Wieder-)Herstellung kollektiver Identität, d.h. zur Rettung einer Beglaubigungsfunktion für politische Herrschaft diesseits des Glaubens an Werte geben kann, wie die es sind, für die früher die Religion einstand.“ (Frank 1993a, 92) Und er bejaht sie in Übereinstimmung mit Kant, der die Realität des Bedürfnisses nach Metaphysik bei Zurückweisung ihrer bis dahin gebotenen Antworten hervorhob und für eine „gute Metaphysik“ plädierte. Das „ist ein Denken ‚über Metaphysik’ im Blick auf eine Reform und (nicht-destruktive) Modifikation ihrer begrifflichen Mittel, so dass sie wieder Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben könne.“ (Ebd., 101)
Dabei weiß Frank, „dass wir in Traditionen leben, die ein (…) Ausgriff aufs Absolute nicht zu entmachten vermag. Mithin können quasi-religiöse Begründungsansprüche nicht die Natur faktischer, sondern nur die kontrafaktischer Annahmen haben.“ (Ebd.) Das Absolute als Faktum wurde von der Aufklärung theoretisch und von Napoleon praktisch entmachtet, so wurde durch die Trennung von Thron und Altar die Kirche dem Staat untergeordnet. Deshalb ziehen (quasi-)religiöse Begründungsansprüche, die als ihr Fundament die Realität Gottes behaupten, im „christlichen Abendland“ – anders als hier und da in der islamischen Welt – nicht mehr. Mithin müssen sie, sofern man sie dennoch will, kontrafaktische, gegen die Wirklichkeit gerichtete, also selbst unwirkliche, auf die Wirklichkeit der Subjektivität begrenzte, eben moralische Werte sein.
Die Bestimmung, eine gegen die Wirklichkeit gerichtete Annahme zu sein, kommt dem Wert, dem Woraufhin des moralischen Tuns, seiner eigenen Logik nach immer zu. Er ist das Nicht-Seiende, aber Sein-Sollende, „welches das Seiende rechtfertigt.“ (Ebd., 99) Insofern reicht das Kontrafaktische, das Nicht-Existierende, aber durchaus Erwünschte als Fundament für eine Ethik aus: „Das, was sein soll, ist nie gegeben, sondern aufgegeben.“ (Ebd.) Wie im Falle Gottes sei die kontrafaktische Unterstellung bestimmter verbindlicher Werte (z.B. Gerechtigkeit) als unbedingt gültige nicht durch Verweis auf die Faktizität zu verifizieren, wohl aber ist die faktische Unterstellung dieser Werte bei denen überprüfbar, die an diese Werte glauben und ihr Handeln an ihnen messen lassen wollen. Dieser praktische Glaube gibt, so Frank, dem Handeln eine unbedingte Verbindlichkeit und offenbart „die quasi-religiöse Mitgift in der Rede vom Kontrafaktischen“ (ebd.).
Von der Unterstellung des Kontrafaktischen bis zu Kants praktischem Glauben ist es dann nur noch ein Katzensprung: Moral ist unabdingbar für das Funktionieren des Gemeinwesens, sich aber unbeirrt an sie zu halten zugleich eine ziemliche Zumutung für den moralischen Menschen, weil die eigenen Interessen dabei ziemlich beschnitten werden. Damit die moralische Kalkulation vom Nutzenstandpunkt aus nicht nur ins Leere läuft, wird eine Gratifikation des moralischen Handelns im Jenseits in Aussicht gestellt. Das impliziert notwendig die Annahme der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes. Also sollen wir aus moralischen Kalkulationen genötigt sein, die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele zu postulieren. Hier verrät sich diese Art Denken als durch und durch funktionalistisch. Damit die Bürger auf Linie bleiben, brauchen sie Moral; und weil die Moral den Nützlichkeitserwägungen auf Dauer nicht standhält, braucht es letztlich Gott und die ihn nahelegende Metaphysik als letzte Trostspenderin unzufriedener, aber anpassungswilliger Köpfe. Von diesem Kaliber sind die Hilfestellungen der Metaphysiker für elitäre Sinnsucher und das Gemeinwesen der Gegenwart.
Literatur
- Thomas Brandt, Auf Schalke ist Fußball eine Religion. In: Wilhelm Schwendemann u.a. (Hrsg.), Sport und soziale Arbeit, Bd 2. Freiburg 2004.
- Manfred Frank, Metaphysik heute. In: ders., Conditio moderna. Leipzig 1993a.
- Manfred Frank, Zwei Jahrhunderte Rationalitätskritik und die Sehnsucht nach einer ‚neuen Mythologie’. In: ders., Conditio moderna. Leipzig 1993b.
- Viktor E. Frankl, Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. 8. Auflage, München 1990.
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt/M. 1970.
- Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9. (Zitat: Nicolai Hartmann, Teleologisches Denken, 1951) Darmstadt 1995.
- Freerk Huisken, Staat und Kirche. 9.12.2008, Online: http://www.fhuisken.de/.
- Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie. München 1958.
- Albert Krölls, Das Grundgesetz – ein Grund zum Feiern? Hamburg 2007.
- Albert Krölls, Der freie Wille unter dem Regime von Recht, Psychologie und Hirnforschung. Vortragstext vom 23.05.2014.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. 3., aktualisierte und erweiterte Neuauflage, Hamburg 2016.
- Odo Marquart, Skeptische Betrachtungen zur Lage der Philosophie. In: Hermann Lübbe (Hrsg.), Wozu Philosophie? Stellungnahmen eines Arbeitskreises. Berlin/New York 1978.
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx Engels Werke, Band 23, Berlin 1977 (zit. als MEW 23).
- Willi Oelmüller/Ruth Dölle-Oelmüller/Carl-Friedrich Geyer, Diskurs: Metaphysik – Philosophische Arbeitsbücher 6. Paderborn u.a. 1983.
- Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum. München 1968.
- Georgi Schischkoff, Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart 1974.
- Rainer Specht, Über drei Arten von Metaphysik, In: Willi Oelmüller (Hrsg.), Metaphysik heute? Paderborn u.a. 1987. S. 170 - 201
Mai 2016
Das Ende der Sowjetunion
Im Mai 2016 erschien Reinhard Lauterbachs Buch „Das lange Sterben der Sowjetunion“ über die Politik des letzten KPdSU-Generalsekretärs Michail Gorbatschow und das Ende des realen Sozialismus. Dazu einige Anmerkungen von Johannes Schillo.
Reinhard Lauterbach, der früher als Redakteur bei verschiedenen Sendeanstalten der ARD (z.B. als Auslandskorrespondent für die Ukraine und Weißrussland) tätig war, berichtet seit 2014 regelmäßig für die Tageszeitung Junge Welt über Vorgänge in Russland und Osteuropa. Im Mai 2016 ist sein neues Buch „Das lange Sterben der Sowjetunion – Schicksalsjahre 1985-1999“ erschienen, das sich als „journalistischer Essay“ (Lauterbach 2016, 20) versteht, also im strikten Wortsinn als ein Versuch, „die Geschichte des Verfalls und Untergangs der Sowjetunion als die Geschichte einer wachsenden Unzufriedenheit der sowjetischen Führung mit der von ihr selbstgestalteten Gesellschaftsordnung zu erzählen“ (ebd., 13f). Es sind natürlich Zweifel angebracht, ob es sinnvoll ist, die Analyse des welthistorischen Unikums der Abdankung einer „Supermacht“, die fast ein Jahrhundert lang mit globalem Geltungs- und Gestaltungsanspruch auftrat, als Erzählung anzulegen. Schon in Lauterbachs vorletztem Buch über den „Bürgerkrieg in der Ukraine“ (2014) machte sich ein Missverhältnis zwischen historischen Erzählungen – beginnend mit „der altrussischen Hypatiuschronik des späten 12. Jahrhunderts“ (Lauterbach 2014, 16), fortgeführt mit der ukrainischen Früh- und der späteren Sowjetgeschichte, dann der detaillierten Chronik von Euro-Maidan bzw. Donbass-Aufstand – und dem analytischem Ertrag auf ein paar nachgelieferten Seiten des „Ausblicks“ bemerkbar.
Doch die Anlage des neuen Essays und die vielen zeitgeschichtlichen Details, die der Autor auch hier wieder beibringt, sollen im Folgenden kein Thema sein. Vielmehr geht es um die Kernthese, wie sie der Prolog des Buchs ankündigt und wie sie dann sukzessive – unterbrochen durch verschiedene Insiderberichte, Funktionärs-Porträts, eine ergreifende Tschernobyl-Störfall-Schilderung etc. – ausgeführt wird: also um die Beantwortung der Frage, warum die SU von den Verantwortlichen, allen voran KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow, zugrunde gerichtet wurde. Der Essay hält ja korrekter Weise fest (Lauterbach 2016, 7), dass für den Untergang der SU kein Aufstand von unten, sondern ein Beschluss von oben maßgeblich war, und er fährt fort: „Dass Spitzenpolitiker ihr eigenes Land demontieren, kommt in der Geschichte eher selten vor, und so stellt sich die Frage: Warum haben sie das getan, entgegen der historischen Erfahrung?“ (Ebd., 9) Die Berufung auf die historische Erfahrung, gegen die die bolschewistische Partei übrigens schon 1917 verstoßen hatte, ist etwas merkwürdig, und man muss auch nicht Putin folgen, der den Zusammenbruch der SU, wie Lauterbach zitiert (ebd., 20), als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete.
Wichtig ist vielmehr, dass Lauterbach einschlägige Verschwörungs- und Verratstheorien auseinander nimmt und die Fixierung auf die Person Gorbatschows zurückweist. Die Führung von Staat und Partei habe sich vielmehr in den 1980er Jahren – wenn auch nicht geschlossen, so doch mit ausreichender Unterstützung bei Funktionären und Bevölkerung – entschieden, dem Land „eine andere Staatsräson“ (ebd., 14) zu verpassen, wobei sie sich am Gegenbild des real existierenden Kapitalismus orientierte. Leiten ließen sich die Führungskader dabei, wie Lauterbach schreibt, von der sozialen Marktwirtschaft der BRD, „die sie nicht als historische Ausnahme durchschauten“ (ebd., 14), sondern als tragfähiges Modell für die Reform ihres Systems adaptieren wollten. Sie erkannten nicht, so Lauterbach, dass die bundesdeutsche Marktwirtschaft „in der Existenz des Realsozialismus ihre Voraussetzung hatte, weshalb ihre sozialen Elemente auch Schritt für Schritt geschleift wurden, als der Gegenentwurf im Osten von seinen eigenen Führern aufgegeben worden war.“ (Ebd., 15) Diese spezielle Blindheit, die Lauterbach der KP-Führung attestiert, ist allerdings eine eigenartige Sache. Bei der „Sozialen Marktwirtschaft“ handelt es sich bekanntlich um eine Etikettierung, mit der deutsche Politiker nach 1945 die Wiederherstellung kapitalistischer Normalverhältnisse betrieben und sich – bei Gelegenheit – von unschönen, brutalen Formen etwa eines angelsächsischen Kapitalismus distanzieren, ja als Verfechter eines dritten Wegs präsentieren.
Aber diese Distanzierung dürften die realsozialistischen Führer durchschaut haben. Sie wussten, dass die BRD ihnen als Teil des kapitalistischen Blocks gegenüberstand. Was sie bewunderten, war die Effizienz des Kapitalismus überhaupt, wie Lauterbach auch im Rückblick auf Lenin oder Stalin festhält. Zudem ist die Aussage fragwürdig, dass die sozialen Elemente in Deutschland nach der Wende deshalb „Schritt für Schritt geschleift wurden“, weil die östliche Konkurrenz weggebrochen sei. Vielmehr wurde der Sozialstaat benutzt – siehe den Weg von den Bündnissen für Arbeit der 1990er Jahre bis zur paradigmatischen Entscheidung der Agenda 2010 –, um ein neues Armutsniveau der Lohnarbeit herbeizuführen, das in der Konkurrenz der Kapitalstandorte Vorteile bringen sollte und ja in der Tat gebracht hat. Mit dieser Politik setzte die rotgrüne Politik Maßnahmen fort, die bereits in der Kohl-Ära begonnen worden waren. Ob die Agenda-Politik bei Bestehen des Ostblocks in dieser Form hätte durchgezogen werden können, ist eine müßige Frage. Die BRD hatte ja auch mit der Entstehung der Massenarbeitslosigkeit in den 1970er Jahren kein großes Ordnungs-Problem – also zu einer Zeit, als noch eine DDR existierte, die beständig (siehe Karl-Eduard von Schnitzlers „Schwarzer Kanal“) auf die Arbeitslosigkeit als horrendes Westproblem hinwies…
Lauterbach ist bewusst, dass das Problem viel grundsätzlicher ist. Die Frage der sozialen Marktwirtschaft wird auch nicht weiter verfolgt. Statt dessen geht es um den grundlegenden Sachverhalt, dass die Sowjetunion nach dem Verständnis der Parteiführung von vornherein eigentlich „kein Gegenentwurf zum Kapitalismus, sondern ein Konkurrenzmodell sozialer Gestaltung“ war (ebd., 15). So erwähnt Lauterbach die berühmte Formel Chruschtschows, man werde den Kapitalismus bald einholen und überholen – was von Honecker später zu „Überholen ohne einzuholen“ umformuliert wurde (vgl. Tauchert 2015). Lauterbach bringt die Losung als Beleg für den Respekt der russischen Kommunisten vor dem Kapitalismus und für deren Täuschung, „der Unterschied der Gesellschaftsformationen (wäre) einer in der Arbeitsproduktivität, der Sozialismus also eine Steigerung des Kapitalismus“ (Lauterbach 2016, 39). Somit laute „die wirklich spannende Frage: Wie viel 'Gegen' war eigentlich in diesem Entwurf wirklich enthalten?“ (Ebd., 15) Zu dieser Kernfrage im Folgenden einige Bemerkungen, und zwar aus Anlass einer aktuellen Rezension von Junge-Welt-Chefredakteur Arnold Schölzel, die den Hauptpunkt von Lauterbachs Analyse eher verdunkelt als erhellt.
Gegner oder Rivale des Kapitalismus?
Lauterbach, schreibt Schölzel, „greift durchgängig, vor allem aber im ersten Kapitel ('Der Sozialismus als Dauerbaustelle. Die Vorgeschichte der Perestroika'), mit Bezug auf Stalins Schrift 'Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR' aus dem Jahr 1952 eine theoretische Frage auf: Welche Rolle spielten das Wertgesetz und Elemente der Marktwirtschaft im sowjetischen Sozialismus. Lauterbach beantwortet die Frage nicht eindeutig, meint aber offenbar, dass ihre Nichtbearbeitung zu jenem wirtschaftlichen Desaster beigetragen hat, mit dem das Ende der Sowjetunion eingeleitet wurde. Er charakterisiert jedenfalls seinen Band als einen Versuch, 'die Geschichte des Verfalls und Untergangs der Sowjetunion als die Geschichte einer wachsenden Unzufriedenheit der sowjetischen Führung mit der von ihr selbst gestalteten Gesellschaftsordnung zu erzählen'. Der Kern seiner Argumentation sei [ist?], 'dass Gorbatschow und sein künftiger Außenminister Edward Schewardnadse und die übrigen 'Reformer' einen Parteiflügel repräsentierten, der dem Land eine andere Staatsräson verpassen wollte'.“ (Schölzel 2016) Das ist ein eigenartiges Referat von Lauterbachs Argumentation, nachdem Schölzel einleitend einige Bemerkungen über den Autor und die Anlage des Buchs gemacht hat.
Und auch was danach in der relativ langen, fast ganzseitigen Rezension folgt, bringt nicht mehr viel zu der eigentlich interessierenden Frage. Lauterbachs Zurückweisung der Verrats-These wird ausführlich referiert (anscheinend ist das für JW-Leser wichtig). Dann folgen Bemerkungen über die Durchsetzung der Perestroika-Strategie; so wird der von Lauterbach bemühte Vergleich mit der von Naomi Klein beschriebenen „Schockstrategie“ (Lauterbach 2016, 16) zustimmend aufgegriffen. Der sowjetische „Komplementärfall“ (ebd.) zur neoliberalen Politik ist jedoch nur in einer oberflächlichen Hinsicht mit den westlichen Politstrategien vergleichbar, wobei natürlich stimmt, dass auch die politischen Befürworter der Perestroika die Polit-Rhetorik von einem Weg, der ohne Alternative ist, beherrschten (vgl. Afanassjew 1988). Schölzel geht dann ausführlicher auf den „Faktor Pech“ (Lauterbach 2016, 18) ein, also auf besondere historische Umstände der 1980er Jahre, die Gorbatschows Projekt in die Quere kamen: auf den Fall des Ölpreises, auf das Reaktorunglück von Tschernobyl und auf das große Erdbeben in Armenien vom Dezember 1988. Lauterbach hat diese Umstände eigens gewürdigt, obwohl sie zu der zentralen Frage nach dem Grund des Systemwechsels nichts Wesentliches beitragen. Eher könnten sie als eine Entschuldigung der Perestroika-Strategen gelesen werden…
Schölzels abschließende Bemerkungen halten fest, dass Gorbatschow für das Auseinanderbrechen der Sowjetunion die Voraussetzungen geschaffen habe, „aber konkret gehandelt habe zum Schluss Boris Jelzin“ (Schölzel 2016). Und die „Richtungsentscheidung 'mehr Markt' und 'weg mit dem Plan' habe die unbeabsichtigte Nebenfolge gehabt, dass die Nationalitätenprobleme 'zu nicht vorgesehener Schärfe' eskalierten“ (ebd.), wie er aus dem Buch zitiert. Das Fazit der Rezension lautet dann: „Lauterbachs Buch wird von den grundsätzlichen Fragen getragen, die er aufwirft und denen er, gestützt auf die reale Entwicklung, nachgeht, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. Er beendet es mit der Szene aus Brechts 'Flüchtlingsgesprächen', in der Ziffel und Kalle auf den Sozialismus anstoßen. Nüchtern, realistisch, aber nicht ohne Leidenschaft.“ (Ebd.) Das ist ein etwas formelles Lob, gerade auch angesichts der oben zitierten Feststellung des Rezensenten, dass Lauterbach die Frage nach der Rolle von Wertgesetz und Marktwirtschaft im sowjetischen Sozialismus nicht eindeutig beantworten wollte oder konnte.
Dabei ist das Gegenteil der Fall: Lauterbachs Rückgriff auf Stalins Ökonomie-Schrift von 1952 will zu einer Antwort auf diese zentrale Frage hinführen. Und der Essay äußert sich auch eindeutig dazu, warum ein solcher Rückgriff (der später noch auf Leninsche Positionen ausgeweitet wird) notwendig ist. Der Systemwechsel vom Ende der 1980er Jahre habe nämlich die Konsequenz aus einem Widerspruch gezogen, der den realen Sozialismus von Anfang an kennzeichnete und der von Stalin verbindlich festgeschrieben wurde: „Gorbatschows Entscheidung der späten 1980er, den Sozialismus mit Hilfe von immer mehr kapitalistischen Elementen zu 'retten', ist im Kern in dem begriffslosen Räsonieren Stalins angelegt“ (Lauterbach 2016, 27). Das „Nichtbearbeiten“ des Widerspruchs war demnach nicht das Problem, sondern das entschiedene Festhalten daran, dass Sozialismus mit dem Wertgesetz gemacht werden müsse.
Und, wie gesagt, „Stalin war mit dieser Verwechslung“ – dass man mit der sozialistischen Anwendung des Wertgesetzes die Effizienz des Kapitalismus importieren könne, ohne sich dessen Übel einzuhandeln – „nicht originell. Schon seit Lenin hatten die sowjetischen Kommunisten zum Kapitalismus ein zwiespältiges Verhältnis. Sie trennten ihn analytisch in einen 'faulenden' und einen 'fortschrittlichen' Teil.“ (Ebd., 37f) Die Produktivität des Kapitalismus habe „den sowjetischen Kommunisten von Anfang an Respekt“ abgenötigt, und zwar „so sehr, dass sie sie – das war dann schon Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow – 'einholen und überholen' wollten.“ (Ebd., 39) Lauterbach verweist dann ausdrücklich darauf, dass dies eine Revision der Marxschen Kapitalismuskritik bedeutet (Sozialismus als Steigerung des Kapitalismus…). Dabei hält er auch fest, dass man es hier nicht mit einer theoretischen Bestimmung zu tun habe, die den Auftakt zu einer Debatte unter Kommunisten bildete. Es handelte sich vielmehr um eine „mit der politischen Autorität der Partei und ihres Führers in die Wirklichkeit gezwungene Aufforderung, Unvereinbares zu vereinbaren: eine geplante Ökonomie mit Instrumenten zu verwirklichen, die im Kapitalismus unter dem Zwang der Konkurrenz zur Perfektion entwickelt wurden und getrennt von diesem nicht existieren.“ (Ebd., 40f)
Lauterbach fasst dies am Schluss – in seinem Epilog, bevor er zu der Frage kommt, ob durch das Ende der Sowjetunion der Sozialismus gegenstandslos geworden sei – noch einmal in aller Deutlichkeit zusammen (ebd., 203). Zu Grunde gerichtet habe die Sowjetunion ihre letzte Führungsmannschaft. Der Grund dafür lag aber nicht in einem Verrat prinzipienloser Kader, in einer weltgeschichtlichen Dynamik oder in einem maroden System, das nicht mehr lebensfähig gewesen wäre, sondern in einem Standpunkt, der von Anfang an im realen Sozialismus anerkannt war: in der Bewunderung der Masse an staatlich verwendbarem Mehrprodukt, das der Kapitalismus hervorbringt, und in der fälschlichen Annahme, die Methoden der Erzeugung dieses Mehrprodukts seien systemneutral und könnten für eine 'sozialistische Akkumulation' genutzt werden. Dieser Standpunkt brachte über die Jahrzehnte hinweg, so das Fazit, immer wieder Reformbestrebungen hervor, den Sozialismus durch kapitalistische Modernisierungsmaßnahmen auf Vordermann zu bringen – und schließlich „reformierten Gorbatschow und Genossen so lange am Sozialismus herum, bis es nichts mehr zu reformieren gab.“ (Ebd.)
Die am Schluss genannte Konsequenz ergibt sich natürlich nicht automatisch. Immerhin hat die Sowjetunion mit ihrem Bündnissystem den Widerspruch ihres politökonomischen Systems rund 70 Jahre lang praktiziert – und hätte das möglicher Weise, falls die NATO ihr die Chance gelassen hätte, auch noch weitere Jahrzehnte lang fortgeführt. Die Partei musste hier schon der Parole vom „Einholen oder Überholen“ des Kapitalismus eine neue Deutung geben, aber eben auf Grundlage der allgemein anerkannten Systemrivalität. Der reale Sozialismus hatte sich zwar zu einer Produktionsweise entschlossen, „die ganz den 'Werktätigen' zu Gute kommen, die 'private Aneignung' des gesellschaftlichen Produzierens sowie die 'Anarchie' des Marktes beenden sollte“, doch gleichzeitig „verkündete man lauthals, man wolle sich an den Maßstäben und Bilanzen des feindlichen Systems messen (lassen)“. (Tauchert 2015, 233) Es lag also „ein eigenartiger Fall von Kapitalismuskritik vor, denn wie hätte man sonst umstandslos in einen 'Wettbewerb der Systeme' einsteigen können? Wäre der Zweck der Produktion wirklich ein anderer gewesen, hätte man sich doch nicht auf ominöse Größen wie das marktwirtschaftlich ausschlaggebende 'Wirtschaftswachstum' (also die Addition von allem, was Geld gekostet hat) beziehen und die Parteigänger der 'Profitmaximierung' mit den eigenen Planungserfolgen beeindrucken können?“ (Ebd.)
Wie und mit welchen Begründungen bzw. Erwartungen die Konsequenz zur Auflösung des systemeigenen Widerspruchs gezogen wurde, wäre im Einzelnen zu analysieren. Von marxistischer Seite liegt dazu die umfangreiche Aufsatzsammlung von Karl Held (1992) vor, auf die auch Lauterbach verweist. Zum nachfolgenden Zerstörungsprozess der Sowjetunion und ihres Bündnissystems hat z.B. Olaf Steffen (1997) eine sehr ins Detail gehende Studie vorgelegt, die Boris Jelzin als gelehrigen Schüler der marktwirtschaftlichen Ideologien und Vollstrecker der vorausgegangenen Reformanstrengungen charakterisiert: Die Implementierung der „Schocktherapie“, die den ökonomischen Niedergang Sowjetrusslands als Führungsmacht besiegelte, war nicht einfach ein Bruch mit der ursprünglichen Perestroika, sondern folgte der Idee, sich die überlegene kapitalistische Produktivität nutzbar zu machen, und zwar in diesem Fall mittels der Ausmischung der unfähigen Staatsbürokratie aus dem Wirtschaftsleben. Auch wenn hier einzelne Punkte noch diskussionswürdig oder klärungsbedürftig sind, kann man als Fazit zu Lauterbachs Buch festhalten, dass es sich, anders als von Schölzel behauptet, nicht um die Beantwortung der grundlegenden Fragen herumdrückt.
Literatur
- Juri Afanassjew (Hg.), Es gibt keine Alternative zu Perestroika: Glasnost, Demokratie, Sozialismus. Nördlingen 1988.
- Karl Held (Hg.), Das Lebenswerk des Michail Gorbatschow – Von der Reform des realen Sozialismus zur Zerstörung der Sowjetunion. München 1992.
- Reinhard Lauterbach, Bürgerkrieg in der Ukraine – Geschichte, Hintergründe, Beteiligte. Berlin 2014.
- Reinhard Lauterbach, Das lange Sterben der Sowjetunion – Schicksalsjahre 1985-1999. Berlin 2016.
- Olaf Steffen, Die Einführung des Kapitalismus in Rußland – Ursachen, Programme und Krise der Transformationspolitik. (Osteuropa – Geschichte, Wirtschaft, Politik, Band 16) Hamburg 1997.
- Arnold Schölzel, Mörder, Totengräber, Scharlatan? Reinhard Lauterbachs Buch über Gorbatschows Perestroika und die Folgen. In: Junge Welt, 28./29./30.5.2016.
- Hans-Joerg Tauchert, „Überholen ohne einzuholen“ – Ist der Kapitalismus unübertrefflich? In: Johannes Schillo (Hg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie. Hamburg 2015, S. 233-236.
April 2016
Zur Kritik der Psychologie
Ende März 2016 ist die dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage von Albert Krölls' „Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes“ erschienen. Dazu eine Information der IVA-Redaktion.
Zehn Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung seiner „Kritik der Psychologie“ hat Albert Krölls eine überarbeitete und erweiterte Neuausgabe vorgelegt, die den bereits in der zweiten Auflage von 2007 aufgenommenen Diskussionsteil neu konzipiert und in seinem Umfang erweitert hat. Dokumentiert wird hier die Kontroverse, die der Autor unter dem Titel „Die geheime Macht des Unbewussten – Ein untauglicher Rettungsversuch der Psychoanalyse“ mit einem Anhänger der Freudschen Theorie geführt hat. Die Antwort auf einen weiteren Leserbrief bringt zudem „vertiefte Ausführungen zur Kritik der ebenso beliebten wie falschen Fragestellung 'Freiheit versus Determination des Willens?'“ (Krölls 2016, 9). Grundlegend überarbeitet wurde ferner das für die Beweisführung des Buches zentrale erste Kapitel, das jetzt die Überschrift „Psychologie: Wissenschaft als Menschenbildpflege“ trägt. Im Rahmen einer neuen Schlussbetrachtung erläutert Krölls – anknüpfend an den Untertitel vom modernen „Opium des Volkes“ – den Nutzwert, den die psychologische Weltanschauung für die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft hat.
Im Folgenden sollen grundlegende Thesen aus Krölls' Kritik vorgestellt und mit anderen Diskussionsbeiträgen konfrontiert werden, die eigene Kritikpunkte formulieren, eine Krise der Psychologie konstatieren oder deren wissenschaftlichen Status – gerade angesichts des neurowissenschaftlichen Booms mit seinen neuartigen Erkenntnissen übers Seelenleben – problematisieren. Albert Krölls steht übrigens weiterhin für eine Diskussion seiner Thesen zur Verfügung, und zwar unter der E-Mail-Adresse: AKroells@web.de.
Kritik der Psychologie
Krölls' Ausgangspunkt ist die „Psychologisierung aller Lebenssachverhalte“ (ebd., 10), die man in der modernen Marktwirtschaft antrifft. Mit sich selbst im Reinen zu sein, gilt ja als entscheidende Leistung, die man zu erbringen hat: „Zurechtkommen mit der Welt ist zuallererst ein Zurechtkommen mit dem lieben Selbst. Wer sich selbst annimmt und kontrolliert, wer sein Verhältnis zu sich im Griff hat und über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügt, hat mit der Welt keine Probleme mehr.“ (Ebd.) Diese Psychologisierung, die der religiösen Seelsorge den Rang abgelaufen hat, wird heutzutage höchstens vom Biologismus der Hirn- oder Genforschung in Frage gestellt, der aber im Grunde nur das Ideal der Steuerung des Seelenapparats in einer naturalistischen Variante vorträgt. Die Kernthese des Buchs lautet daher: „Die psychologische Denkweise liefert die fachliche Anleitung für die kritische Selbstmanipulation des schwierigen Willens zur (Selbst)zufriedenheit in einer Gesellschaft, deren Mitglieder bei der herrschaftlich konzessionierten Verfolgung ihrer Interessen … systematisch auf Beschränkungen, insbesondere auf die Schranken der vom Staat ins Recht gesetzten Interessen anderer Konkurrenzsubjekte, stoßen.“ (Ebd.)
Der Autor greift nicht nur das manipulatorische Ideal psychologischer Verwendungszusammenhänge an, sondern den wissenschaftliche Fehler selbst, der darin bestehe, „nach Ursachen der Willensleistungen außerhalb von Wille und Bewusstsein“ zu suchen und „das Handeln der Subjekte als Resultante des Wirkens hintergründiger seelischer Kräfte“ zu deuten (ebd., 11). Dass es sich bei dieser deterministischen Theorie um die Konstruktion eines Menschenbildes handelt, legt Krölls im ersten Kapitel dar. Er diskutiert ausführlich das tautologische Verfahren, Verhalten auf innere, psychische Faktoren, auf „Dispositionen“ oder „Triebe“, zurückzuführen, es also mit der Verdopplung in eine beobachtbare Äußerung und eine innere Ermöglichung dieses Nach-Außen-Tretens – scheinbar – zu erklären. Und er benennt die „ideologische Basisleistung“ (ebd., 47) dieser Menschenbildkonstruktion: Sie dient als Beitrag zur Pflege der Konkurrenzmoral.
Der auf psychologischem Wege erstellten Zeitdiagnose zufolge scheitert ein Mensch nicht an den Zwecken und Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft, die von ihm die Selbstbehauptung in der Konkurrenz um Lebens- und Arbeitsbedingungen verlangt. Ihm mangelt es vielmehr – so der Konsens des Fachs über einzelne Schulen hinweg – an einem stabilen Selbst, was sich etwa an unzulänglichen Konfliktbewältigungsstrategien, zu schwacher Frustrationstoleranz oder suboptimal funktionierender Triebkontrolle zeige. Der Betreffende leidet in dieser Optik an defizitärem Realitätsbezug, überzogenen Ansprüchen an die Gesellschaft, mangelnder Einsicht in seine individuellen Möglichkeiten und Grenzen oder, genau umgekehrt, am fehlenden Glauben an sich selbst. „Dem dergestalt als funktionsuntauglich deklarierten Menschen gebricht es an der notwendigen Fähigkeit, als verantwortlicher Regisseur seines Seelenhaushaltes die geforderte Anpassungsleistung an die gesellschaftlichen Erfordernisse zu erbringen, zu der ihm im Versagensfalle die psychologische Lebensberatung zu verhelfen sucht.“ (Ebd., 48)
In den Kapiteln 2 bis 6 bietet das Buch eine „Besichtigungsreise“ durch die äußerst plurale Welt psychologischer Theorien, Modelle und Ansätze, wobei es keine handwörterbuchmäßige Vollständigkeit anstrebt, sondern wenige, aber aussagekräftige Klassiker des Fachs auswählt. Es ist nicht die Absicht des Autors, einen Überblick über den aktuelle Stand des Pluralismus in der Disziplin zu bieten. Dazu liegen diverse Publikationen vor, das neue wissenschaftliche Kompendium von Galliker/Wolfradt (2015) versammelt z.B. rund 120 Ansätze, und jedes Handbuch aus den Bindestrich-Psychologien kann weitere beisteuern. Krölls nimmt sich dagegen exemplarisch Fälle vor, die er nicht aneinander reiht, sondern detailliert auf ihren Gehalt hin prüft. Bei der Auswahl hat er unter anderem Beispielfälle aus der Sozialpsychologie berücksichtigt, die einen gesellschaftskritisch-emanzipatorischen Anspruch erheben und an denen sich die These der Psychologisierung genauer untersuchen lässt.
Die Auseinandersetzung mit der Freudschen Seelenlehre und dem Drei-Instanzen-Modell (Es – Ich – Über-Ich), speziell mit der zentralen Kategorie des Unbewussten, bildet den Gegenstand von Kapitel 2. In Kapitel 3 ist die Verbindung von Freudscher Tiefenpsychologie und Marxismus Thema, und zwar in Gestalt der sozialpsychologischen Studien der Frankfurter Schule über den „autoritären Charakter“. Deren „zentrale politische Botschaft besteht darin, dass der Mensch aufgrund der triebökonomischen Verfassung seines Seelenhaushaltes quasi automatisch zur unbewussten Anpassung an die Funktionserfordernisse der politischen Gewalt gezwungen sei und damit an der Erfüllung seiner 'eigentlichen' Mission scheitern müsse, der autoritären Herrschaft (faschistischer Provenienz) Widerstand zu leisten“ (ebd., 15). Die Ergänzung der Kritik der politischen Ökonomie um einen „subjektiven Faktor“ ende, so Krölls, in der Konstruktion eines „idealen Entsprechungsverhältnisses zwischen Untertan und Herrschaft: staatsbürgerlicher Gehorsam als Naturbestimmung des Willens“ (ebd.). Kapitel 4 behandelt dann das von Skinner entworfene behavioristische Kontrastprogramm zu Freud, die verhaltenswissenschaftliche Theorie der instrumentellen Konditionierung des Menschen durch äußere Bedingungen – also eine Position, die sich nicht in Spekulationen übers Seelenleben vertiefen will, sondern die Psyche als eine „black box“ betrachtet, mit der sich Experimente nach naturwissenschaftlichem Vorbild anstellen lassen.
Kapitel 5 setzt sich mit der Anwendung zeitgenössischer psychologische Theorien auf einen speziellen Fall, nämlich auf die Ausländerfeindlichkeit, auseinander. Im Ergebnis laufen hier, so Krölls, falsche Erklärungen rechtsradikaler und rassistischer Einstellungen auf die Behauptung einer prinzipiellen Unmaßgeblichkeit der genuin politischen, d.h. nationalistischen Beweggründe hinaus, so dass im Endeffekt die Rolle von Nationalstaaten als Nährboden ausländerfeindlicher Urteile und Taten ihrer Bürger ausgeblendet wird. Dem stellt der Autor den konkurrierenden Erklärungsansatz der Holzkamp-Schule gegenüber, dem man diesen Vorwurf nicht machen kann. Diese „subjektwissenschaftliche“ Erklärung verfehle aber mit ihrer Vorstellung eines Verführungs- und Bestechungswerks des bürgerlichen Staates zur Herstellung staatsbürgerlicher Loyalität ebenfalls die Sache, nämlich die politische Psychologie von Nationalisten. Im vorletzten Kapitel 6 werden beispielhaft praktische Leistungen der Psychotherapie, vor allem der Gesprächstherapie nach Rogers, untersucht.
Die Schlussbetrachtung im 7. Kapitel fasst dann den Nutzwert der psychologischen Weltanschauung für die moderne Konkurrenzgesellschaft nochmals zusammen. Es handle sich um einen ideologischem Beitrag zur Pflege der Konkurrenzmoral der Bürger. „Als theoretischer Überbau der Konkurrenzmoral hat die psychologische Weltanschauung im späten 20. Jahrhundert verdientermaßen der Religion den Rang als Opium des Volkes abgelaufen. Die Verheißung der Psychologie ist nicht wie bei der Religion die Aussicht auf einen komfortablen Platz im Himmelreich durch ein gottgefälliges, in aller Regel arbeits- und entbehrungsreiches Leben, sondern besteht in einem durchaus diesseitigen Versprechen auf 'personale Befriedigung', das sich im Ideal der Selbstverwirklichung zusammenfasst.“ (Ebd., 167)
Das Buch setzt sich mit den Leistungen der akademische Psychologie auseinander, hat darin also seinen Gegenstand und beansprucht nicht, selber eine Theorie bürgerlicher Konkurrenzsubjekte zu liefern. Es kommt aber dem Interesse an positiven Erklärungen der Lebenssachverhalte, die von der bürgerlichen Psychologie systematisch verklärt werden, zumindest streckenweise entgegen, so im Rahmen der Widerlegung psychologischer Umdeutungen von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Krieg (siehe Kapitel 5.5). Krölls' Erklärungen, die ohne eine Bezugnahme auf ein „Dahinterliegendes“ oder ein „Menschenbild“ auskommen, laufen im Ergebnis auf eine dreifache Kritik hinaus: „zum einen an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die einer solchen Wissenschaft bedürfen, zum anderen an der Wissenschaft selbst, die diesen Bedarf mit lauter nützlichen Fehlerklärungen der menschlichen Subjektivität und ihrer Betätigungsweisen bedient. Und drittens an den bürgerlichen Subjekten, welche die von der Wissenschaft erzeugten, gepflegten und verstärkten Fehlurteile über die gesellschaftlichen Verhältnisse des demokratischen Kapitalismus ganz eigenständig im Kopfe haben und zu ihrem Schaden in die praktische Tat umsetzen.“ (Ebd., 17) Der Anhang des Buchs enthält dann den besagten Diskussionsteil, in dem es um Repliken auf die beiden ersten Auflagen geht.
Ein Fach in der Krise?
Kritik an der Psychologie gibt es heutzutage natürlich auch von anderen Autoren, z.B. in einer populären, der Ratgeberliteratur verwandten Form, die ebenfalls – wie Krölls – den Vorwurf vom „Opium des Volkes“ erhebt. Der Journalist Jens Bergmann hat eine launige Einführung „Der Tanz ums Ich“ vorgelegt, die von der Psychologie als der „Religion unserer Zeit“ (Bergmann 2015, 9) spricht: „Wer bin ich? Und warum bin ich, wie ich bin? Was geht in mir vor und was in den anderen? Diese Fragen bewegen uns, weil uns unsere Mitmenschen rätselhaft erscheinen und weil es uns mit uns selbst häufig nicht anders ergeht. Aufklärung und Hilfe verspricht die Psychologie… Sie ist die Religion unserer Zeit.“ (Ebd., 9f) Das Buch will darlegen, „wie sie es so weit bringen konnte. Was ihren Reiz ausmacht. Und mit welchen Folgen der Glaube an sie verbunden ist. Es klärt auf über das Grundproblem des psychologischen Denkens: Niemand kann anderen Menschen wirklich in den Kopf schauen. Von der Suggestion, es doch zu können, lebt eine ganze Industrie. Dieses Buch ist kein Ratgeber, aber hoffentlich nützlich: durch Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen der Psychologie.“ (Ebd., 10)
So wie die Psychologie als Vorhaben einer nicht-metaphysischen Seelenkunde einst in Konkurrenz zur religiösen Betreuung der Seelen trat, so treten heute Propagandisten der Hirnforschung an, um mit ihren Einblicken ins Seelenleben und dessen neuronale Determinanten der psychologischen Betrachtungsweise den Rang streitig zu machen (vgl. Roth 1997, 2003, zur Kritik daran: Cechura 2008, Huisken 2012). Passend dazu gibt es Publikationen wie die von Bergmann, die sich in einer Art Verbraucherberatung ans Publikum wenden. Wer sich in der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft behaupten will, stellt sich natürlich immer wieder die Frage: „Was geht in mir vor und was in den anderen?“. Um den eigenen Seelenfrieden und eine fundierte Stellung zum 'subjektiven Faktor' der Mitkonkurrenten zu finden, wird ihm heutzutage Hilfe von verschiedenen Angeboten versprochen, die sich auf dem Sinnfindungs- und -stiftungsmarkt tummeln: Man kann sich konventionell religiös oder in einem bunten, ständig erweiterten Spektrum esoterisch orientieren, man kann sich von den biologistischen Steuerungsidealen der Neurowissenschaft beeindrucken lassen oder eben bei der breiten Anbieterpalette akademisch approbierter sowie alternativ-experimentierfreudiger Psychotherapien zugreifen. Für den Einkauf im Supermarkt der Lebenshilfen und Weltanschauungen dürfte es dann nützlich sein, wie Bergmann verspricht, eine Übersicht zu Risiken und Nebenwirkungen der einzelnen Angebote an die Hand zu bekommen.
Entsprechende Handreichungen sind auch schon länger auf dem Markt. So hat der Psychologe Colin Goldner vor bald 20 Jahren einen (Anti-)Therapieführer erstellt (Goldner 1997) – in der Hauptsache ein Nachschlagewerk zu rund 100 psychologischen Verfahren der Alternativ- und Esoterikszene, das, mittlerweile fortgeschrieben (Goldner 2000), als Standardwerk zur Begutachtung der therapeutischen Grauzone gilt. Es erfasst den alternativen Bereich, der sonst eher am Rande vorkommt, wobei der Therapiebegriff weitgefasst ist. Goldners Schwäche liegt darin, dass er auf Evidenz setzt: Durch das Exzentrische der vorgestellten Beispiele, letztlich durch eine formale Unterscheidung, die professionelle – vom Bundesverband der Psychologen oder sonstwie approbierte – Therapien von der alternativ-esoterischen Szene absetzt, die mit keinen staatlich anerkannten Ausbildungsgängen oder Berufsbildern aufwarten kann, soll sich der Unterschied von „Seriosität“ und „Scharlatanerie“ ergeben.
Goldners Kritik kürzt sich im Grunde auf den Wunsch nach mehr Anerkennung akademischer Ausbildungsgänge und ein staatliches Eingreifen zu Gunsten des Berufsstandes zusammen. So sieht er in dem 1999 in Kraft getretenen Psychotherapeutengesetz (PTG) einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Die alternative Psychoszene bleibe von dem Gesetz aber unberührt. Der Autor resümiert auch die Debatten, die im Zusammenhang mit der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ entstanden. Die 1996 auf Antrag der SPD eingesetzte Enquete-Kommission hatte 1998 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Von der Kommission wurden zwar viele Bedenken geäußert, letztlich aber klargestellt, dass es nicht beabsichtigt sei, die „Anbieter“ auf dem Religions-, Weltanschauungs- und Psychomarkt einer Prüfung zu unterziehen oder anhand „schwarzer“ oder „weißer Listen“ zu erfassen. Goldner griff in dem Zusammenhang die Idee auf, ein „Lebensbewältigungshilfegesetz“ zu entwickeln, das für Verbraucherschutz in dem betreffenden Marktsegment sorgen sollte. Ein solches Gesetz kam jedoch nicht zustande. Die Sorge um den eigenen Seelenfrieden überlässt der Staat nämlich – wie es ich für eine Konkurrenzordnung freier Individuen gehört – der Entscheidung der Einzelnen, die ihr Leben bewältigen müssen.
Die Psychologie-Professoren Mark Galliker und Uwe Wolfradt haben einen Sammelband erstellt, der „zum ersten Mal ein umfangreiches Kompendium der relevanten Theorien der wissenschaftlichen Psychologie“ (Galliker/Wolfradt 2015, 11) bieten will. Wie die beiden Fachleute festhalten, würde heute nämlich „den für die psychologische Forschung zur Verfügung stehenden Theorien und Modellen erstaunlicherweise relativ wenig Beachtung geschenkt“ (ebd., 12). Die Disziplin habe sich lange Zeit eher auf experimentelle Untersuchungen konzentriert und das Feld der Theorie vernachlässigt. Die Art und Weise, diese Defizite zu beheben, überrascht allerdings. Der Band präsentiert rund 120 Theorien von der Abbild- und Widerspiegelungstheorie bis zur Völkerpsychologie und Zeichentheorie, die – um das Mindeste zu sagen – unverbunden nebeneinander gestellt werden. Was man hier vor sich hat ist ein disparater Haufen von Theoriebestandteilen, Denkrichtungen oder wissenschaftlichen Schulen, die nicht nur untereinander inkompatibel sind, sondern selbst auch wieder ein weites Feld kontroverser Ansätze umfassen können. Letzteres gilt z.B. für Stichwörter wie „feministische Theorien“, „Gerechtigkeitstheorien“, „Klinische Psychologie“, „konstruktivistische Ansätze“ oder, noch allgemeiner, „Wissenschaftstheorie“. Und es gilt für einen Eintrag namens „Willensfreiheit“ (ebd., 537ff), der außerdem eine quer zum psychologischen Mainstream stehende – und nicht bloß mit einzelnen anderen Ansätzen unvereinbare – Konzeption zum Thema macht.
Die beiden Psychologen sehen darin aber keinen Mangel. Eher im Gegenteil, sie lassen eine gewisse Zufriedenheit mit dem Bestand erkennen, der die Breite und Vielfalt des Fachs dokumentiert. Und sie sehen die weiter gehende Aufgabe darin, „eine Vernetzung der vielen theoretischen Ansätze zu schaffen“, denn zunächst gelte es, „eine Übersicht zu gewinnen, um im Weiteren zu einer bereichsübergreifenden Einordnung und längerfristig zu einer theoretisch fundierten Integration zu gelangen“ (ebd., 13). Es geht den beiden Wissenschaftlern also nicht darum, die Widersprüche auszuräumen, also z.B. die Frage zu klären, ob die Abbildtheorie oder der konträr zu ihr stehende Konstruktivismus bzw. ein Ansatz aus den beiden präsentierten Theoriebündeln recht hat. Vielmehr sollen alle zusammen in einem ersten Schritt „vernetzt“ werden, um sie dann schlussendlich zu „integrieren“. Ein in jeder Hinsicht merkwürdiges Vorhaben!
Über seinen Sinn gibt eine andere Publikation Gallikers näheren Aufschluss. Er hat nämlich das, was in dem Kompendium als Vielfalt des Fachs hervorgehoben wurde, an anderer Stelle als Krisenphänomen der wissenschaftlichen Psychologie identifiziert. In seiner neuen Studie „Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Ihre Krisen und Kontroversen von den Anfängen bis zur Gegenwart“ thematisiert er die grundlegende Frage, ob die akademische Psychologie angesichts ihrer „aktuellen Krise“ überhaupt dem „Anspruch der Wissenschaftlichkeit und insbesondere der Naturwissenschaftlichkeit zu genügen vermag“ (Galliker 2016, IX). Dafür bietet der Autor einen Rundgang durch die einschlägigen Kontroversen des Fachs, einschließlich der vorwissenschaftlichen, d.h. philosophischen Auseinandersetzungen um das Verhältnis von Körper und Seele, um die Erklärung der Welt aus einem ersten Prinzip – klassisch: um den Vorrang „der Idee“ oder „der Materie“. Von der Philosophie habe die Psychologie die Kontroverse um Dualismus und Monismus geerbt, was bis zum modernen „Biologismusproblem“ reiche, das gegenwärtig unter dem Einfluss des neurowissenschaftlichen Booms im „neuroreduktionistischen Sinne“ (ebd., 237) gelöst werde.
Gallikers Bestandsaufnahme ist geradezu scharf darauf, Kontroversen und unversöhnliche Positionen zu präsentieren. Ausgeblendet wird dabei etwa, obwohl sonst viel Wert auf die philosophischen Vorläufer gelegt wird, Hegels Philosophie des subjektiven Geistes, die die Dualismus-Debatte im „dialektischen“ Sinne zum Abschluss brachte. Dabei könnte man gerade hier überprüfen, ob die ewige Fortschreibung philosophischer Kontroversen um den Leib-Seele-Dualismus wirklich sinnvoll ist oder ob sich nicht aus Hegels Position Argumente ergeben, die – jenseits der idealistischen Vorentscheidung dieser Philosophie – das groß aufgebaute, seit der Antike mitgeschleppte Problem lösen können. Das ist jedoch nicht das Interesse Gallikers. Die Krise besteht bei ihm nicht in dem Missstand, dass man bei der Sichtung der fachlichen Erkenntnisse ein Sammelsurium widersprüchlicher Ansätze in die Hand bekommt, sondern dass man sich gegenüber anderen Disziplinen nicht als respektabler Betrieb mit eigenständigem Profil präsentieren kann. Galliker wälzt ein Anerkennungsproblem. Er schreibt vom Standpunkt eines modernen Wissenschafts-Marketings aus, das in der Konkurrenz des Lehr- und Forschungsbetriebs – 'nach Bologna' und beim Kampf um öffentliche Mittel – danach fragt, ob es der jeweiligen Wissenschaft gelingt, „ihre Forschungsergebnisse den Laien gewinnbringend zu kommunizieren“ (ebd., 1) und sich als praxisrelevant zu positionieren.
Im Hinblick auf dieses Anliegen, fällt die Bilanz des Buchs negativ aus. Speziell sei es das Manko der Psychologie, dass sie angesichts des Maßstab setzenden naturwissenschaftlichen Ideals nicht mithalten kann. Den Ausweg aus der unbefriedigenden Situation sieht der Autor darin, die „Invasion der Mathematik in das psychologische Denken und Urteilen“ (ebd., 237) zurückzudrängen und wieder neu den „Primat der Theorie“ (ebd., 25) zu etablieren. Das heißt in der Konsequenz, dass „Psychologie primär als Sozialwissenschaft zu verstehen“ sei (ebd., 239). Diplomatisch gesteht der Autor allerdings zu, dass der Psychologie auch die Aufgabe obliege, „die naturwissenschaftlichen Momente zu involvieren“ (ebd., 239). Involviert bzw. integriert werden soll dann alles Mögliche, wie man es an dem erwähnten Kompendium ablesen kann.
Es gibt allerdings auch Positionen in der Psychologie, die deren Rolle in der kapitalistischen Gesellschaft zum Thema machen. Krölls hat dies am Beispiel von Holzkamps Subjektwissenschaft aufgegriffen, die eine einflussreiche Strömung Kritischer Psychologie repräsentiert. Zu nennen wäre hier ferner die Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP), die psychoanalytisch orientiert ist und verdrängte Theorieproduktionen zugänglich machen will. So legte 1972 der Hannoveraner Psychologie-Professor Peter Brückner, der sich als Theoretiker der antiautoritären Bewegung verstand und wegen seines Engagements von der Politik gemaßregelt wurde, seine Studie „Zur Sozialpsychologie des Kapitalismus“ vor. Vier Jahrzehnte später veranstaltete die NGfP einen Kongress in Berlin, der sich der Aktualität Brückners widmete – einer Aktualität, die, wie NGfP-Vorsitzender Professor Klaus-Jürgen Bruder zur Kongress-Einführung bemerkte, heutzutage gerade nicht auf der Hand liege, da uns von den theoretischen Ansprüchen und Erwartungen der 68er-Bewegung ein großer zeitlicher oder generationeller Abstand, ja eine „kulturelle Kluft“ (Bruder) trenne. Diese Kluft zu überbrücken und ein emanzipatorisches wissenschaftliches Erbe anzutreten, war die Absicht des Kongresses. Herausgekommen ist jedoch, wie man in dem Tagungsband (Bruder u.a. 2013) nachlesen kann, eine Sammlung ganz unterschiedlicher kritischer Stimmen, die mal mehr, mal weniger mit Psychologie oder mit Brückners Vorarbeiten zu tun haben.
Bei Brückner standen seinerzeit Fragen der Politischen Psychologie, der Herrschafts-Psychologie, im Vordergrund. „Massenloyalität“ und „Unterwerfungsverhalten“ lauteten zentrale Stichworte seiner Forschungen, und das aus der psychoanalytischen Theorie stammende Begriffspaar von Ich-Schwäche und Ich-Stärke sollte eine Perspektive für emanzipatorische Prozesse liefern, wobei der erste Begriff für Anpassungsverhalten und der zweite für Protestkultur stand. Dass sich dieses Verständnis mittlerweile grundlegend gewandelt hat, ist den Vertretern der NGfP, wie Bruder im Vorwort des Sammelbandes betont, bewusst. Heute gilt der „Arbeitskraftunternehmer“, das flexible, auf jede Herausforderung eingestellte und mit einschlägigen Handlungskompetenzen ausgestattete Individuum in seiner Anpassungsfähigkeit an wechselnde Problemlagen, als ich-stark; wer diese Funktionsfähigkeit vermissen lässt ist ich-schwach, bedarf der Hilfestellung von Beratung oder Therapie.
Gegen diesen neuen Konsens wollte der Kongress Position beziehen, was aber nur zur Reproduktion ganz verschiedener kritischer Standpunkte führte. Rund zwei Dutzend Referenten aus Psychologie, Pädagogik, Sozial- oder Medienwissenschaften thematisierten bei der Berliner Zusammenkunft 2013 alle möglichen Topoi, die in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften kursieren. Als erstes ging es um die „Transformation der Demokratie“, die heute meist unter dem Stichwort „Postdemokratie“ abgehandelt wird. Ein zweiter Block lautete „Überflüssige Bevölkerung“, Vorträge beschäftigten sich z.B. mit Rassismus oder Inklusion, wobei auch Ergebnisse staatlich geförderter Begleitforschung zu Projekten der Weiterbildung etc. vorgestellt wurden. Der dritte Block trug den Titel „Selbstsozialisation – Unterdrückung in eigener Regie“ und befasste sich z.B., so in dem Beitrag von Uwe F. Findeisen, mit der Frage nach dem „notwendig falschen Bewusstsein über unsere Gesellschaft“. Findeisen ging auf die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zurück und wandte sich damit gegen die Konstruktion psychologischer Problemstellungen, die in anderen linken Kreisen en vogue sind. Der vierte und letzte Block des Kongresses, „Empörung – Selbstfreisetzung“ überschrieben, kam auf Perspektiven einer „Befreiungspsychologie“ (Klaus Weber) zu sprechen. In einem Beitrag zur Occupy-Bewegung wurde diese als Versuch hochgehalten, „nicht vor dem vermeintlich je eigenen Elend zu kapitulieren“ (Juliko Lefelmann/Tom Uhlig).
Also auch hier soll die Psychologie, jetzt natürlich in einer kritisch gestimmten Variante, Lebenshilfe und aufbauende Dienste leisten, indem sie die Ich-Stärke – nicht von konkurrierenden Individuen, sondern – von Teilnehmern an Protestbewegungen befördert. Aus der wissenschaftlichen Psychologie werden dafür einzelne Elemente ausgewählt, mit Vorliebe etwa die Theorie des autoritären Charakters (siehe dazu die Kritik bei Krölls), um gegenüber einer einseitigen Psychologisierung des gesellschaftlichen Lebens politische Aspekte hervorzuheben. Oder es werden – ähnlich wie bei den kritischen Sondierungen der NGfP – alle möglichen theoretischen Bemühungen versammelt, um sie unter dem Ticket „Politische Psychologie“ aufzuführen (vgl. Frankenberger u.a. 2007, Brunner u.a. 2012). Dann wird es schon als verdienstvoll betrachtet, diese Unterdisziplin der Psychologie, um die es „in den letzten Jahren merklich still geworden“ sei (Frankenberger u.a. 2007, 9), wieder aufzuwerten. Und es wird als Positivum verbucht, „dass nahezu jeder ‚Bereich gesellschaftlicher Prozesse auch zum Forschungsgegenstand Politischer Psychologie werden könnte’“ (ebd., 13).
Einen Beitrag zur „Politisierung der Psychologie“ (Klappentext) versucht auch Harald Werner, Verantwortlicher des Parteivorstands Die Linke für politische Bildung, mit seinem Buch „Politische Psychologie des Sozialismus“ (Werner 2015) zu leisten. Das Buch will vor allem den „Zusammenhang von Psychologie und Marxismus verständlich machen“ (Werner 2015, 16). Die Pluralität der wissenschaftlichen Ansätze, die sich im akademischen Betrieb entwickelt hat, wird z.B. am Fall der Psychoanalyse daraufhin geprüft, ob sich hier ein „Bündnisverhältnis“ (ebd., 32) zur sozialistischen Psychologie eingehen lässt, ob sich Freud, Fromm etc. in sozialistische Politik einbinden lassen. Die jeweiligen Theorieelemente werden natürlich auch im Blick darauf begutachtet, ob sie mit einer „materialistischen“ Grundposition übereinstimmen, und im positiven Falle, siehe das Beispiel der „modernen Hirnforschung“ (ebd., 17) mit ihrer angeblich materialistischen Herangehensweise, als deren Bestätigung genommen. Interessant erscheint dem Autor aber vor allem die Frage, wie psychologische Strömungen „Einfluss auf das geistig-kulturelle Leben gewinnen“ (ebd., 30) und ob sich im Bunde mit der Psychologie „die Ausstrahlungskraft des marxistischen Denkens“ (ebd., 10) verbessern lässt.
Der Zustand eines Pluralismus divergierender, sich gegenseitig bestreitender Erkenntnisse – sei es nun als Bandbreite des ganzen Fachs, sei es im Rahmen einer 'linken' Auswahl – wird heutzutage nicht als Ärgernis empfunden, sondern als Normalität. Einwände dagegen werden kaum vorgebracht. Sie finden sich systematisch aufbereitet in der Wissenschaftskritik des Gegenstandpunkts (vgl. die Website: wissenschaftskritik.de). So schreibt Peter Decker (2013) zum Geisteszustand der Gesellschaftswissenschaften: „Eigentlich liegt es ja auf der Hand: Fächer, in denen verschiedene Meinungen über denselben Gegenstand kursieren, haben es zu gültigem, überzeugendem Wissen nicht gebracht. Früher haben das manche Vertreter der Gesellschaftswissenschaften auch noch so gesehen: Sie haben am Unterschied zur Objektivität und Unumstrittenheit naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse gelitten und wollten ähnlich haltbare Einsichten erst noch erzielen. Inzwischen ist jede Unzufriedenheit über den Stand des Wissens an den philosophischen Fakultäten ausgestorben. Der Zustand des Nicht-Wissens ist endgültig.“ Der Kritik dieses Zustands, gerade auch bezogen auf die psychologische Disziplin (vgl. Decker o.J., Marxistische Gruppe 2000), widmet sich die besagte Website zur Wissenschaftskritik. Insofern hat die Ausbreitung von Nicht-Wissen hoffentlich doch nicht das letzte Wort.
Literatur
- Jens Bergmann, Der Tanz ums Ich – Risiken und Nebenwirkungen der Psychologie. 2. Aufl., München 2015.
- Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Bialluch, Benjamin Lemke (Hg.), Sozialpsychologie des Kapitalismus – heute. Zur Aktualität Peter Brückners. Gießen 2013.
- Markus Brunner/Jan Lohl/Rolf Pohl/Marc Schwietring/Sebastian Winter (Hg.), Politische Psychologie heute? Themen, Theorien und Perspektiven der psychoanalytischen Sozialforschung. Gießen 2012.
- Suitbert Cechura, Kognitive Hirnforschung – Mythos einer naturwissenschaftlichen Theorie menschlichen Verhaltens. Hamburg 2008.
- Peter Decker, Die Psychologie – Sachzwänge des Subjektseins. Aus: ders., Die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Online: http://www.wissenschaftskritik.de/die-psychologie/, o.J.
- Peter Decker, Der Pluralismus in den Gesellschaftswissenschaften – Zeugnis und Verkehrsform einer falschen Wissenschaft. Vortrag, Erlangen 2013, online: http://www.wissenschaftskritik.de/der-pluralismus-in-den-gesellschaftswissenschaften-vortrag/.
- Rolf Frankenberger/Siegfried Frech/Daniela Grimm (Hg.), Politische Psychologie und politische Bildung. Schwalbach/Ts. 2007.
- Mark Galliker, Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Ihre Krisen und Kontroversen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden 2016.
- Mark Galliker/Uwe Wolfradt (Hg.), Kompendium psychologischer Theorien. Berlin 2015.
- Colin Goldner, Psycho – Therapien zwischen Seriosität und Scharlatanerie. Augsburg 1997.
- Colin Goldner, Die Psycho-Szene. Aschaffenburg 2000.
- Freerk Huisken, Über die Untauglichkeit der Hirnforschung als Ratgeberin in Bildungsfragen. Bremen 2012, online: http://www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- Freerk Huisken, „Der Mensch ist der Sklave seines Gehirns!“, behaupten Hirnforscher – Schon wieder eine Aufforderung, an seinem Verstand zu zweifeln, statt ihn zu benutzen. Hamburg 2012, online: http://www.fhuisken.de/buecher.html.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- Marxistische Gruppe, Argumente gegen die Psychologie. (1990) Korr. Neuauflage, München 2000, Textauszüge online unter: http://www.wissenschaftskritik.de/argumente-gegen-die-psychologie/.
- Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. 5., überarbeitete Auflage, Frankfurt/M. 1997.
- Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Neue, vollständig überarbeitete Auflage, Frankfurt/M. 2003.
- Harald Werner, Politische Psychologie des Sozialismus – Die emotionale Seite rationalen Handelns. Hamburg 2015.
Creydt kritisiert Krölls?
Zur dritten Auflage von Krölls' „Kritik der Psychologie“ veröffentlichte IVA eine Buchinformation (siehe oben). Aus diesem Anlass hat bei contradictio.de ein Kommentator vermerkt, dass eine grundlegende Kritik an „Krölls, Held & Co.“ von Meinhard Creydt vorliegt. Dazu eine Replik von Johannes Schillo.
Ende März 2016 ist die dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage von Albert Krölls' „Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes“ erschienen (siehe Krölls 2016). Dazu hatte die IVA-Redaktion eine Information auf dem IVA-Blog veröffentlicht (siehe oben). Aus diesem Anlass merkte am 6. April ein Internet-Kommentator (Wolfgang auf contradictio.de) an, dass sich „eine grundlegende Kritik am Verständnis psychischer Prozesse bei Krölls, Held & Co. im 26 Seiten umfassenden Kapitel 7 (Überschrift: Warum psychische Prozesse für einen Verstand unverständlich bleiben, der sich im Horizont des bürgerlichen Materialismus und rationalistischer Konzepte bewegt)“ des Bandes „Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler“ von Meinhard Creydt findet (siehe Creydt 2015).
Das genannte Kapitel befasst sich mit den Defiziten psychologischer Theoriebildung, wie sie der Autor bei Albert Krölls, Karl Held oder Freerk Huisken ausgemacht hat. Es geht ihm um grundlegende Mängel, an denen er – dies das Hauptanliegen seines Buchs – eine falsche Gegenposition zum „bürgerlichen Materialismus“ kenntlich machen will. Die mangelhafte Theorie soll seit den Zeiten der Marxistischen Gruppe (MG) bestehen, heute die Position der Zeitschrift Gegenstandpunkt bestimmen und auch sonst in der marxistischen Diskussion Kreise ziehen. In dem Kapitel findet allerdings, anders als von dem Kommentator behauptet, keine Auseinandersetzung mit Krölls statt. Es wird – bis auf einen Satz zur Psychologie der Kriminalität, der in einer Fußnote zitiert und pauschal zurückgewiesen wird (siehe Creydt 2015, 115) – keine einzige These aus dessen Buch wiedergegeben oder überprüft. Einmal wird die „Kritik der Psychologie“ im Text erwähnt (ebd., 112), woran sich folgende Fußnote anschließt: „So der Titel von Krölls Buch (2006). Es demonstriert die Oberflächlichkeit, mit der MG/GSP-Anhänger über Psychoanalyse, Holzkamp u.a. psychologische Theorien urteilen.“ Ein erstaunlich apodiktisches Urteil!
Mit „Oberflächlichkeit“ ist jedoch ein Stichwort gefallen, das Creydts Kritik an marxistischen Positionen in Sachen Psychologie auf den Punkt bringt. Was der Autor damit meint, welche Tiefe er vermisst und weshalb auf Grund dieser Fehlanzeige die Überlegungen von Krölls u.a. zu revidieren oder zu verwerfen seien, soll im Folgenden erörtert werden. Dabei geht es vor allem um den ersten Abschnitt (a) des siebten Kapitels, der ein Panorama psychologischer Theoriebildung entwirft. Deren Missachtung hält Creydt seinen Gegenspielern als entscheidendes Manko vor. Im folgenden Abschnitt (b, dem sich dann unter c noch etwas anders gelagerte Bemerkungen über „Persönlichkeitsstile“ anschließen) fasst er dies so zusammen: „Bürger beziehen sich in ihrem bürgerlichen Materialismus auf das kapitalistische Erwerbs- und Geschäftsleben so, dass sie darin Mittel zur Realisierung ihrer Interessen sehen. Zweitens nehmen sie – und jetzt kommt die 'Psychologie des bürgerlichen Individuums' (MG 1981) ins Spiel – Erfolg bzw. Scheitern persönlich und interpretieren es als Resultate charakterlicher Defizite oder Vorzüge. Sie vergleichen sich mit anderen, identifizieren einander als Schuldige des eigenen Mangels an Erfolg oder legen sich ein kompensatorisches Selbstbewusstsein zu. Nicht, dass das kein relevantes Thema ist! Für MG/GSP ist es aber das Thema ihrer 'Psychologie des bürgerlichen Individuums' oder der 'Kritik der Psychologie'. Beide stören sich an der oft vorzufindenden Auffassung, man habe auf eine bestimmte Weise gehandelt, weil man 'passives Opfer seiner Seelenregungen' gewesen sei“ (ebd., letzteres ein Zitat aus: MG 1981).
In der referierten thematischen Konzentration sieht Creydt eine „rationalistische“, „kognitivistische“ Verkürzung am Werk, was er hauptsächlich damit belegt, dass er im ersten Abschnitt des Kapitels sein erweitertes Verständnis des Seelenlebens vorstellt. Ihn interessieren nämlich andere Themen, diese sind für ihn relevant und nicht die von marxistischer Seite fokussierten: „Weder die das jeweilige psychische Geschehen konstituierende individuelle Lebensgeschichte noch die für es einschlägigen Gegensätze und deren Folgeprobleme sind im zweck-mittel-rationalen Verfolgen von Interessen und im rationalistischen Verhältnis des Individuums zu sich von Belang. Erfahrungen und Probleme, die das In-die-Welt-kommen, die Integration partikularer psychischer Bestände, den Sinn im endlichen Leben und das Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit betreffen, bleiben einem allein durch Interessen oder den Glauben an die Vernunft bestimmten Horizont fremd.“ (Ebd.) Bleibt also die Frage, was von diesen Themenstellungen zu halten ist und inwiefern sich Krölls und Co., daran gemessen, einer Verkürzung oder Verengung komplexer Sachverhalte schuldig machen.
Psychische Prozesse: extended version
| „Das Subjekt ist die Tätigkeit der Befriedigung der Triebe, der formellen Vernünftigkeit, nämlich der Übersetzung aus der Subjektivität des Inhalts, der insofern Zweck ist, in die Objektivität, in welcher es sich mit sich selbst zusammenschließt. Daß, insofern der Inhalt des Triebes als Sache von dieser seiner Tätigkeit unterschieden wird, die Sache, welche zu Stande gekommen ist, das Moment der subjektiven Einzelheit und deren Tätigkeit enthält, ist das Interesse. Es kommt daher nichts ohne Interesse zu Stande.“ Hegel, Philosophie des Geistes, § 475 |
Creydt bringt, was in der Zusammenfassung anklingt, sein erweitertes Verständnis in drei Abteilungen zur Sprache: Lebensgeschichte, konstituierende Momente des Seelenlebens und innerpsychische Gegensätze. Dafür stellt er beispielhaft Ergebnisse der psychologischen Forschung vor, benennt sie auch oft nur oder deutet sie an, wirft z.B. einen Fachterminus in die Debatte, was dann schon als Argument gelten soll. Dass im Kontrast zu den genannten Erkenntnissen ein verkürztes, rationalistisches Menschenbild der so genannten MG/GSP-Psychologie deutlich wird, lässt sich dabei nicht feststellen. Inwiefern dieses MG/GSP-Gebilde, das nur mit seinen Grundzügen oder Ausgangspositionen vorkommt, richtig charakterisiert ist, mag dahin gestellt bleiben. Mit einer Widerlegung des ins Auge gefassten Gegenspielers hat die Auflistung konkurrierender Auffassungen jedenfalls nichts zu tun. Im Grunde wird aus dem Pluralismus der Disziplin das eine oder andere zitiert, so wie es akademischer Brauch ist. Wenn man wollte, könnte man – dem Brauch folgend – jeder der von Creydt ins Spiel gebrachten Positionen vorhalten, dass sie selber einseitig und verkürzt ist, weil sie auf die Gesichtspunkte, die andere konkurrierend herausstellen, nicht oder nur ungenügend eingeht.
An diesem Spiel beteiligen sich die inkriminierten Publikationen von Krölls, Huisken u.a. nicht. Im Gegenteil, sie nehmen sich – natürlich in einer Auswahl, die aber auf Repräsentativität achtet, wie in Krölls' Buch – entweder Theorien vor, um sie auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen, oder sie entwickeln selber – Beispiel Ausländerfeindlichkeit, Beispiel Jugendgewalt – Erklärungen für einzelne Tatbestände, die ins Fach der Politischen oder der Sozialpsychologie fallen. Ein rationalistisches Menschenbild legen sie dem nicht zugrunde. Die Banalität, dass Menschen mit ihren Interessen auf die Welt losgehen, ja dass Subjektivität mit Interessiertheit zusammenfällt, wie Hegel formulierte, ist bei ihnen zu finden – und nicht nur bei ihnen. Sie wird auch an dem deutlich, was Creydt aus der modernen Wissenschaft referiert, allerdings in psychologisch verfremdeter Weise.
Die erste Abteilung von Creydts Einwänden hält fest, seine Gegenspieler würden nicht berücksichtigen, „dass es überhaupt verschiedene Lebensphasen gibt, dass aus ihnen jeweils eigene Probleme folgen und dass sich aus ihrer Verarbeitung eine eigene psychische Materialität des Individuums bildet. Im rationalistischen Horizont ist all dies kein Thema.“ (Creydt 2015, 107). Das ist eine seltsame Defizitmeldung. Creydt selber diskutiert im zweiten Abschnitt (b) des Kapitels die Erklärungen von Huisken zur Jugendgewalt, speziell zum Erfurter Amoklauf – übrigens die einzige ernsthafte Auseinandersetzung mit der von ihm inkriminierten rationalistischen Psychologie –, müsste also wissen, dass die Lebensphasen durchaus Thema sind. Beide Publikationen (Huisken 1996, 2002) befassen sich ausführlich mit dem Jugendalter, wie Huisken sich auch in „Erziehung im Kapitalismus“ (1998, Teil 1, Kap. 3, 77ff) mit Pädagogischer und Entwicklungspsychologie intensiv auseinandersetzt. Gerade in seiner Erziehungskritik hat Huisken immer wieder die Übergänge von der Kindheit ins Schulalter oder von der Jugendphase ins Erwachsenenleben zum Thema gemacht. Es mag ja sein, dass diese Erklärungen biographischer Passagen Creydt nicht einleuchten, aber von einem Ausblenden des Sachverhalts kann keine Rede sein.
Creydt beginnt den ersten Kritikpunkt mit folgender Feststellung: „Psychische Prozesse beziehen sich – im Unterschied zur Orientierung an Interessen und zur Erkenntnistätigkeit – auf die Befindlichkeit des Individuums als endliches, sein jeweils partikulares Leben integrierendes Wesen. Es setzt sich jeweils mit zentralen 'Daseinsthemen' (Dieter Thomae) seines Lebens auseinander. Das Wohlergehen des Individuums resultiert nicht nur aus der Realisierung einzelner Interessen, Wünsche oder Ziele. Stimmigkeits- und Unstimmigkeitsempfindungen beziehen sich auf das gute Zusammenpassen und Zusammenwirken der verschiedenen psychischen Momente.“ (Creydt 2015, 106) Hier kann natürlich nicht der Philosoph Dieter Thomä, sondern nur der Bonner Psychologie-Professor Hans Thomae gemeint sein, dessen „Persönlichkeitstheorie“ (Thomae 1968) früher als Standardwerk galt. Dort hatte Thomae seine Unterscheidung von Daseinsthematik und Daseinstechnik entwickelt (ebd., Teil 2, Kap. 8, 329ff), wobei mit Daseinsthemen im Grunde die zentralen Anliegen und Motive eines Menschen gemeint sind, die sich im Laufe des Lebens herausbilden und die in den einzelnen Phasen variieren können. Ein gutes altes deutsches Wort dafür wäre „Herzensanliegen“. Das, was einem am Herzen liegt, ist übrigens ein Interesse. Bei jungen Menschen kann sich z.B. alles um ihr Smartphone drehen, bei älteren alles um den nächsten Arztbesuch. So wechseln die zentralen Interessenlagen. Bei den Daseinsthemen und -techniken geht es zudem, wie Thomae mitteilt (ebd., 332), um Zweck-Mittel-Relationen. Die von Creydt ins Abseits gestellte Zweckrationalität ist also auch hier im Spiel; und er selber spricht davon, dass Menschen sich mit Daseinsthemen auseinandersetzen, also wohl einen kognitiven Prozess vollziehen. Denn wer sich mit Themen auseinandersetzt, der greift ja nicht zu Hammer und Meißel oder gibt sich einer depressiven Stimmung hin, sondern wird gedanklich aktiv. Thomae bringt die Daseinsthemen auch mit den Kategorien „Sinn“ und „Bedeutsamkeit“ in Verbindung (ebd., 331), siedelt sie also eher im kognitiven Bereich an.
Zu dieser Persönlichkeitstheorie wäre im Einzelnen viel zu sagen. Hier soll nur Folgendes festgehalten werden – und das gilt so oder so ähnlich für den Fortgang des ganzen Kapitels: Die Einführung der Theorie, genauer gesagt: ihre bloße Benennung als anerkannter Bestandteil der wissenschaftlichen Disziplin, erfolgt erstens in Form einer dogmatischen Behauptung, dass man sie zu berücksichtigen habe; die Theorie weist zweitens selber eine kognitive Schlagseite auf; und sie kann drittens nicht als Opposition zum Begriff des Interesses ins Feld geführt werden. Auch die Bemerkungen, die sich daran anschließen, geben das nicht her. Denn dass das Wohlergehen des Individuums nicht von der Realisierung seiner Interessen abhängen soll – wie der Text schlussfolgernd oder nur eine neue Behauptung hinzufügend fortfährt –, ist ebenfalls nicht einsichtig. Wenn es einem Menschen gut geht und dies mehr als eine vorübergehende Stimmung ist, kann er Gründe dafür angeben. Deren Prinzip lautet: Meine Bedürfnisse und Interessen kommen zum Zuge, ich bin nicht beeinträchtigt durch innere oder äußere Momente, die mir zuwider sind. Sich einfach so gut fühlen – wäre ein eigenartiger Zustand, den es allerdings als Ideal gibt. Aber da ist schon eine psychologische Ideologie psychotherapeutisch oder sonstwie tätig geworden… Die zweite Abteilung von Creydts Einwänden spielt auf die gängigen psychologischen Theorien an, die von einer Prägung des Individuums ausgehen. „Wie das jeweilige Individuum die Entwicklungsschritte im Lebenslauf angeht, hängt von verschiedenen Momenten ab: Seiner Ausstattung mit bestimmten biologischen Voraussetzungen (genetische Ausstattung) und seinem Temperament sowie dem Vorhandensein von materiellen und sozialen Ressourcen, über die das Individuum verfügen kann. Im Zusammenspiel von inneren Prozessen (Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken und Motivationen), situativen Faktoren und interpersonalen Kontexten entwickelt sich die individuelle Psyche.“ (Creydt 2015, 107f) Es folgen dann einige Hinweise darauf, dass in den jeweiligen Lebensphasen massive Ängste, traumatische Erfahrungen oder gravierende Kompetenzmängel auftreten können, um zu dem Resümee zu gelangen: „Für Rationalisten existieren all diese Probleme nicht. Sie stellen sich Handeln als Resultat bewusster Reflexion und Planung vor.“ (Ebd., 108)
Das ist eindeutig falsch. Sowohl in der MG-Publikation als auch in Krölls' Studie werden diese Probleme zum Thema gemacht, wird Kritik zu den gängigen Erklärungen von Neurosen oder Psychosen angemeldet etc. Und bei Krölls wird im sechsten Kapitel (Krölls 2016, 147ff) deren Behandlung durch die entsprechend angeleiteten Therapien ausführlich gewürdigt. Auch die Theorie der Prägung, also die Einwirkung von Faktoren(bündeln) auf den seelischen Apparat, wird bei ihm thematisiert. Ja sie steht gewissermaßen im Mittelpunkt seiner Publikation, denn Krölls greift vor allem das deterministische Menschenbild der Psychologie an. Das ist sein Thema und nicht ein Vorrang des Kognitiven oder der Ratio. In seinem ersten Kapitel geht es z.B. um „Verhalten als Resultante der (kombinierten) Wirkkraft innerer und äußerer Faktoren“ (ebd., 28f). Diese Kritik kann man bei Krölls nachlesen, deshalb sei hier auf eine Auseinandersetzung mit Creydts Vorwürfen verzichtet.
Nur so viel noch: Das Konzept einer rationalistischen Psychologie, wie Creydt es vorträgt, einmal ernst genommen – warum sollte die Zurückführung menschlichen Handelns auf bewusste, willentliche Entscheidungen das Auftreten von Ängsten, Traumata oder Kompetenzmängeln ignorieren (müssen)? Im letztgenannten Falle stellt das Individuum fest, dass ihm eine Kompetenz, also Wissen und Können, fehlt, das Gewollte zu realisieren. In den ersten beiden Fällen stößt es auf feindselige Bestrebungen, die ihm bedrohlich oder verletzend erscheinen, die sein Wohlergehen in Frage stellen etc. Das, was ihm am Herzen liegt, also kurz gesagt: sein Interesse, lässt sich jedenfalls nicht wie gewünscht realisieren. „Bewusst geplante“ Handlung heißt ja nicht, dass es dem Betreffenden gelingt, seine Absicht in eine zufriedenstellende Tat umzusetzen, geschweige denn, das beabsichtige Resultat herbeizuführen. Natürlich gibt es auch „automatisierte Verhaltensweisen“. Krölls hat dies im Diskussionsteil seiner zweiten Auflage (Krölls 2007, 163) nochmals explizit behandelt. Im Fall einer Suchtkrankheit etwa greift der Trinker oder Kettenraucher nicht jedes Mal „bewusst geplant“ zu seinem Suchtmittel. Dieses Verhalten ist ihm zur Gewohnheit geworden, er handelt etwa nach eigenem Verständnis „mechanisch“ – oder macht gleich die Flasche, die von ihm ausgetrunken werden will, oder die Kippe, die ihn anlacht, dafür verantwortlich, bis er dann die Entscheidung trifft, einen Entzug zu machen. Oder er bleibt dabei, seine ganze Willenskraft weiterhin darauf zu konzentrieren, seinen Alltag als Suchtkranker zu organisieren.
Den Pleonasmus „bewusst geplant“ wieder ernst genommen: Wer sein Interesse planvoll verfolgt, registriert natürlich auch die genannten oder andere Negativerfahrungen. Er muss sich dann zu dem Resultat stellen. Die Schwierigkeiten werden vom Individuum bilanziert, eventuell haben sie nachhaltige Konsequenzen, so dass etwa eine Grundsatzentscheidung gefällt wird, die dem weiteren Handeln die Richtung vorgibt. Ängste können sich verfestigen; festgestellte Defizite bei der eigenen Kompetenz können der Ansporn sein, an sich zu arbeiten und zukünftig – z.B. in perfektionistischer Manier – alle Fehler zu vermeiden. Schulkinder, die durch Leistungsbewertung oder Mobbing traumatisiert werden, machen etwa schlechte Erfahrungen bei ihren Bemühungen, in der Schulkonkurrenz voranzukommen. Was daraus folgt, hängt von ihrem eigenen Urteil ab, ob sie z.B. aufgeben oder weitermachen wollen. Ein ganzer schulpsychologischer Dienst steht in der BRD bereit, um ihnen dann auf die Sprünge zu helfen, weiß aber auch, dass es an der Entscheidung des Einzelnen (und, in diesem Fall, seiner Eltern) liegt, ob er bei der konstruktiven Absicht bleibt, sich an der Konkurrenzveranstaltung weiter zu beteiligen, oder ob er dieses Interesse aufgibt und sich auf Grund der negativen Erfahrungen ganz anderen „Daseinsthemen“ zuwendet.
Die dritte Abteilung von Creydts Einwänden beginnt mit einer eigenartigen Feststellung, führt damit aber ins Zentrum seiner Vorwürfe: „Es liegt nahe, gegen rationalistische Vorstellungen mit dem psychoanalytischen Konzept (der entscheidenden Formierung der Psyche in den ersten drei Jahren der Kindheit) zu argumentieren. Allerdings existieren gute Gründe dafür, dieses Modell mit starken Fragezeichen zu versehen.“ (Creydt 2015, 108) Hier wird also nicht wie im Fall Thomae ein Theoriefragment einfach in die Debatte geworfen, um den inkriminierten Rationalismus zu desavouieren. Creydt geht anscheinend mit der Zeit und weiß, dass die Psychoanalyse in der heutigen wissenschaftlichen Psychologie umstritten ist. So lässt ja auch die aktuelle Bestandsaufnahme des Fachs, die Mark Galliker vorgelegt hat, die Psychoanalyse komplett aus (vgl. Galliker 2016). Creydt ist wohl bewusst, dass er sich mit einer umstandslosen Berufung auf die Macht des Unbewussten in tiefe Gewässer begeben würde, denn neben der Infragestellung durch Behaviorismus u.a. hat die mittlerweile existierende Bandbreite orthodoxer oder neoanalytischer Schulen ganz unterschiedliche Vorstellungen von der lebensbestimmenden Kraft frühkindlicher Prägung und der Macht des Es entwickelt. Creydt wählt daher einen etwas umständlicheren Weg. An der klassischen tiefenpsychologischen Theorie will er nicht festhalten, führt stattdessen eine Reihe von Modifikationen dieser Position an, in denen einmal mehr, einmal weniger von Prägung und Determination die Rede ist. Das führt dann zu dem abgeschwächten Resümee: „Das komplexe Weiterleben, die Abwandlungen sowie die Residuen kindlicher bzw. jugendlicher psychischer Verarbeitungsweisen und problematischer 'Bewältigungen' von Konflikten und deren Folgedynamiken sind für Rationalisten kein Thema.“ (Creydt 2015, 110)
Auch hier sei nur auf das Buch von Krölls verwiesen, der die Freudsche Theorie des Unbewussten in einem eigenen Kapitel ausführlich zum Thema macht (Krölls 2016, 49ff) – natürlich kritisch und nicht zustimmend. Krölls hat diese Theorie bereits in der ersten Auflage an den Anfang seiner Kritik gestellt. Er hat sich mit der Konstruktion eines „Seelenapparats“ aus Es, Ich und Über-Ich auseinandergesetzt, die Ableitung des Unbewussten aus einem Mangel des Bewusstseins der Kritik unterzogen sowie die ideologischen Leistungen dieses Ansatzes besprochen. Automatisierte Verhaltens- oder gewohnheitsmäßige Handlungsweisen werden dann, wie erwähnt, im Diskussionsteil der zweiten Auflage zum Gegenstand. Das hat Krölls jetzt übrigens in der dritten Auflage nochmals erweitert; dort findet sich u.a. eine Kontroverse über die „geheime Macht des Unbewussten“ (Krölls 2016, 194ff). Das alles mag Creydt missfallen. Aber dann hätte er sich mit der Kritik auseinanderzusetzen und nicht einfach zu vermelden, dass seine Lieblingsthemen bei den Gegenspielern fehlen.
Im vorliegenden Fall der mehr oder weniger entscheidenden Rolle des Unbewussten ist seine Argumentation besonders haltlos. Er zitiert z.B. einen Arbeitskreis „Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik“ (OPD). Dieser habe herausgefunden, dass „der psychoanalytische Versuch einer 'eindeutigen Zuordnung von Konflikten zu einer Entwicklungsstufe' 'heute als gescheitert angesehen werden'“ muss (Creydt 2015, 110). Bei dem OPD-Arbeitskreis handelt es sich (siehe: www.aerzteblatt.de/archiv/60921) um eine 1992 entstandene Initiative von insgesamt etwa 40 psychotherapeutischen Klinikern und Forschern im deutschsprachigen Raum, die ein System der Diagnostik im Bereich der psychodynamischen/-analytischen Psychotherapie erstellt haben. Solche Absprachen von klinischen Einrichtungen oder therapeutischen Kleingewerbetreibenden mit der Wissenschaft mögen für den Berufsstand (der mit Krankenkassen oder Kassenärztlicher Vereinigung seine Probleme hat) wichtig sein. Eine solche Reaktion auf Klassifikations-, Abstimmungs- und möglicher Weise Abrechnungsprobleme als gesicherte Erkenntnis hinzustellen, ist aber eine überraschende Begründung für die Klärung wissenschaftlicher Streitfragen.
In der wissenschaftlichen Debatte gilt die Psychoanalyse heute tendenziell als veraltet – und auch schon länger als dogmatisch. Will man sich im Mainstream bewegen, lässt man sie nicht einfach gelten, sondern nimmt sie als Ansatz, der interessante Gesichtspunkte beisteuert. Ob die orale, anale oder genitale Phase jeweils zu den von Freud und seiner Schule genannten Kernkomplexen führt, soll nicht behauptet, aber irgendwie Beleg für Determination überhaupt sein: Vielleicht wirkt diese ja nicht hundertprozentig, sondern kann später auch relativiert werden! Hier wird dann eine theoretische Beliebigkeit zugelassen. Creydt kennt nämlich auch andere Möglichkeiten der „Interpretation“ (ebd.), zitiert ein Beispiel dafür, was aber zu keiner Klärung der differierenden Positionen führt, sondern zu dem seltsamen Fazit: Irgendetwas ist am Unbewussten, seiner Formierung in einer frühen Lebensphase und seiner fortwirkenden Kraft – „blue life's energy“ (John Lennon bzw. Wilhelm Reich) – dran, auch wenn man es nicht genau bestimmen kann und die Wissenschaftler sich über diese Frage in die Haaren geraten.
Im zweiten Abschnitt (b), der sich vor allem Huiskens Erklärung der Jugendgewalt und, eher kursorisch, der MG-Publikation von 1981 widmet, wird dann Freud wieder ganz selbstverständlich als Autorität dafür zitiert, dass es vieles gibt, das „die Schwelle zum Bewusstsein nicht überschreitet“ (ebd., 118). Insofern wird klar, was Creydt mit seinem an Krölls gerichteten Vorwurf der „Oberflächlichkeit“ meint. In dessen Buch wird die tiefenpsychologische Unterkellerung des Bewusstseins durch eine steuernde Lebenskraft nicht geteilt, sondern kritisiert. Daher braucht Creydt dessen Buch gar nicht näher zur Kenntnis zu nehmen, um festzustellen, dass es oberflächlich ist. Die Aktivitäten von Wille und Bewusstsein – das ist die dogmatische Vorentscheidung von Creydt – kann man nur erklären, wenn man sich von ihnen ab- und einem Dahinterliegenden zuwendet. Das, was Individuen äußern oder zu erkennen geben, liegt, nach Auskunft von Psychoanalytikern, „an der Oberfläche des Nachvollziehbaren“ (ebd., 116). Creydt stimmt zu und fährt fort: „Tiefere individuelle Beweggründe und psychische Kontexte des Handelns … sind häufig dem Bewusstsein der Betroffenen nur schwer zugänglich. Die Dechiffrierung der psychisch unbewussten Gehalte erweist sich zudem als schwierig“ (ebd., 116f), und zwar aus verschiedenen Gründen. Kurioser Weise kann dies einmal daher kommen, dass es „eine Verschränkung des Symptoms mit dem Gewinn“ gibt, „den es bei allem Leiden mit sich bringt“ (ebd., 117). Hier wird das Individuum in seinem Verhalten also ganz zweckrational erklärt, natürlich auf Basis einer vorgängigen unbewussten Triebsteuerung. Ein anderes Mal wiederum soll es direkt zu einer Regression auf frühere Entwicklungsstufen kommen, sich also unmittelbar die Macht des Unbewussten zeigen. Dazu merkt Creydt dann aber gleich in einer Fußnote an (ebd., 117, FN 42), dass man die regressive Wiederbelebung eines früheren Entwicklungsstandes nicht nur gut tiefenpsychologisch, sondern auch umgekehrt interpretieren kann, nämlich mit Kurt Lewin als „Entdifferenzierung“ angesichts gegenwärtiger Konflikte. Dann habe man ein Individuum vor sich, dass bei der Bewältigung von Schwierigkeiten, also eher bei einem zweckrationalen Vorgang, scheitere.
Was Creydt hier bietet ist – allgemein gesagt – ein Standardverfahren, das im pluralistischen Betrieb der bürgerlichen Wissenschaft anerkannt ist. Man vergleicht fremde Positionen mit der eigenen und misst sie an diesem Maßstab. Kommen die eigenen Herangehensweisen, methodologischen Zurichtungen, die Entdeckung von Forschungsdesideraten, Themen und Topoi auch in den akademischen Unternehmungen anderer vor? Wird die eigene Schwerpunktsetzung oder der besondere Gesichtspunkt, den man für bislang vernachlässigt hält und jetzt in den Vordergrund rücken will, berücksichtigt? Ja, wird man überhaupt als Beiträger zum wissenschaftlichen Diskurs respektiert, der, was immer er inhaltlich zu sagen hat, für seine konstruktive Mitwirkung an der Scientific Community zu würdigen ist?
Dass man die Macht des Unbewussten in Rechnung zu stellen habe, dass sie zwar nicht in ihrer Originalfassung nach Freud, aber in einer allgemeineren Version entscheidend für die Erklärung von Bewusstseinsleistungen sei und somit das Fundament einer wissenschaftlichen Psychologie abzugeben habe, jedenfalls nicht durch Kritik auszuschließen sei, ist Creydts inhaltliche Prämisse. Begründet wird das mit dem Verweis darauf, dass Psychologen – auch wenn sie sich untereinander uneins sind – eine solche These vertreten. Die Kritik, die es daran gibt, so in der Publikation von Albert Krölls, nimmt Creydt nicht zur Kenntnis. Worauf auch immer er mit seinem Buch hinaus will, zur Kontroverse über die Fehler der bürgerlichen Psychologie trägt es nichts bei. P.S. Creydt erwartet in seinem oben zitierten Resümee einer Psychologie, die ihre rationalistische Borniertheit überwindet, dass sie sich der „Erfahrungen und Probleme“ annimmt, „die das In-die-Welt-kommen, die Integration partikularer psychischer Bestände, den Sinn im endlichen Leben und das Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit betreffen“ (Creydt 2015, 112). Dass am Schluss auch noch ein religiöser Tonfall aufkommt, dass im pfäffischen Stil gegen den „Glauben an die Vernunft“ (ebd.) Stellung bezogen wird, ist kein Zufall. Die psychologische Seelenkunde ist eben im christlichen Abendland der Nachfahre der religiösen Seelsorge. Näheres kann man bei Krölls nachlesen, der seinem Buch ja den Untertitel vom modernen „Opium des Volkes“ gegeben hat.
Literatur
- Meinhard Creydt, Der bürgerliche Materialismus und seine Gegenspieler – Interessenpolitik, Autonomie und linke Denkfallen. Hamburg 2015.
- Mark Galliker, Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Ihre Krisen und Kontroversen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden 2016.
- Freerk Huisken, Jugendgewalt – Der Kult des Selbstbewusstseins und seine unerwünschten Früchtchen. Hamburg 1996.
- Freerk Huisken, Erziehung im Kapitalismus – Vom unbestreitbaren Nutzen unserer Lehranstalten. Studienausgabe der Kritik der Erziehung Bd.1 und 2. Hamburg 1998.
- Freerk Huisken: z.B. Erfurt – Was das bürgerliche Bildungs- und Einbildungswesen so alles anrichtet. Hamburg 2002.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. (Erstausgabe 2006) Erw. Neuaufl., Hamburg 2007.
- Albert Krölls, Kritik der Psychologie – Das moderne Opium des Volkes. 3., akt. und erw. Aufl., Hamburg 2016.
- MG – Marxistische Gruppe, Die Psychologie des bürgerlichen Individuums. München 1981.
- Hans Thomae, Das Individuum und seine Welt – Eine Persönlichkeitstheorie. Göttingen 1968.
Streitfall Finanzkapital
Seit der 2007er Krise gibt es wieder vermehrt Kritik am Finanzkapital, seit Februar 2016 liegt die einschlägige Gegenstandpunkt-Veröffentlichung „Das Finanzkapital“ vor. Zu Diskussionsstand und -bedarf hier einige Hinweise der IVA-Redaktion.
Seit dem Aufschwung der Globalisierungsrhetorik in den 1990er Jahren und spätestens seit der Finanzkrise 2007/08 ist die Macht des Finanzkapitals wieder zu einem Thema geworden, das die Öffentlichkeit bewegt. Diese Entwicklung hat sich auch in einer Reihe von kritischen Publikationen niedergeschlagen (vgl. Huffschmid 1999, Stiglitz 2002, Sandleben 2003, Zeise 2008, Lueer 2009, Altvater 2010, Graeber 2012, Lohoff/Trenkle 2012, Bischoff 2014). Die letzte größere Veröffentlichung „Das Finanzkapital“ (Decker u.a. 2016) erfolgte – nach diversen Vorarbeiten und Teilveröffentlichungen im Zuge der fortschreitenden Finanz- und Wirtschaftskrise – Anfang des Jahres durch Autoren der Zeitschrift Gegenstandpunkt (siehe auch den Mitschnitt der Buchpräsentation in Nürnberg vom 3. März 2016, online unter: www.argudiss.de). Zum Diskussionsstand bzw. -bedarf im Folgenden einige Hinweise.
Öffentliche Diskussion
| „Gleich wird dieser Bankenpalast zertrümmert werden. Nein, doch nicht. Gleich wird er stürzen! Nein. Doch nicht. Schon ist das Geld aus dem Palast! Nein, doch nicht. Doch!“ Elfriede Jelinek (Honegger u.a. 2010, 322) |
Zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise legte Lucas Zeise, der neue Chefredakteur der DKP-Zeitung UZ, die Erstausgabe seiner Studie „Ende der Party – Die Explosion im Finanzsektor und die Krise der Weltwirtschaft“ vor, wie Junge-Welt-Chefredakteur Arnold Schölzel lobte, „eine der ersten und besten Analysen des sich damals noch anbahnenden Desasters“ (JW, 6.10.2010). Mittlerweile gibt es eine dritte, aktualisierte und erweiterte Ausgabe (Zeise 2013), die die grundsätzliche Argumentation beibehalten hat. Zeise setzte 2008 mit seinem „Versuch über die Politische Ökonomie des Finanzsektors“ bei den aktuellen Krisenentwicklungen an – nahe liegender Weise, denn damit ist die Finanzwelt neu in den Blick genommen und zum Gegenstand öffentlicher Aufregung geworden. Problematisch war dagegen, dass Zeise die öffentliche Diskussion gleich für seine kritisch gemeinte Analyse vereinnahmte. Denn dass „die These von der Herrschaft des Finanzkapitals – in dieser oder jener Formulierungsvariante – mittlerweile Allgemeingut“, ja „Teil des Alltagsbewusstseins geworden“ sei (ebd., 9), wie er schreibt, ist zu bezweifeln.
Was nämlich von der Bildzeitung bis zur Suhrkamp-Kultur (vgl. Honegger u.a. 2010), von eher reißerisch aufgemachter Aussteigerliteratur (vgl. Anne T. 2009) bis zu Elfriede Jelineks 2009 in Köln uraufgeführtem Theaterstück „Die Kontrakte des Kaufmanns“, ins Kraut schoss, war weniger die Anklage einer finanzkapitalistischen Hegemonie als die Entdeckung einer (wirtschafts-)kriminellen Energie in Folge moralischer Verkommenheit, die im „Bankster“ (Bild), im Offshore-Investor oder im gemeinen Spekulanten, aber letztlich in uns allen hausen soll. Das Stück von Jelinek z.B. ergeht sich, folgt man den Theaterrezensionen – „freundliche Folter“ (Die Welt, 17.4.2009), „hochgestimmte Langeweile“ (Die Zeit, 23.4.2009), „zermürbende Monotonie“ (FAZ, 18.4.2009) –, endlos kalauernd im Spiel mit der modernen Gutgläubigkeit. „Wir haben Ihnen 15 % per annum versprochen, und das haben Sie geglaubt!“, ruft höhnisch der Chor der Banker aus – und fügt sich damit bestens in die gängige Klage über die allgemeine Gier ein.
Jelinek veröffentlichte einen Epilog zum Theaterstück unter dem Titel „Schlechte Nachrede: Und jetzt?“, abgedruckt als Nachwort zu den „Berichten aus der Bankenwelt“, die Sozialwissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengestellt hatten (Honegger u.a. 2010). Auch in dieser Sammlung repräsentativer Statements geht es meist um Schuldzuweisungen, die an die eigene Adresse, an diverse Verantwortliche, aber auch an „den Menschen“ oder „die Globalisierung“ allgemein gerichtet werden. Die 31 anonymisierten Porträts bieten dazu eine bunte Mischung. Manche Interviewpartner aus der Finanzwelt äußerten, so die Herausgeber, „unter dem Schutz der Anonymität und noch unter Schock stehend eine erstaunlich scharfe Kritik an den Gepflogenheiten ihrer Branche… Andere freilich zeigten sich bereits erstaunlich resistent gegen Vorwürfe von außen.“ (Ebd., 12)
Die Branche soll sich schämen – das wurde zum kategorische Imperativ der modernen Aufklärung und das wurde kongenial von der Dichterin Jelinek in ihrem Nachwort aufgegriffen. Jelinek geißelt gleichzeitig die Dreistigkeit der Finanzbranche und die Gutgläubigkeit des Publikums. Die Textcollage, in der verschiedene Monologe zusammengeschnitten sind, bringt den Widerwillen gegen den modernen Tanz ums goldene Kalb – immer wieder neu ansetzend, mit allerlei Wortspielereien und bildhaften Wendungen – zum Ausdruck: „Die Bank als dionysischer Kultraum? Lese ich recht, oder habe ich das erfunden? Lese ich das etwa bei mir selber? Toll! So was Schönes habe ich ja noch nie erfunden! So haben wir das ja noch nie gesehen! Die Bank als Kirche, welche außer sich gerät… Ehren Sie bitte den Gott des Geldes!“ (Ebd., 321) Jetzt, wo die Sache schief gegangen ist, empört sich der gesunde Menschenverstand bzw. das noch gesündere Volksempfinden und die Künstlerin setzt der Klage über den Niedergang der Sitten die Krone auf: Alle sollen in sich gehen, alle bekommen den Spiegel vorgehalten. Dem Kunstkonsumenten wird der Finanzskandal um die Ohren gehauen, er soll sich nicht einfach wie der Bildzeitungsleser über die Verkommenheit der anderen aufregen. Tja, alles ist eitel, wie schon Gryphius wusste, um die wahren Werte kümmert sich mal wieder kein Schwein.
Solche quälenden Höchstleistungen der Literaturnobelpreisträgerin sind übrigens nicht weit von der populären Enthüllungsliteratur entfernt. In den 1990er Jahren veröffentlichte z.B. Nick Leeson, der als Derivatehändler seinen Arbeitgeber, die britische Barings-Bank, mit Millionenverlusten an den Rand des Ruins gebracht hatte – von heute aus gesehen eine eher kleinkarierte Affäre –, sein halbseidenes Enthüllungsbuch „Rogue Trader“ (auf Deutsch: „Schurkenhändler“, vgl. Leeson 1997). Es war recht erfolgreich und wurde auch umgehend verfilmt („High Speed Money“, GB 1998). Hollywood entwickelte das dann in den nächsten Jahren, als der Bedarf nach solcher Unterhaltung zunahm, schöpferisch weiter. Solche mit viel Ghostwriter-Unterstützung verfassten Informationen bedienen ein Publikumsinteresse, das sich Pleiten und Pannen der Marktwirtschaft als menschliches Drama zu Gemüte führen will, und gehören damit zur Gegenaufklärung. Das Genre wurde in Deutschland nach der Finanzkrise etwa von Anne T. (2009) mit ihrer biographisch unterfütterten Enthüllung über die grenzenlose Gier der Bankster fortgeschrieben.
Auch hier hat man es erkennbar mit einem halbseidenen Text zu tun. Man weiß nämlich nicht, ob überhaupt ein Wort des Rückblicks stimmt. Die Angaben sind anonymisiert – T.s Arbeitgeber heißt z.B. „Die Bank“: wer das wohl sein mag?! – und laut Verlagsmitteilung „verfremdet“: Alle in dem Buch beschriebenen Ereignisse hätten sich „so oder in sehr ähnlicher Weise bei Banken in Deutschland abgespielt.“ Aber das macht nichts, in dem Buch stimmt jedes Wort, es ist nämlich die naturgetreue Ausmalung einer Dummheit, die mit der öffentlichen Debatte zu höchsten Ehren gelangt ist. Die finanzkapitalistische Branche, hier die Kreation und der Verkauf von „strukturierten Finanzprodukten“, wird in einen Kampf zwischen der bösen Gier und der moralischen (Rest-)Gesinnung ihrer Akteure verwandelt. Deren Innenleben ist also der Schauplatz der Entlarvung und nicht das Börsenparkett, über dessen Machenschaften man nur wenig bis nichts erfährt. Die Aussteigerin T. möchte lieber die Legende pflegen, sie und ihre Kollegen hätten, unbemerkt vom Rest der Welt und im Interesse eigener Boni, schwindelhafte, auf jeden Fall überteuerte Papiere einem unwissenden Publikum angedreht und so die Krise geschaffen.
Die Sache mit der allgemein verbreiteten Gier ist, wie sich dabei zeigt, eine Lüge. Die Neugier der Autorin Anne T., die Begierde, wissen zu wollen, was dieser 'Kasinokapitalismus' ist, wo er herkommt und wie er in die Krise gerät, hält sich nämlich sehr in Grenzen. Und auch die Neugier des Publikums wird nicht befriedigt, weder sachlich noch im Blick auf die Skandalchronik, die eingangs mit Verweis auf „American Psycho“ (Ellis 1999) versprochen wird. Der Roman von Brett Easton Ellis über das Leben eines Wall-Street-Yuppies war übrigens in Deutschland – interessanter Weise, was aber kaum jemanden im Literaturbetrieb interessierte – wegen einer Bundesprüfstellen-Indizierung für mehrere Jahre nicht erhältlich, da mit einem faktischen Verkaufsverbot belegt, das erst 1998 aufgehoben wurde. Stein des Anstoßes war für die Jugendschützer die Gewalttätigkeit von „American Psycho“, obwohl sie kaum über dem Level von Stephen-King-Romanen liegt, nur etwas spannungsfreier vorgetragen wird. Bezeichnend, dass die Verbreitung eines solchen Opus' in einer freiheitlichen Marktwirtschaft unterbunden wird! Der Roman leistet zwar keine kritische Analyse der Wall-Street, tritt aber mit einer radikalen Enthüllungs-Pose an – und hat damit gewissermaßen das Paradigma des modernen Bankster-Bashings geschaffen. Logisch, dass sich die deutsche Finanz-Aussteigerin auf solche literarischen Beispiele bezog. An menschlichen Abgründen wird aber bei Anne T. außer ein paar Herrenwitzen und Körpergerüchen aus der (gehobenen) Angestelltenkultur nichts geboten. Statt dessen hat die Autorin wohl einige Textbausteine aus den Seminararbeiten ihres BWL-Studiums aufgehoben, um die wohltätige Wirkung einer domestizierten Finanzwirtschaft darzulegen. Da gibt es dann Entdeckungen nach dem Muster „Hirnforscher haben herausgefunden, dass die Gier nach Geld ein ähnliches Suchtpotential hat wie Kokain oder Sex“ (Anne T. 2009, 217).
Was hier beispielhaft aus der öffentlichen Diskussion genannt wurde lässt sich wohl kaum als „Teil des Alltagsbewusstseins“ von der „Herrschaft des Finanzkapitals“ verbuchen. Die Krise hat von sich aus und durch ihre öffentliche Begleitmusik kein kritisches Bewusstsein geschaffen. Das sieht Zeise umgekehrt. Wie nach der Weltwirtschaftskrise von 1929ff heiße es jetzt: „So wie bisher kann es nicht weitergehen. Da das so ist, ergibt sich die einfache These: Die Krise markiert das Ende des Neoliberalismus.“ (Zeise 2013, 7) Eine erstaunliche Mitteilung! Gerade von Neoliberalismuskritikern wird zeitgleich das „befremdliche Überleben des Neoliberalismus“ (Crouch 2011) konstatiert. Heiner Flassbeck schreibt: „Gibt es eine ökonomische Krise, sind ihre Mythen nicht weit.“ (Flassbeck 2012, 7) Zeise schränkt seine Feststellung zwar dahingehend ein, dass der Neoliberalismus ökonomisch, nicht politisch am Ende sei. Doch soll sich insgesamt und bis in Finanzkreise hinein das Bewusstsein vom prekären Charakter des Kapitalismus verbreitet haben. Selbst in diesen Kreisen gebe es mittlerweile die Auffassung, „dass das Finanzkapital zu viel Macht hat, zu dominant ist und deshalb strengerer Kontrolle unterworfen werden sollte.“ (Zeise 2013, 9) „Diese Leute haben Recht, wird in diesem Buch argumentiert“ (ebd.). Das hält Zeise eingangs fest und charakterisiert damit seine Analyse als einen Versuch, den finanzskeptischen Zeitgeist zu be- und verstärken.
Das macht einen deutlichen Unterschied zur Publikation von Decker und Co. Sie geht gerade nicht von einem halbwegs aufgeklärten Bewusstsein aus, an das man anschließen könnte. Wenn die allseits geschätzte Finanzbranche in die Krise gerate und dies gesamtwirtschaftliche Konsequenzen habe, dann sei, so heißt es im Vorwort, „den Bankern die Missgunst einer undankbaren Öffentlichkeit sicher.“ (Decker u.a. 2016, 3) Dann würden Politiker über die Schäden für die „Realwirtschaft“ klagen, dann würde vor „Heuschrecken“ gewarnt, dann seien verdiente Spitzenmanager des Finanzkapitals auf einmal dubiose Gestalten. „Und alle Welt weiß, dass da eine elitäre Elite ihr Recht auf Gewinn in einer ganz unberechtigten Gier auf Kosten der Dienste geltend macht, die sie uns allen schuldet, weil wir alle darauf angewiesen sind. Was also wieder für die Branche spricht, soweit sie ihr Geschäft mit ihrer anerkannten Unentbehrlichkeit für das gesamte Wirtschaftsleben macht.“ (Ebd.)
Klärungsbedarf
| „Was nicht immer so weiter gehen kann, geht irgendwann einmal nicht mehr weiter.“ Lucas Zeise (2013, 190) |
Trotz dieser deutlichen Differenz gibt es bei beiden Publikationen eine Gemeinsamkeit. Beide gehen von der Kapitalismuskritik aus, wie sie Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie grundgelegt hat. Die Gegenstandpunkt-Autoren schreiben, dass die finanzkapitalistische „Art der Bereicherung unerlässliche Bedingung und Hebel des kapitalistischen Wachstums, der Mehrung von Geldreichtum“ (Decker u.a. 2016, 4) sei und nicht einen fremden Gesichtspunkt ins Wirtschaftsleben einführe. „Der Bedarf, den das Bankgewerbe bedient, entsteht im gewöhnlichen marktwirtschaftlichen Geschäftsleben“ (ebd., 5), wo Lohnarbeit so eingesetzt werde, dass sie einen gewinnträchtigen Erlös einspielt. (In den früheren Fassungen des Buchs, die als Zeitschriftenartikel 2008-2011 erschienen und die man auf der GS-Homepage unter www.gegenstandpunkt.com/vlg einsehen kann, gibt es auch ausführlichere Bezugnahmen auf die Marxschen Schriften.) Um das Finanzkapital zu verstehen, schreibt Zeise, „braucht es eine einigermaßen schlüssige Theorie über das Geld. Dabei orientiert sich der Autor im Grundsatz an Karl Marx“ (Zeise 2013, 10). Und er leitet seine Analyse so ein: „Wenn man mit Marx beginnt, ist die Herangehensweise in einem Punkt klar. Die grundlegende Kategorie der Ökonomie ist die Arbeit.“ (Ebd., 11) Wie man von diesem Ausgangspunkt zu einer einleuchtenden Erklärung der Finanzwelt gelangt oder auch nicht, soll im Folgenden exemplarisch an den beiden genannten Publikationen verdeutlicht werden.
Zeise steigt mit einer Skizze der Marxschen Theorie ein (2. Kapitel). Entscheidend sei, dass Marx „zeigt, wie Kapital durch die Nutzung der Ware Arbeitskraft sich mehrt und die Gesellschaft bestimmt“ (ebd., 17). Das folgenden Kapitel, das sich der Vorstellung diverser Theorien (Neoklassik, Keynesianismus, Monetarismus…) widmet, beginnt mit der Feststellung „Karl Marx erklärt das Kapital aus dem Geld“ (ebd., 18). Im Kontrast dazu ergibt Zeises Resümee der einschlägigen Theorien, dass die Wirtschaftswissenschaft, die auf Marx folgte, nicht nur an dessen Erklärung, sondern überhaupt an der Lösung des „Geldrätsels“ desinteressiert war. Geld wurde funktionalistisch als vermittelnde und sich damit letztlich herauskürzende Größe im Güterkreislauf betrachtet, der, solange er nicht von außen gestört werde, zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht tendiere. Erst zur Mitte des 20. Jahrhunderts, nach den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise, habe sich mit John Maynard Keynes ein Wissenschaftler durchgesetzt, der dieser Ignoranz entgegen getreten sei. Dessen Theorie habe zwar auch keine „überzeugende Darstellung und begriffliche Klärung von Geld und Zins“ geliefert, aber immerhin darauf aufmerksam gemacht, „dass mit der Existenz des Geldes die Möglichkeit eines die gesamte Volkswirtschaft umfassenden Ungleichgewichts (zwischen Güterangebot und -nachfrage) entsteht“ (ebd., 32).
Dem folgt ein kurzes 4. Kapitel, das den „marxistischen Geldbegriff“ vorstellen will und dafür das Wertgesetz aus dem „Kapital“, Band 1 (MEW 23), und Aussagen zur Entstehung des Papiergelds aus Band 3 (MEW 25) resümiert, mit dem Ergebnis: Geld ist das allgemeine Äquivalent in einer Tauschwirtschaft, ursprünglich selber eine Ware, deren Wert durch die zu ihrer Herstellung erforderliche gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt ist und die als Wertausdruck der restlichen Warenwelt gegenübertritt. Zeise interessiert sich hier aber weniger dafür, dass mit dem Geld der gültige Maßstab, der Zweck und die eigentliche Materie der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion etabliert werden – eben die Besonderheit des „abstrakten Reichtums“ (Marx), die den Kapitalismus von früheren Produktionsweisen unterscheidet –, statt dessen konzentriert er sich auf die Entwicklung der zunächst ans Edelmetall fixierten Geldware hin zum Papiergeld. Letzteres hat selber keinen Wert, es repräsentiert zwar ursprünglich Gold- und Silberschätze der Banken, hat sich aber mittlerweile davon emanzipiert. In der modernen Form eines von einer Notenbank ausgegebenen gesetzlichen Zahlungsmittels, das allein durch staatliche Hoheit in die Welt kommt, sei es Kreditgeld. Und Zeise legt Nachdruck darauf, dass diese Rolle als Kreditmedium von Marx bereits in der Warenanalyse des „Kapital“, Band 1, in den Blick genommen wurde: „Kredit oder fiktives Kapital oder Anspruch auf den Profit (was alles dasselbe ist) hat sich zum allgemeinen Äquivalent entwickelt.“ (Ebd., 61)
Dass Geld im Kapitalismus per se mit dem Anspruch auf Vermehrung unterwegs ist (und dass zudem Kredit, ein Zahlungsversprechen, mit Kapital gleichgesetzt wird), wäre eigentlich ein erklärungsbedürftiger Sachverhalt – sowohl im Blick auf die 'Realwirtschaft' als auch auf den finanzkapitalistischen 'Überbau'. Was jetzt aber folgt geht in eine andere Richtung. Zunächst gibt es ein längeres (5.) Kapitel, das die verschiedenen 'Produkte' der Finanzwelt (Wertpapiere, d.h. vor allem Anleihen und Aktien; Versicherungen; Fonds, hier natürlich die berüchtigten Hedge- und Privat-Equity-Fonds; Derivate mit ihren vielen Unterabteilungen) aufmarschieren lässt. Man kann das als einführende Information betrachten. Doch leitet es gleich zum Hauptteil des Buchs (6. und 7. Kapitel) über, der sich einem anderen Thema zuwendet. Jetzt geht es um die „kapitalistische, neoliberale Geldverfassung“ (ebd., 91ff) und um den „Neoliberalismus und seine Krise“ (ebd., 128ff), also um Etappen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Darauf folgt ein kürzeres 8. Kapitel („Die Gewinne des Finanzsektors“), das die eigentliche Kernfrage einer Finanzkapital-Theorie zur Sprache bringt. Zeise fragt danach, „ob und wie die Profitmacherei in dem als Finanzkapital auftretenden Kapital von derjenigen des gemeinen Industrie- und Handelskapital sich unterscheidet.“ (Ebd., 161f) Aber auch diese Fragestellung verschiebt sich gleich wieder, denn „das eigentliche Rätsel besteht darin, wie es dem überproportional wachsenden Finanzsektor gelingt, über viele Jahre, ja mehrere Jahrzehnte hinweg enorme, überproportionale Gewinne zu generieren.“ (Ebd., 167) Die beiden abschließenden Kapitel (9. und 10.) behandeln dann wie schon zuvor die Wirtschaftspolitik, jetzt vor allem unter der Perspektive einer nachhaltigen Regulierung.
Den Schlusspunkt des Buches bildet die Feststellung, „dass es im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft mit nicht allzu vielen Eingriffen möglich wäre, den Finanzteil der Ökonomie einzuhegen“ (ebd., 222). Die ganze Kritik läuft also darauf hinaus, dass dieser Teil des modernen Kapitalismus zu groß ist, dass die dort erzielten Gewinne zu hoch sind, dass die Kontrolle über das Bankenwesen und die Regulierung des Finanzgeschäfts – trotz vollmundiger Ankündigungen seit Ausbruch der Krise – politisch nicht ernsthaft betrieben werden und dass die Macht des Nationalstaates zur Steuerung der internationalisierten Kapitalströme unzulässiger Weise beschränkt worden ist. Wider alle ökonomische Vernunft halte man am eingeschlagenen Weg fest. Dabei würde es sogar das Interesse des industriellen Kapitals gebieten, „die Banken, Schattenbanken, Heuschrecken usw. endlich an die Kandare zu nehmen. Nichts davon geschieht.“ (Ebd., 223) Die Lösung des Rätsels – dass eine Regulierung unterbleibt, die das Gebot der Stunde ist und gewissermaßen mit vier Handgriffen, die das Schlusskapitel erläutert, umzusetzen wäre – ist für Zeise ganz einfach: „Nach mehr als zweihundert Jahren Kapitalismus, davon mehr als dreißig Jahren Neoliberalismus, sind die Interessen der großen, wirklich reichen Kapitaleigner vollständig mit denen der Verwalter ihres Geldes zusammengewachsen.“ (Ebd.)
Die befremdliche Anlage samt Konsequenz des Buches hat zwei Gründe. Erstens unterscheidet Zeise grundsätzlich bei der Zwecksetzung des Kapitaleinsatzes – je nach Zugehörigkeit zur Finanz- oder zu den sonstigen Sphären. Wird Ware produziert, ist das ein Pluspunkt, Wertpapierproduktion erhält dagegen einen Malus, obwohl nach Auskunft von Marx beide dasselbe herstellen: Wert. Eigentlich müsste sich, so sieht es Zeise, das produktive und Handelskapital dem Zugriff der ausgeuferten, hypertrophierten Finanzbranche widersetzen, so als ob sein Interesse dem dort gültigen zuwiderlaufen würde. Obwohl eingangs die gemeinsame Grundlage – Geld ist Kredit – kategorisch benannt (und weniger erklärt) wurde, legt der Autor im Folgenden großen Wert auf Differenzierung. Dabei ist ihm aus dem Faschismus oder der Freiwirtschaftslehre Silvio Gesells die politische Brisanz eines solchen Differenzierungsbedürfnisses bekannt, das etwa bei der NSDAP zur Scheidung des „raffenden“ vom „schaffenden“ Kapital führte. Eine derartige Unterscheidung werde „nachgerade gefährlich, wenn sie den Gegensatz vom guten, realwirtschaftlichen Kapital und dem bösen Finanzkapital verabsolutiert.“ (Ebd., 33) Dem will sich Zeise nicht anschließen. Bemerkenswert offen gibt aber seine Formulierung zu erkennen, dass für ihn nicht die Konstruktion eines moralischen Gegensatzes im Profitprinzip das Problem ist, sondern die Verabsolutierung dieser Differenz.
Das Grundanliegen des Buchs – Regulierung der Finanzsphäre tut Not – führt zur Entdeckung von lauter Fällen, wo ein eigentlich gutes, schutzwürdiges Kapitalinteresse durch die Machenschaften des Finanzgewerbes unter die Räder gerät. Das beginnt mit dem Lob Franz Münteferings für seine Diagnose von den „Heuschreckenschwärmen“ der ausländischen Finanzinvestoren, die über deutsche Firmen „herfallen, sie abgrasen und weiterziehen“ – „vermutlich eine der wenigen klugen und kritischen Feststellungen, derentwegen man den ehemaligen Vorsitzenden der SPD in Erinnerung behalten wird“ (ebd., 75). Maßnahmen gegen ein solches parasitäres „Abgrasen“ machen neben der Krisenverhinderung den wesentlichen Inhalt von Zeises Regulierungsvorschlägen aus. Es ist ihm nämlich „nicht egal, ob ein mittelständisches Unternehmen Fremdkapital aufnimmt, um eine Fertigungshalle zu erweitern, oder ob eine Heuschrecke Geld geliehen erhält, um die Mehrheit an diesem mittelständischen Unternehmen zu erwerben“ (ebd., 200). So kommt auch bei einem Marxisten der legendäre deutsche Mittelstand, den man aus den Sonntagsreden über die Vorzüge der Marktwirtschaft kennt, zu Ehren. Und am Schluss ist es der Nationalstaat, der, wie in dem Beispiel anklingt, den globalisierten Finanzströmen entgegentreten und die Bedürfnisse 'seiner' Volkswirtschaft in den Blick nehmen soll. Hier kennt Zeise schließlich auch Notwendigkeiten einer ökonomischen Renationalisierung, wenn er die nationalen Notenbanken stärken und sie der direkten staatlichen Kontrolle, etwa dem Finanzministerium, unterstellen will (vgl. ebd., 179, 214, 222ff).
Zweitens ist Zeises Buch, wie die Einleitung deutlich macht, gar nicht so sehr auf den ökonomischen Sachverhalt Finanzkapital und dessen geschäftliche Besonderheiten im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaft fokussiert. Es nimmt vielmehr einen wirtschaftspolitischen Steuerungsmodus ins Visier, dem der Prozess gemacht werden soll: Der Neoliberalismus ist als unfähiges Konzept auszumustern. Obwohl noch in der wirtschaftswissenschaftlichen Revue des 3. Kapitels eine Ahnung davon aufscheint, dass man es beim „Neoliberalismus“ mit der Etikettierung einer wissenschaftlichen Schule zu tun hat, auf die sich Politiker beim Managen des Kapitalismus berufen, wenn es ihnen passt, geht der Rest des Buchs davon aus, dass hier eine ideologische Verirrung der Regierenden vorliegt, eine praktisch gültige Steuerungskonzeption, die der kapitalistischen Realität völlig unangemessen sei. In Zeises Text fällt zwar gelegentlich der marxistische Terminus der „Überakkumulation“ (ebd., 215), das bleibt aber folgenlos. Dabei wird hiermit signalisiert, dass die Krisentendenzen dem Kapitalismus immanent sind – unabhängig vom wirtschaftspolitischen Selbstverständnis der Eliten. Selbst dem früheren Chef der US-Notenbank Alan Greenspan fiel ja bei der Finanzkrise die Kontinuität des Geschehens ein. Die Märkte verhielten sich, so Greenspan (SZ, 21.5.2010), wie bei früheren Panikattacken, die 1837, 1907, in der Weltwirtschaftskrise oder dann wieder Ende des 20. Jahrhunderts Amerikas Wirtschaft erschütterten. Und der Wirtschaftsjournalismus steuerte dazu Erinnerungen an die große US-Finanzkrise von 1907 bei, als es zu einem Crash kam, weil „die großen Banken-Trusts die staatliche Bankenregulierung kunstvoll umgangen hatten“ (ebd.) – also lange bevor der Neoliberalismus die Politik in seinen Bann schlug.
All das ist Zeise bekannt. Es interessiert ihn aber nicht. Seine theoretischen Anstrengungen zielen auf etwas anderes. Er sieht hinsichtlich der politökonomischen Grundfragen keinen großen Erklärungsbedarf; er will z.B., wenn es nach den ungewöhnlich hohen Profiten des Finanzkapitals um dessen Verhältnis zum Staat geht, „ein paar Sätze grundsätzlicher Art zur Beziehung von Nation, Staat, Geld und Finanzinstitutionen“ beisteuern (ebd., 178). Sie sollen aber nur „hinführen zu der eigentlich interessierenden Frage, welche Möglichkeiten und Chancen es gibt, die Krise des Neoliberalismus in sein Ende zu verwandeln“ (ebd.). Ein eigenartiges Programm! Die Suche nach „Möglichkeiten und Chancen“ ist nicht nur ein Pleonasmus, sondern auch eine Verabschiedung vom theoretischen Unterfangen. Zudem waltet hier eine eigentümliche Dialektik. Die Wucht der 2007er Krise deutet laut Zeise „darauf hin, dass es sich hier um eine finale Krise dieses Regulierungsmodells handelt“ (ebd., 177). Einerseits ist der Neoliberalismus also am Ende, andererseits überhaupt nicht, denn er muss erst noch von der Macht verdrängt werden. Seine (Selbst-)Täuschung, er könnte den Kapitalismus krisenfrei und in einem allgemeinen Sinne wohlstandssteigernd managen, will Zeise nicht anhand der kapitalistischen Realität blamieren, sondern durch ein besseres Konzept ersetzen. In den Zeiten vor der 'Machtergreifung' des Neoliberalismus Anfang der 1980er Jahre entdeckt Zeise Regelsysteme, „mit denen sich Staaten vor Finanzkrisen (und vor Übergriffen ausländischen Finanzkapitals) geschützt haben“ (ebd., 197).
Zeise kennt die mittlerweile 200jährige Krisengeschichte des Kapitalismus. Alle möglichen wirtschaftspolitischen Rezepte wurden in dieser Zeit ausprobiert – unabhängig davon, welcher wissenschaftlichen Schule sich die Macher jeweils zuordneten. Auch die inkriminierten neoliberalen Politiker haben seit den jüngsten Krisen der 1990er Jahre in Amerika, Fernost oder Europa vielfach Experimente mit Konjunkturprogrammen oder staatlicher Nachfragesteuerung veranstaltet, wie Zeise zu berichten weiß. In dem Sinne, könnte man festhalten, gibt es also gar keinen neoliberalen Steuerungsmodus. Die Macher an der Macht reagieren relativ ideologiefrei auf die Notwendigkeiten, die ihnen die Verwaltung eines nationalen Kapitalstandorts in der globalisierten Konkurrenz beschert. Sie können auch ganz brutal, wie Zeise an den offiziellen Reaktionen nach der Finanzkrise belegt, über ihr 'dummes Geschwätz von gestern' hinweggehen und Neues ausprobieren. Anders gesagt: Neoliberalismus gibt es nur als ideologischen Überbau einer wirtschaftspolitischen Steuerung. Und als Ideologie ist er, wie Zeise zu seinem Bedauern feststellt, keinesfalls in der Krise, kann auch gar nicht in die Krise geraten – jedenfalls solange nicht, wie sich die Vorstellung einer effektiven, ökonomische Krisen und Kollisionen vermeidenden Steuerung des Kapitalismus hält. Dass diese Vorstellung weiterhin mit Leben erfüllt wird, dazu trägt Zeise mit seinen Vorschlägen leider bei. Eine vernünftige Regulierung wäre möglich, das ist sein Fazit. Dafür schreckt er auch nicht vor reaktionären Konsequenzen zurück, setzt auf eine Renationalisierung – „ein solcher planvoller Rückbau des Finanzsektors ist vermutlich nur durch den Nationalstaat möglich“ (ebd., 216) – und kann der Restauration des Kapitalismus im Adenauerstaat sogar idyllische Züge abgewinnen: „Ein streng regulierter, kleinteiliger Finanzsektor mit festgelegten Zinssätzen könnte das jetzige System ersetzen und an Westdeutschland in den 60er Jahren erinnern“ (ebd., 217).
Am Schluss landet Zeise also genau bei dem Punkt, den die Gegenstandpunkt-Veröffentlichung gleich eingangs ins Visier nahm: Alle Aufregung kürzt sich darauf zusammen, dass eine parasitäre Clique „ihr Recht auf Gewinn in einer ganz unberechtigten Gier auf Kosten der Dienste geltend macht, die sie uns allen schuldet“ (Decker u.a. 2016, 3): Statt als kleinteiliges, nicht überdimensioniertes Gewerbe den produktiven Sektor, speziell den ehrbaren, durch Erweiterungsinvestitionen Arbeitsplätze schaffenden Mittelstand zu fördern, denken die Agenten der transnationalen Finanzströme nur an ihre eigene Bereicherung; statt auf langfristigen Kapitaleinsatz zu setzen und eine reguläre Mehrwertproduktion in die Wege zu leiten, arbeiten sie mit kurzfristigen Exit-Optionen und bringen damit große Unsicherheit ins Wirtschaftsgeschehen, jedenfalls eine wesentlich größere, als sie dann gegeben wäre, wenn der 'normale' Kapitalismus mit tendenziellem Fall der Profitrate, periodischer Überproduktion etc. seinen Gang ginge.
Die anfangs angesprochene Gemeinsamkeit der beiden Publikationen ist also nur formaler Natur. Die Berufung auf Marx, der Rekurs auf die Kritik der politischen Ökonomie, bedeutet jeweils Verschiedenes. Mit Marx zu beginnen, heißt es bei Zeise, habe eindeutige Konsequenzen für die Herangehensweise: „Die grundlegende Kategorie der Ökonomie ist die Arbeit.“ (Zeise 2013, 11) Die grundlegende Kategorie, mit der Marx im „Kapital“ beginnt, ist das allerdings nicht, sondern der Wert, der aus der Warenanalyse erschlossen wird. Mit der Besonderheit der Ware, die den Stoff des finanzkapitalistischen Geschäfts ausmacht, mit dem Geld, beginnt daher die Analyse von Decker und Co. Damit ist bei ihnen gleich das normale marktwirtschaftliche Geschäftsleben im Blick, das unter Einsatz von Lohnarbeit und Verbrauch von Naturstoff Geschäftsartikel herstellt, die sich auf dem Markt als Ergebnis rentabler Arbeit erweisen, also mit einem Zuwachs gegenüber dem ursprünglich eingesetzten Geldbetrag erlösen lassen. Eine andere Darstellungsart hat übrigens die Gegenstandpunkt-Publikation über „Arbeit und Reichtum“ gewählt (vgl. Wirth/Möhl 2014, 72ff), die vom 'Sachzwang' der Lohnarbeit ausgeht und dann aufs „Arbeiten unter dem Kreditsystem“ (ebd.) zu sprechen kommt.
Solche Darstellungsalternativen sind aber nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass sich an der „Basis des Kreditsystems“, so der Titel des ersten Kapitels bei Decker u.a., zeigen lässt, wie sich die besondere Ware, die Geldhäuser anzubieten haben, auf den normalen Zweck dieser Wirtschaftsordnung bezieht und keine Abweichung davon darstellt. Die vom Staat verfügte Eigentumsordnung schützt auch dieses Eigentum, das zunächst aus der Fixierung eines Verleihaktes besteht, sich später (dies das zweite Kapitel bei Decker u.a.) zur Kreation eigener 'Finanzprodukte', nämlich werthaltiger Papiere, fortentwickelt. Diese vollführen dann ihre eigene, nämlich eine „fiktive Akkumulation“ (die „Akkumulation des Geldkapitals“, vgl. MEW 25, 502). Die sicherzustellen ist das Geschäft der Finanzakteure, wobei sie es, was hier schon im ersten Kapitel angesprochen wird, mit der anspruchsvollen Aufgabe zu tun haben, die Gleichung von Schulden = Kapital wahrzumachen. Wie dieses etwas andere Wachstum sich vollzieht und wie es seine eigenen Krisenursachen produziert, ist dann ebenfalls Thema im zweiten Kapitel.
Die Gegenstandpunkt-Veröffentlichung entwickelt aber den Begriff des Finanzkapitals – anders als Zeise – nicht als Nachvollzug des jüngsten Krisengeschehens. Dass das Finanzkapital periodisch in die Krise gerät, ist ein Zusatz zur Ableitung der einzelnen Bestimmungen. Sein Funktionieren interessiert bei der Erklärung, das Nicht-Mehr-Funktionieren wird erst auf dieser Grundlage zum Thema. Bei Zeise ist der größte Teil seines Buchs der wirtschaftspolitischen Chronik seit Ausbruch der Finanzkrise (samt Rückblicken auf frühere Krisenfälle) gewidmet; von IKB, HRE und Lehman Brothers geht es über die ersten deutscheuropäischen Distanzierungen vom US-amerikanischen Problemfall zum allgemeinen Anerkenntnis der Krisenlage, über die folgende Wirtschaftskrise und die unterschiedlichen nationalen Bewältigungsstrategien bis hin zur Staatsschulden- und Eurokrise, vom Streit in der EU (Griechenland, Zypern…) bis zu den jüngsten Plänen in Sachen Bankenunion oder Fiskalpakt. Immer ist der Blick auf Fehlsteuerung und Fehlentwicklungen gerichtet, kommen Politikversagen oder Widersprüchlichkeiten des politischen Kurses zur Sprache. Bei Decker und Co. schließt dagegen an die beiden grundlegenden Bestimmungen finanzkapitalistischer Geschäftstätigkeit ein drittes Kapitel „Finanzsektor und öffentliche Gewalt“ an, das die hier vorliegende „konfliktreiche Symbiose“ behandelt. Das vierte und letzte Kapitel thematisiert dann „das internationale Finanzgeschäft und die Konkurrenz der Nationen“.
Im Verlauf dieser Ableitung ergeben sich zahlreiche Differenzen zu den Darlegungen von Zeise. Der entscheidende Punkt dürfte darin bestehen, dass Zeise die fiktive Akkumulation, also die Anhäufung und Reinvestition von Erträgen in der Finanzsphäre, obwohl er sie an das allgemeine Prinzip kapitalistischer Geldvermehrung zurückbindet, zugleich für eine Abweichung von der kapitalistischen Normalität hält. Das kommt schlagend da zum Ausdruck, wo die hohen Gewinne des Finanzgewerbes (im 8. Kapitel) zum Thema werden. Zeise betrachtet sie als etwas Irreguläres, sie sind ihm Ausdruck einer „Geldschwemme“ oder komplementär eines „Anlagenotstands“, allgemeiner gesagt ein „Entwicklungsprodukt des Neoliberalismus“ (Zeise 2013, 164). Wegen der ungleicher werdenden Einkommensverteilung und der damit gegebenen mangelnden Massenkaufkraft häuften sich Ersparnisse an, die keinen Weg in produktive Anlagen fänden. Diese Schwemme suche sich dann andere Kanäle, so dass sie „im Vorhof der Mehrwertproduktion, im Finanzsektor als fiktives Kapital steckenbleibt“ (ebd.). Die in seiner marxistischen Grundlegung vorgenommene Gleichsetzung – „Kredit oder fiktives Kapital oder Anspruch auf den Profit (was alles dasselbe ist) hat sich zum allgemeinen Äquivalent entwickelt“ (ebd., 61) – ist für Zeise also gar nicht so selbstverständlich, und am Schluss soll ja, wie dargelegt, eine regelrechte Abtrennung des spekulativen Betriebs der Finanzsphäre von ihren nützliche Diensten, die sie der Realwirtschaft erweisen kann, erfolgen, wenn sich denn ein politischer Wille dazu finden ließe. Die „Geldschwemme“, die es zur Zeit ja gibt und die von den Experten vielfach problematisiert wird, könnte dagegen zu anderen Aufschlüssen führen. Beim Münchener Jour fixe des Gegenstandpunkts ist im April 2016 eine Debatte über das Finanzkapital-Buch gestartet (nachzulesen unter: gegenstandpunkt.de/jourfixe/prt/jfix.html), die mit dem genannten Punkt beginnt, also mit der Ausnahmesituation, die derzeit die Aktivitäten der Europäischen Zentralbank (EZB) kennzeichnet. Die EZB als kollektive Notenbank der Euro-Länder „flutet“, wie es in der metaphernreichen, aber gedankenarmen Sprache der Fachleute heißt, die Bankenwelt im Euro-Raum mit einer, bislang jedenfalls, unvorstellbar großen Geldmenge („Quantitative Easing“, Anleihekäufe der EZB im Wert von insgesamt über eine Billion €, die Emissionen werden ab April 2016 von 60 auf 80 Milliarden Euro mtl. bis 2017 erhöht, der Leitzins auf 0,0 gesenkt). Die Zwecksetzung dieser EZB-Politik wird auch verkündet: Die 'Sonderkredite' sollen die Banken mit Geld ausstatten, um ihnen erstens bei der Refinanzierung ihrer Schulden zu helfen und sie zweitens dazu anzuhalten, ihrerseits mit Krediten die Konjunktur im Euro-Raum anzuschieben.
Aus dieser Sondersituation kann man Schlüsse auf den Normalfall ziehen, der mit den Maßnahmen ja wieder herbeigeführt werden soll. Wie in der Jour-fixe-Debatte am aktuellen Fall näher ausgeführt, lebt nämlich alles Geldverdienen von einer hinreichenden Kreditvergabe. Das ganze Geschäftsleben einer kapitalistischen Nation fängt mit Kredit an und hört logischerweise, weil Kredit nur verliehenes Geld ist und sich für die Bank rentieren muss, mit der Bedienung des Kredits nicht auf – denn das Aufhören bedeutet immer nur den Startpunkt für das nächste Ausleihen. Der Kredit ist keine einmalige Verlegenheitslösung, die mit einem erfolgreichen Geschäft beendet wäre. Der Kredit ist Ausgangspunkt und Kreditbedienung die Einlösung dieses Vorschusses durch ein gelungenes Geschäft, damit es immer so weitergeht. Die aktuelle Lage ist demnach keine „Finanzialisierung“ als neuestes Stadium oder neoliberale Fehlentwicklung des Kapitalismus, sondern verweist auf die Normalsituation: Die kapitalistische Geschäftswelt lebt – in allen ihren Abteilungen – von vornherein über ihre Verhältnisse. Hier solide Mehrwertproduktion und spekulativ-übertriebene Gewinnerwartung zu trennen, ist ein Unding. Den Zusammenhang der Finanzsphäre mit dem 'realwirtschaftlichen' Betrieb, aber auch ihre Sonderstellung macht die Publikation von Decker und Co. ausführlich und systematisch zu ihrem Gegenstand.
Literatur
- Elmar Altvater, Der große Krach oder die Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur. Münster 2010.
- Joachim Bischoff, Finanzgetriebener Kapitalismus. Entstehung – Krise – Entwicklungstendenzen. Hamburg 2014.
- Colin Crouch, Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus – Postdemokratie II. Berlin 2011.
- Peter Decker/Konrad Hecker/Joseph Patrick, Das Finanzkapital. München 2016.
- Brett Easton Ellis, American Psycho. 15. Aufl., Köln 1999 (US-Originalausgabe 1991).
- Heiner Flassbeck, Zehn Mythen der Krise. Berlin 2012.
- David Graeber, Schulden – Die ersten 5000 Jahre. Stuttgart 2012.
- Claudia Honegger/Sighard Neckel/Chantal Magnin (Hrsg.), Strukturierte Verantwortungslosigkeit – Berichte aus der Bankenwelt. Unter Mitarbeit von Elfriede Jelinek. Frankfurt/M. 2010.
- Jörg Huffschmid, Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Hamburg 1999 (aktualisierte und erweiterte Neuausgabe 2002).
- Nick Leeson, Das Milliardenspiel – Wie ich die Barings-Bank ruinierte. Unter Mitarbeit von Edward Whitley. München 1997 (Englische Erstausgabe 1996).
- Ernst Lohoff/Norbert Trenkle, Die große Entwertung – Warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Münster 2012.
- Hermann Lueer, Der Grund der Finanzkrise – Von wegen unverantwortliche Spekulanten und habgierige Bankmanager. Münster 2009.
- MEW 23 - Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx-Engels-Werke, Band 23, Berlin 1977.
- MEW 25 - Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. In: Marx-Engels-Werke, Band 25, Berlin 1983.
- Guenther Sandleben, Nationalökonomie & Staat – Zur Kritik der Theorie des Finanzkapitals. Hamburg 2003.
- Joseph Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung. Berlin 2002.
- Anne T., Die Gier war grenzenlos – Eine deutsche Börsenhändlerin packt aus. Berlin 2009.
- Margaret Wirth/Wolfgang Möhl, „Beschäftigung“ – „Globalisierung“ – „Standort“. Anmerkungen zum kapitalistischen Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum. München 2014.
- Lucas Zeise, Geld – der vertrackte Kern des Kapitalismus. Versuch über die Politische Ökonomie des Finanzsektors. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Köln 2013 (Erstausgabe 2008).
Dominus vobiscum: Katholische Kapitalismuskritik
Papst Franziskus gilt heutzutage als der Gewährsmann einer radikalen Kapitalismuskritik, was bereits im IVA-Blogeintrag „Oh Gott, katholische Kapitalismuskritik!“ vom Februar 2016 Thema war. Dazu ein Nachtrag von Johannes Schillo.
Mitte April 2016 war der Bergoglio-Papst, der sich Franziskus nennt, drei Jahre im Amt. Das gab natürlich den üblichen Anlass für öffentliche Würdigungen, auch im Blick auf das Apostolische Schreiben „Amoris Laetitia“, das zeitgleich erschien und das die mit großem Medienecho begonnenen „synodalen“ Beratungen über Ehe und Familie zum Abschluss brachte. Die unter Beteiligung des römisch-katholischen Spitzenklerus durchgeführte Beratschlagung, in deren Verlauf auch Befragungen der Kirchenbasis stattfanden, endete enttäuschend – wie die Öffentlichkeit weit gehend einmütig feststellte: Bei der kirchlichen Sexual- und Ehemoral bleibt alles beim Alten! Als einzige Neuerung wurde vom Papst ein neuer Stil der „Barmherzigkeit“ angekündigt oder, man weiß es nicht genau, in der vatikanischen Botschaft bereits realisiert. Der Stilisierung des argentinischen Papstes zum großen Hoffnungsträger einer kirchlichen Reform an Haupt und Gliedern bereitete das gewisse Schwierigkeiten. Einige Kommentatoren wollten die neue Schrift wiederum als Hoffnungsschimmer interpretieren, andere waren indes der Meinung, mittlerweile werde man von Franziskus mit Floskeln abgespeist und könne ihm die Rolle des Erneuerers nicht mehr abnehmen.
Die FAZ – bis zum deutschen Ratzinger-Papst hundert Prozent papsttreu – zeigte sich gleich mehrfach irritiert. Für den Katholizismus-Experten Daniel Deckers war es einerseits „ein gewaltiger Fortschritt, dass Papst Franziskus schon bald nach seiner Wahl das Thema Ehe und Familie in das Zentrum eines in der Geschichte der Kirche einmaligen Reflexionsprozesses stellte… Die Enttabuisierung vieler Themen, die mit diesem zwei Jahre währenden Prozess einherging, ist ebenso beispiellos wie die unorthodoxe, von Franziskus selbst kultivierte Haltung des 'Wer bin ich, dass ich jemanden verurteilen sollte'“. (FAZ, 9.4.2016) Andererseits vermisste der Kommentator klare Führung, weil der Papst mit seinen Hinweisen darauf, dass es auf die Gewissensentscheidung des Einzelnen ankomme, das Risiko eingehe, „nach der Autorität auch noch die Kompetenz des Lehramts“ zu verwirken. FAZ-Redakteur Christian Geyer machte in derselben Ausgabe auf den Unfug aufmerksam, mit großem Pomp eine Morallehre zu verkünden und sich gleichzeitig gegen eine „kalte Schreibtischmoral“ (Franziskus) zu wenden; sein Fazit lautete, dass „das Dokument einen Reformgeist vorspiegelt, den es nicht einlöst“. Das ist schon kurz davor, die Heuchelei dieses Sittenrichters anzugreifen, der angeblich von sich nicht weiß, wer er ist. Natürlich ist er der Heilige Vater, wie es auch auf seinem neuesten Schreiben steht, und er vertritt mit absoluter Sicherheit (wenn er sich dazu bekennt: auch mit Unfehlbarkeit) neben der Glaubens- die Sittenlehre dieser kirchlichen Organistaion – eine Lehre, die im Sündenregister des römischen Katechismus minutiös alles auflistet, was zu verurteilen und folglich einem Kirchenmitglied verboten ist. Von dieser Lehre hat der Papst im neuesten Text kein Jota zurückgenommen.
Auch in der Linken gab es Probleme mit der Würdigung dieses 266. Pontifikats. Sie bezogen sich vor allem auf die Hoffnung, von Rom gehe eine „franziskanische“ Revolution aus, die sich dem „imperialen kapitalistischen System“ entgegenstelle (vgl. Arntz 2016, Duchrow 2016). Der neue Papst war ja mit seinen Statements und lehramtlichen Schreiben – besonders mit dem Spruch „Diese Wirtschaft tötet“ – als der Gewährsmann einer heute angesagten Kapitalismuskritik eingestuft worden (vgl. den IVA-Blogeintrag „Oh Gott, katholische Kapitalismuskritik!“). Aus der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in Deutschland wurde z.B. festgestellt: „Im Kern seiner Überlegungen zu den Widersprüchen der modernen Gesellschaft und der Globalisierung steht eine pointierte Kapitalismuskritik, die in dieser Schärfe auch in der Tradition der Katholischen Soziallehre neu ist. Seine Kritik gipfelt in dem oft zitierten Satz: 'Diese Wirtschaft tötet'.“ (Füssel u.a. 2016, 15) Zu den neuesten Entwicklungen im Folgenden ein Kommentar.
Eine Revolution von unten, von oben und von ganz oben
Der Papst, so ein breiter linker Konsens, „greift in seinen Schriften und Ansprachen immer wieder das Wirtschaftssystem an, indem er die Vergötzung des Geldes und des Konsums entlarvt.“ (Kern 2016, 23) Und nicht nur das. Er soll mit seiner „Revolution von oben“ gleichzeitig „die sozialen Bewegungen als Subjekt gesellschaftlicher Veränderungen“ ins Auge gefasst haben (ebd.). „Dabei kommt es dem Papst eben nicht auf die EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft an, sondern auf die Veränderung von unten“ (ebd.). Beleg dafür soll sein, dass sich der Papst „erstmals in der Kirchengeschichte“ (ebd.) 2014 und 2015 mit Vertretern sozialer Bewegungen getroffen habe. Der Papst trifft sich in der Tat mit allen möglichen Personen aus Politik und Gesellschaft; er empfängt Leonardo di Caprio im Vatikan oder besucht die Vollversammlung der Vereinten Nationen – und lässt sich natürlich, dabei durchaus unkonventionell in seiner Besucherliste, mit allen wichtigen Politikern aufs Gespräch ein. Dem Weltwirtschaftsforum in Davos, einem der elitären Beratungsgremien des Weltkapitalismus, übermittelte er z.B. am 30. Dezember 2015 folgende Botschaft: „Ich habe oft gesagt und wiederhole es jetzt gerne, dass die Unternehmertätigkeit 'eine edle Berufung darstellt und darauf ausgerichtet ist, Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle zu verbessern', besonders 'wenn sie versteht, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen ein unausweichlicher Teil ihres Dienstes am Gemeinwohl ist' (Laudato si’, 129). So trägt sie eine Verantwortung, die verwickelte Krise der Gesellschaft und der Umwelt überwinden zu helfen und die Armut zu bekämpfen… Auf diese Weise kann das World Economic Forum durch die bevorzugten Mittel des Dialogs eine Plattform werden für den Schutz und die Bewahrung der Schöpfung sowie für die Erzielung eines 'Fortschritts…, der gesünder, menschlicher, sozialer und ganzheitlicher ist' (Laudato si’, 112)“ (Radio Vatikan 2016).
Eine großartige Bevorzugung der Basis, einer Veränderung „von unten“, kann man dem nicht entnehmen. Bergoglio hatte ja auch schon in seinem Schreiben „Evangelii gaudium“ klargestellt, dass man der verbreiteten Politik(er)verdrossenheit entschieden entgegentreten müsse: „Die in Misskredit gebrachte Politik ist eine sehr hohe Berufung, ist eine der wertvollsten Formen der Nächstenliebe, weil sie das Gemeinwohl anstrebt.“ (EG 205) Dasselbe hatte er für die Unternehmer festgehalten: „Die Tätigkeit eines Unternehmers ist eine edle Arbeit, vorausgesetzt, dass er sich von einer umfassenderen Bedeutung des Lebens hinterfragen lässt; das ermöglicht ihm, mit seinem Bemühen, die Güter dieser Welt zu mehren und für alle zugänglicher zu machen, wirklich dem Gemeinwohl zu dienen.“ (EG 203) Und bei den notwendigen Veränderungen war für den Papst klar, dass die politische Klasse das Heft in der Hand behalten muss: „Es ist Sache der Politik und der verschiedenen Vereinigungen, sich um eine Sensibilisierung der Bevölkerung zu bemühen.“ (LS 214) Mit den „verschiedenen Vereinigungen“ konnten sich natürlich auch alle möglichen sozialen Bewegungen angesprochen fühlen. Im Vordergrund stand aber, dass Franziskus gerade die politisch-ökonomisch bestimmenden Akteure in Schutz nahm, wenn und insofern sie sich, wie alle anderen Menschen auch, um die wahre christliche Gesinnung bemühten.
Es stimmt natürlich, wenn der Papst sich z.B. wie in Santa Cruz (Bolivien) im Juli 2015 an die „Volksbewegungen“ wendet, schlägt er radikalere Töne an, dann wird auch schon einmal „das Kapital“ erwähnt (Radio Vatikan 2015): „Hinter so viel Schmerz, so viel Tod und Zerstörung“, die in der globalen Marktwirtschaft anzutreffen seien, „riecht man den Gestank dessen, was Basilius von Cäsarea den 'Mist des Teufels' nannte. Das hemmungslose Streben nach Geld, das regiert. Der Dienst am Gemeinwohl wird außer Acht gelassen. Wenn das Kapital sich in einen Götzen verwandelt und die Optionen der Menschen bestimmt, wenn die Geldgier das ganze sozioökonomische System bevormundet, zerrüttet es die Gesellschaft, verwirft es den Menschen, macht ihn zum Sklaven, zerstört die Brüderlichkeit unter den Menschen, bringt Völker gegeneinander auf und gefährdet – wie wir sehen – dieses unser gemeinsames Haus.“ Mit einer Analyse dieser Verhältnisse sollte man sich aber, so der Papst, nicht lange aufhalten: „Es reicht … nicht, die strukturellen Ursachen des augenblicklichen sozialen und ökologischen Dramas aufzuzeigen. Wir leiden unter einem gewissen Übermaß an Diagnose…“ Man sollte statt dessen den Leidenden ins Gesicht sehen. „Das ist etwas ganz anderes als das abstrakte Theoretisieren oder die vornehme Entrüstung.“ Doch auch hier hält er fest: „Wir wollen eine Veränderung, die durch die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, den Volksbewegungen und anderen sozialen Kräften bereichert wird… Die Regierungen, die sich die Aufgabe zu Eigen machen, die Wirtschaft in den Dienst des Volkes zu stellen, müssen die Stärkung, die Verbesserung, die Koordinierung und die Ausbreitung dieser Formen von volksnaher Wirtschaft und Gemeinschaftsproduktion fördern… Man muss erkennen, dass keines der schweren Probleme der Menschheit gelöst werden kann ohne Interaktion zwischen den Staaten und Völkern auf internationaler Ebene.“ Ein Aufruf zu einer Revolution von unten ist das nicht gerade!
Es ist eine große, dicke, laute Anklage der Verhältnisse, wie sie in der globalisierten Marktwirtschaft herrschen. Das kann man dem Papst zugute halten – wie es Freerk Huisken in seiner Gegenrede „Der Papst als Kapitalismuskritiker: Unfehlbar?“ getan hat (Huisken 2014). In der Tat, der Papst kann klagen, aber das können Bill Gates, George Soros oder George Clooney auch, um nur einige prominente Philantropen zu nennen. Franziskus ist kein Schönfärber, der wie sein Vorgänger Ratzinger eine richtig gehende Verhimmelung des Marktes liefert oder den Schatten- die bekannten Lichtseiten der Globalisierung gegenüberstellt, um so die moralische Aufregung gleich wieder zu beschwichtigen. Er besteht auf der Notwendigkeit des moralischen Einspruchs gegen die gültige Weltwirtschaftsordnung. Wenn er allerdings den Einspruch ernst meinte, müsste er sich die Frage vorlegen, was das eigentlich für Verhältnisse sind, die eine beständige Zurechtweisung erforderlich machen. Ihm geht es aber nicht um den Inhalt des Einspruchs, sondern um die moralische Wucht, die sich an diesem Punkt entfalten lässt (vgl. Decker 2013, 2014).
Gerhard Feldbauer hat in der Jungen Welt zum Amtsjubiläum des Papstes eine Würdigung veröffentlicht, die sich an der Zwiespältigkeit dieses Revolutionärs von oben abarbeitet: „Der Versöhnler – Seit drei Jahren ist Papst Franziskus im Amt. Als Reformer gefeiert, will er sich mit seinen reaktionären Erzfeinden verständigen“ (Feldbauer 2016). Feldbauer, der Italien- und Vatikan-Korrespondent der JW, ist in seiner Beurteilung etwas nüchterner als die sonstige Linke. Er referiert mit einer gewissen Skepsis, dass viele Franziskus als „Reformer, gar als sozialen Revolutionär“ sehen, dessen Anliegen die Rückkehr zu der tiefgehenden Wende sei, die von Papst Johannes XXIII. mit dem II. Vatikanischen Konzil (1962/63) eingeleitet, aber von den Nachfolgern, dem Polen Wojtyla und dem Deutschen Ratzinger, wieder rückgängig gemacht worden sei. Zumindest so viel wird an dieser ersten Einschätzung deutlich: Der großartige Aufbruch des neuen Papstes ist im Grunde ein Weg zurück – zurück zur Normalität eines Katholizismus, der sich im Kalten Krieg auf der Seite des Westens, inklusive aller zuvor abgelehnten demokratischen Errungenschaften wie Religions- und Meinungsfreiheit, positionierte, sich aber im Wettstreit der Systeme immer auf höhere Werte berief und nicht umstandslos alle Machenschaften der Westmächte absegnete.
Feldbauers Fazit ist ebenfalls ernüchternd: „Franziskus übt scharfe Kritik am Kapitalismus, konkreter ausgedrückt: an dessen sozialen und umweltschädigenden Auswüchsen. Das System selbst hat er nie verurteilt, und er hat bisher auch keine Position zur Arbeiterbewegung bezogen.“ (Ebd.) Trotzdem kann Feldbauer es nicht bei dieser Feststellung belassen. Der Hauptteil des Textes bemüht die Vorstellung eines Akteurs, der eigentlich etwas anderes will als das, was er tut. Er kooperiert mit den faschistoiden Fraktionen des Katholizismus (Opus Dei, Piusbruderschaft), er betreibt die Heiligsprechung seiner „offen reaktionären Vorgänger“ (ebd.), der Päpste Pius XII. und Johannes Paul II., er räumt nicht wirklich in Vatikanstaat und Vatikanbank auf, wo die Verhältnisse zum Himmel stinken. Dabei soll es stets Umstände geben, die sein eigentlich progressiv gemeintes Wirken verhindern. Dazu werden dann auch die Ereignisse der 1960er und 1970er Jahre, als „der Vatikan zum Dorado größter Kapitalverbrecher wurde“ (ebd.), wieder aufgewärmt: Die Putschloge P2, die Kontakte zu Gladio, CIA und Mafia, zu den Skandal-Bankiers Roberto Calvi oder Michele Sindona etc. – all das muss als Beleg dafür herhalten, wie sehr der kirchliche Führungsapparat in dunkle Machenschaften verwickelt war bzw. ist. Die Konsequenz heißt: Dieser Apparat macht es allen Reformern schwer! So wird denn auch die Legende vom 33-Tage-Papst Johannes Paul I. wieder aufgefrischt, der angeblich „diesen Sumpf austrocknen wollte“ und der „bei bester Gesundheit angeblich an einem Herzinfarkt“ starb; „bis heute sind die Gerüchte nicht verstummt, dass er umgebracht wurde“ (ebd.). Ebenso sind die Gerüchte nicht verstummt, er sei ein regelrechter Reformator gewesen, der den Dunkelmännern den Kampf angesagt hätte.
Sex sells: Amoris Laetitia
Das neue päpstliche Schreiben über Ehe und Familie „Amoris Laetitia“ („Freude der Liebe“) vom April 2016 kommt am Rande auch auf wirtschaftliche Probleme zu sprechen – wie gehabt als ungünstige Bedingung dafür, ein gottgefälliges Leben, hier im Kreise der Liebsten, zu führen. Das geschieht wieder in der ganz unbestimmten Redeweise von einer Wirtschaft, mit der es die Menschen heutzutage zu tun haben und von der man nichts Genaues erfährt, jedenfalls nicht, welchen Maßgaben sie folgt, wie sie geordnet ist oder wer in ihr was zu sagen hat. Einmal wird aus einem Text der Synodenberatungen zitiert und beiläufig von „wirtschaftlichen Konditionierungen“ wie der „Logik des Marktes“ gesprochen, die „ein authentisches Familienleben verhindern“ (AL 201). Das ist die einzige Stelle (neben einem Hinweis darauf, dass sich Menschen pornographisch vermarkten), die ahnen lässt, das von einer Marktwirtschaft die Rede ist.
Klar ist dem Papst, dass die schönen Worte übers Familienleben jemanden – bei ihm natürlich zunächst den Vater – voraussetzen, der sich um den Unterhalt, also um die Beteiligung am System der gesellschaftlichen Arbeit kümmert. „Die Arbeit ermöglicht zugleich die Entwicklung der Gesellschaft und den Unterhalt der Familie wie auch ihre Beständigkeit und ihre Fruchtbarkeit… Im Buch der Sprichwörter wird auch die Aufgabe der Familienmutter dargestellt, deren Arbeit in all ihren tagtäglichen Einzelheiten beschrieben wird, mit denen sie das Lob ihres Ehemannes und der Kinder auf sich zieht.“ (AL 24) Dass dieser Unterhalt ein hartes Brot, „ein Brot der Mühsal“ (Psalm 127, 2), ist, verschweigt der Papst nicht. Doch versieht er das mit dem Lob, „dass die Arbeit ein grundlegender Teil der Würde des menschlichen Lebens ist“ (AL 23). Sie ist für ihn nicht einfach eine Notwendigkeit, um den Lebensunterhalt sicherzustellen. Sie wird nicht unter dem Blickwinkel betrachtet, wie man ihre Mühsal reduzieren und den Ertrag erhöhen könnte. Ihre Beschränkung oder Minimierung würde ja letztlich die Würde des Menschen relativieren. Franziskus scheut auch nicht davor zurück, in diesem Zusammenhang den brutalen Spruch des Apostels Paulus zu zitieren: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“ (AL 24).
Eine rationale Haltung, die Arbeit als Aufwand betrachtet, den man möglichst verringert oder den man unterlässt, wenn man sich zufriedengestellt fühlt, ist damit ausgeschlossen. Der Wille zur Arbeit muss schon, wie der Apostel lehrt, als menschliche Grundhaltung vorhanden sein. Dabei zielt, sachlich betrachtet, der Wille aufs Resultat der Arbeit, nicht auf den Prozess der Anstrengung. Vernünftiger Weise geht der Mensch so vor, wie Marx es im 5. Kapitel des „Kapital“, Band 1 (MEW 23, 192ff), erläutert: Er macht einen Plan, in dem er sich das Ergebnis seines Arbeitsprozesses als Ziel setzt und nicht einfach tagaus, tagein vor sich hin werkelt. Dies unterscheidet den Menschen vom Tier, das ja erstaunliche arbeitsähnliche Leistungen zustande bringt, etwa mit seinen Bauwerken – siehe die Biene mit ihren Wachszellen oder die Spinne im Netz – menschliche Baumeister in den Schatten stellt. Die Spinne spinnt eben, egal, wo sie sich befindet und ob dem Vorhaben Erfolg beschieden ist. Der Mensch geht vom Zweck der Tätigkeit aus, sie soll ihm für seinen Bedarf ein brauchbares Produkt liefern, darauf richtet sich sein Wille. Die Arbeit, die dafür geleistet werden muss, ist für ihn Mittel, bleibende Notwendigkeit und „ewige Naturbedingung“, wie Marx sagt (MEW 23, 198). Mit der fortschreitenden Produktivkraftentwicklung werden ihre Mühe und ihr Aufwand reduziert. Was dann an Anstrengung nötig bleibt, erbringt der Mensch im Blick auf sein System der Bedürfnisse.
Das gilt natürlich nur als abstrakte Aussage, also nicht für die Lohnarbeiter im Kapitalismus, wo das System der Kapitalverwertung ganz andere Notwendigkeiten kennt. Hier wird ein Zustand, bei dem „die Arbeit nicht das Leben auffrisst, sondern eine Zeit der Muße für alle ermöglicht“ (Huisken 2016) zur Utopie. Für den modernen Arbeitnehmerhaushalt, der ein Familie gründet – und das soll er ja nach dem Willen des Papstes –, ist Muße ein Fremdwort. Beide Eltern sind berufstätig und müssen ihre Work-Life-Balance durch eine minutiöse Planung von Haushalt, Kita, Schule, Job etc. aufrecht erhalten, durchorganisiert bis zur letzten Minute, um die Reproduktion der eigenen Arbeitskraft und des Nachwuchses zu gewährleisten. Und für Alleinerziehende bewegt sich das Ganze am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das System der Lohnarbeit kennt aber auch die Karikatur der Muße: die Arbeitslosigkeit. Sie „ist gerade nicht die Befreiung von der Mühsal der Arbeit für mehr Muße, sondern steht gerade umgekehrt für die weitere lebenslange Kettung an Lohnarbeit und ihre kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Der Mensch, der vom Unternehmer seine Papiere erhält, bedankt sich nicht, springt nicht jauchzend mit dem Ruf aus der Fabrik: 'Endlich frei, endlich kann ich tun und lassen was ich will!' Diese Sorte Befreiung von Arbeit ist nämlich gerade nicht Befreiung für selbstbestimmtes 'Tun und Lassen', für freigesetzten Materialismus.“ (Ebd.)
Ein zweckrationales Vorgehen, das sich die Befreiung von der Mühsal der Arbeit zum Ziel setzt, schließt der Papst bewusst aus. Das „Brot der Mühsal“ ist die Bestimmung des Menschen – und darf nicht angetastet werden. Deshalb ist auch Arbeitslosigkeit ein Frevel, sie verstößt gegen die Menschenwürde, sie „schädigt auf verschiedene Weise die Ausgeglichenheit der Familien“ (AL 25). Wie in seinen vorherigen Schreiben („Evangelii gaudium“ und „Laudato Si“) wird also bekräftigt, dass die materialistische Haltung des Menschen gegenüber der Natur – lange bevor eine spezielle Wirtschaftsweise den Naturverschleiß auf Touren bringt und damit ihr Geschäft betreibt – das Problem ist. Die Tatsache, dass der Mensch die Natur für seine Zwecke ausnutzen und herrichten will, gerät ins Visier. Wir dürfen, schreibt Franziskus, nicht „den Verfall vergessen, den die Sünde in die Gesellschaft einbringt, wenn der Mensch sich gegenüber der Natur wie ein Tyrann verhält, indem er sie verwüstet und sie in egoistischer und sogar brutaler Weise gebraucht.“ (AL 26). Ein Tyrann, der dasjenige, von dem er lebt, verwüstet, somit zerstört, ist natürlich eine saublöde Figur. Ob es solche Herrscher wirklich gibt, ist schwer die Frage, jedenfalls ist die kapitalistische Naturvernutzung, auf die offenkundig angespielt wird, nicht durch ein solches Verhalten gekennzeichnet. Diese will ja nicht die Natur „tyrannisch“ beherrschen, um sich zum Herrn über sie aufzuschwingen und sie zu degradieren. Sie folgt vielmehr einem Profitzweck, der den Naturstoff als seine Bedingung nutzt und sich dafür übrigens streng an dessen eigene Gesetze hält. Dieser Verwendungszweck geht gegenüber der Natur folgsam vor; die moderne Naturwissenschaft, die mit dem Kapitalismus entstand, tritt nicht mit tyrannischer Willkür auf, sondern lauscht ihrem Gegenstand seine Gesetzmäßigkeiten ab; erst dann kann sie ihn benutzen.
Worauf der Papst also wieder abzielt, ist das zweckrationale Verhalten des Menschen gegenüber der Natur schlechthin. Dass er von seinem Interesse ausgeht, es der Natur aufzwingt, soll der Skandal sein. Dass er sie in „egoistischer und sogar brutaler Weise gebraucht“, ist der Kern des Vorwurfs. Dabei ist Brutalität nicht verwerflich, sondern gegenüber der Natur genau das angemessene Verhalten. Gegenüber den Naturgewalten muss der Mensch als der Bezwinger auftreten, der erst einmal sein Überleben sichert. Alle Schnuckeligkeiten gegenüber Tier, Pflanze und Stein können erst danach stattfinden, wenn die Menschen es geschafft haben, sich in der und gegen die Natur zu behaupten. Man muss Tiere töten, Bäume abhacken, Felsen sprengen. Das geht nur brutal, gutes Zureden hilft hier nicht. Dem dummen Vieh und den rohen Naturgewalten muss man so begegnen, dass man ihnen Widerstand leistet. Die ganze Wucht der päpstlichen Anklage hängt also letztlich wieder am Attribut „egoistisch“: Wenn der Mensch an sich denkt – statt an Gott –, dann ist der Wurm drin. Der Materialismus der Naturbeherrschung ist dem Papst ein Gräuel, nicht deren Einsatz für einen bestimmten Zweck, der aus der Beherrschung einen destruktiven Vorgang machen würde oder in einer sonstigen Weise kritikabel wäre.
Diese Pseudo-Kritik des Kapitalismus, die den zu Grunde liegenden Egoismus „des“ Menschen angreift, ist heutzutage populär (siehe Schirrmacher 2013). Folglich wird die moralische Umdeutung der politökonomischen Verhältnisse dem Papst kaum angekreidet. Bedenken richten sich vielmehr darauf, ob der Kirchenmann nicht im Blick auf Produktivität und Effizienz der Marktwirtschaft zu schwarz malt. Eine Ausnahme stellt dagegen Christoph Fleischmann dar, der – in moderater Weise – das Menschenbild von Franziskus kritisiert und dafür anthropologische Debatten seit dem Beginn der Neuzeit resümiert. Erst von daher könne man die aktuelle Frontstellung verstehen, die die Enzyklika „Laudato si“ aufmacht und die als Kapitalismuskritik bewertet, d.h. wegen ihrer Radikalität begrüßt oder abgelehnt wird. Fleischmann betont, dass der Papst sich auf einer anderen Ebene als einer sachlichen Beurteilung der Ökonomie bewegt; er habe sich zur Begründung seiner religiösen Anthropologie als Antipoden ein Menschenbild zurechtgelegt, das letztlich nur durch den Mangel an Christlichkeit und Gottesbezug gekennzeichnet sei: „Franziskus beschreibt weder das 'techno-ökonomische Paradigma' mit präzisen Begriffen, noch den dahinter vermuteten 'Anthropozentrimus'. Letztlich laufen seine Klagen über 'anthropozentrische Maßlosigkeit' oder eine 'Kultur des Relativismus' (Papst Benedikt grüßt aus dem Hinterhaus) auf den alten christlichen Vorwurf hinaus, wonach die Wurzel aller Übel darin liege, dass der Mensch nicht Gott anerkenne, sondern sich selber zum autonomen Gesetzgeber mache.“ (Fleischmann 2016, 110)
Fleischmann hat Recht damit, hier auf die inhaltliche Verbindung zum reaktionären Vorgänger-Papst Ratzinger aufmerksam zu machen. Für die Beurteilung der gegenwärtigen katholischen Sozialkritik ist es nämlich nur eine Randfrage, ob Papst Franziskus sich jetzt mit der alten Garde im Vatikan umgibt oder die Spitzenkräfte des Lehramtes einem Revirement unterzieht. Viel wichtiger sind die sachlichen Übereinstimmungen mit der katholischen Lehrtradition. Und hier macht Franziskus ein ums andere Mal klar, dass er keinen Bruch, sondern explizit eine Anknüpfung an seine „offen reaktionären“ Vorgänger will, wie er sich ja überhaupt in die kirchliche Tradition stellt. Die will er nicht aufgeben, sondern eigentlich nur den Führungsstil, das kirchliche Management und Marketing, mit seiner bekannt lockeren, „franziskanischen“ Art ändern. Dazu passt, dass er zu seinem Vorgänger ein gutes persönliches Verhältnis pflegt.
Sozialer Katholizismus
Der deutsche Ratzinger-Papst hatte 2009 mit einiger Verspätung – woran möglicher Weise der Ausbruch der Finanzkrise Mitschuld trug – die Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ vorgelegt. Sie war eine unverhohlene Apologie des Marktes und in dieser Form ein gewisses Novum im Korpus der autoritativen kirchlichen Texte. „Es muss die Sichtweise jener als unrichtig verworfen werden, nach denen die Marktwirtschaft strukturell auf eine Quote von Armut und Unterentwicklung angewiesen sei, um bestmöglich funktionieren zu können“, hieß es dort (CV 35). Benedikt fuhr fort: „Der Markt ist an sich nicht ein Ort der Unterdrückung des Armen durch den Reichen und darf daher auch nicht dazu werden. Die Gesellschaft muss sich nicht vor dem Markt schützen, als ob seine Entwicklung ipso facto zur Zerstörung wahrhaft menschlicher Beziehungen führen würde.“ (Nr. 36) Nun ist z.B. der Arbeitsmarkt, auf dem Menschen, die nichts als ihre Arbeitskraft besitzen, auf Kapitaleigner und deren Interesse an der Anwendung fremder Arbeit stoßen, die unmittelbare Widerlegung der positiven Wertung. In diesem Markt trifft eine existenzielle Notlage auf eine geschäftliche Kalkulation, die den Einsatz von Arbeit am Kriterium der Rentabilität misst und entsprechend den Lohn als eine zu begrenzende Größe behandelt, eventuell auf den Ankauf von Arbeitskraft verzichtet oder angewandte „freisetzt“ und so ihre Erpressungsmacht ausspielt.
Und die katholische Soziallehre hat diese Konstellation von Anfang an – seit der ersten modernen Sozialenzyklika „Rerum novarum“ (1891), die dieses Jahr ihr 125. Jubiläum feiert – als ein soziales Zentralproblem betrachtet und sowohl auf dem Recht der gewerkschaftlichen Gegenwehr wie der Notwendigkeit staatlicher Eingriffe bestanden, was ihr ebenfalls von Anfang an den Verdacht sozialistischer Tendenzen eingebracht hat. Damit hat sie bestätigt, dass der Markt, zumindest an dieser Stelle, „ipso facto“ für die Lebensinteressen der arbeitenden Menschheit zerstörerisch und nur für das Gewinninteresse der Arbeitgeber förderlich wirkt, dass also erst durch eine Zusatzveranstaltung der Markt dazu gezwungen wird, „menschliche Beziehungen“ zuzulassen. Ein Zwang übrigens, der durchaus im Interesse der Marktwirtschaft liegt, wie die Arbeiterbewegung ihren Kontrahenten in langen Kämpfen klar gemacht hat und wie es die Enzyklika von Leo XIII. auch offen aussprach.
In „Rerum novarum“ hieß es im Blick auf die Arbeiterbewegung, die im 19. Jahrhundert entstanden war: „Nicht selten greifen die Arbeiter zu gemeinsamer Arbeitseinstellung, wenn ihnen die Anforderungen zu schwer, die Arbeitsdauer zu lang, der Lohnsatz zu gering erscheint. Dieses Vorgehen, das in der Gegenwart immer häufiger wird und immer weiteren Umfang annimmt, fordert die öffentliche Gewalt auf, dagegen Abhilfe zu schaffen; denn die Ausstände gereichen nicht bloß den Arbeitgebern mitsamt den Arbeitern zum Schaden, sie benachteiligen auch empfindlich Handel und Industrie, überhaupt den ganzen öffentlichen Wohlstand. Außerdem geben sie erfahrungsmäßig häufig Anlaß zu Gewalttätigkeiten und Unruhen und stören so den Frieden im Staate. Demgegenüber ist diejenige Art der Abwehr am wirksamsten und heilsamsten, welche durch entsprechende Anordnungen und Gesetze dem Übel zuvorzukommen trachtet und sein Entstehen hindert durch Beseitigung jener Ursachen, die den Konflikt zwischen den Anforderungen der Arbeitsherren und der Arbeiter herbeizuführen pflegen.“ (Zit. nach KAB 1975, 53f) Der Staat soll also, angestoßen durch gewerkschaftliche Gegenmacht, als „ideeller Gesamtkapitalist“ (Friedrich Engels) in Erscheinung treten und den Störungen im Betriebsablauf, ja der drohenden kapitalistischen Selbstzerstörung Einhalt gebieten, denn erst das gewährleistet den Systemerhalt.
Feldbauer (2016) ist zuzustimmen, dass sich mit dieser ersten Sozialenzyklika „die katholische Kirche ohne Wenn und Aber hinter das kapitalistische Ausbeutersystem stellte und forderte, 'der Staat muss sich zum unerbittlichen Hüter des Privateigentums machen' und ihm durch die öffentlichen Gesetze 'Schirm und Schutz bieten'“. In „Rerum novarum“ wurde die offizielle kirchliche Position formuliert, nach der das Privateigentum sakrosankt ist, woraus dann die konservative Variante dessen Unverletzlichkeit und Heiligkeit ableitete, währende progressive Interpreten mehr die Gemeinwohlorientierung herausstellten: „Bei allen Versuchen, den niederen Klassen aufzuhelfen, ist also durchaus als Grundsatz festzuhalten, daß das Privateigentum unangetastet zu lassen sei“ (zit. nach KAB 1975, 39). Dass die Rundschreiben zu sozialen Fragen in den folgenden Jahrzehnten diese Parteinahme für das Ausbeutersystem aufgaben – wie von wohlwollenden linken Kommentatoren immer wieder behauptet –, ist eine Täuschung. Es stimmt natürlich, mit der vom Jesuiten Oswald von Nell-Breuning verfassten Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ (1931), die Pius XI. nach der Weltwirtschaftskrise veröffentlichte, wurden neue Töne angeschlagen. In „Populorum progressio“ von Paul VI. (1967) hieß es rückblickend auf die Fortschritte der kapitalistischen Industriegesellschaften: „Im Gefolge dieses Wandels der Daseinsbedingungen haben sich unversehens Vorstellungen in die menschliche Gesellschaft eingeschlichen, wonach der Profit der eigentliche Motor des wirtschaftlichen Fortschritts, der Wettbewerb das oberste Gesetz der Wirtschaft, das Eigentum an den Produktionsmitteln ein absolutes Recht, ohne Schranken, ohne entsprechende Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber darstellt. Dieser ungehemmte Liberalismus führte zu jener Diktatur, die Pius XI. mit Recht als die Ursache des finanzkapitalistischen Internationalismus oder des Imperialismus des internationalen Finanzkapitals brandmarkte.“ (Zit. nach KAB 1975, 445)
In seiner Studie zum Ratzinger-Papst hat Feldbauer rückblickend festgestellt, dass Paul VI. seinerzeit „mit seiner Sozialenzyklika kritische Akzente zur sozialen Verfasstheit des kapitalistischen Eigentums setzte“ (Feldbauer 2010, 193). In der Tat, im Verlauf der jetzt 125-jährigen autoritativen katholischen Sozialverkündigung ging es um Änderungen in den Akzentsetzungen – um mehr wohl nicht. Bei der Abwehr einer radikalen Kapitalismuskritik, wie sie mit der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert entstanden war, wurde jeweils zeitbedingt nachjustiert. Ausgangspunkt und Existenzgrund des sozialen Katholizismus war diese Frontstellung gegen den Sozialismus. Doch ließen es die Krisen und Kollisionen des Kapitalismus dem katholischen Lehramt immer wieder geboten erscheinen, auf Fehlentwicklungen in der geschätzten Marktwirtschaft hinzuweisen. Die Kirchenfunktionäre Ratzinger und Wojtyla machten sich dann in der Schlussphase des Ost-West-Gegensatzes darum verdient, die Angriffe auf das östliche „Reich des Bösen“ (Reagan) zu fokussieren und alle Bedenklichkeiten gegenüber dem „ungehemmten“ Liberalismus und Konsumismus der Marktwirtschaft politisch zu entschärfen. Seitdem erfährt man immer wieder, jetzt auch durch Wikileaks- oder andere Enthüllungen (vgl. Hermsdorf 2016), wie eng die Kooperation mit US-Geheimdiensten war, wie der Aufstieg Wojtylas ins Amt des kirchlichen Oberhaupts mit der US-Politik abgestimmt war etc. Solcher Insider-Informationen bedarf es aber nicht. Man muss sich nur den Inhalt der sozialen Mahnungen ansehen, dann zeigt sich, dass sie nicht mit Kapitalismuskritik zu verwechseln sind. Auch nicht beim gegenwärtigen Papst, der in der Tat die Akzente wieder neu gesetzt hat – und vielleicht noch weiter setzt.
Auch seine Botschaft an die Mühseligen und Beladenen auf dem Globus heißt letztlich: Dominus vobiscum – der Herr sei mit euch! Und auch ihm, dem Papst „vom anderen Ende der Welt“ – wie er sich bei seiner Amtseinführung selbst bezeichnete –, sind „die bekannten mächtigen Demokratien des Abendlandes und der Neuen Welt das vorbildliche Nonplusultra weltlicher Macht, so dass einer zum Widerstand allzeit bereiten christlichen Kirche nur zwei Dinge zu tun bleiben, die sie auch brav erledigt: Sie geißelt die menschlichen Verirrungen und kapitalistischen Auswüchse, die sie im System der menschlichen Freiheit antrifft, auf dass die Glaubenswahrheiten zu ihrem Recht kommen. Und sie bringt sich als Agentur der Menschlichkeit ins Spiel bzw. in die Weltgeschichte ein, indem sie alle finsteren Herrschergestalten, die ihren Schutzmächten in die Quere kommen, im Namen Christi den umfassenden Import der Freiheit abverlangt, zu deren wesentlichen Bestandteilen das organisierte Wirken von Christen seit jeher zählt…“ (Held 2005, 122)
Literatur
- AL – Amoris Laetitia. Nachsynodales Apostolisches Schreiben des Heiligen Vaters Papst Franziskus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 204, Bonn 2016 (zit. als AL nach den Nummern der Abschnitte).
- Norbert Arntz, Eine „franziskanische“ Revolution in Rom? Von der imperialen Kirche zur befreienden Jesus-Bewegung. In: Sozial Extra, Nr. 2, 2016, S. 27-30.
- CV – Caritas in veritate. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 186, Bonn 2009 (zit. als CV nach den Nummern der Abschnitte).
- EG – Evangelii gaudium, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013 (zit. als EG nach den Nummern der Abschnitte).
- Gerhard Feldbauer, Der Heilige Vater Benedikt XVI. – Ein Papst und seine Tradition. Köln 2010.
- Gerhard Feldbauer, Der Versöhnler – Seit drei Jahren ist Papst Franziskus im Amt. Als Reformer gefeiert, will er sich mit seinen reaktionären Erzfeinden verständigen. In: Junge Welt, 13.4.2016.
- Kuno Füssel/Günter Salz/Helmut Gelhardt, Das Ganze verändern – Beiträge zur Überwindung des Kapitalismus. Hrsg. von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in der Diözese Trier. Norderstedt 2016.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Papst prangert die Indolenz der Welt gegenüber dem Flüchtlingselend an: Klarstellungen der Öffentlichkeit zum Verhältnis von Politik und Moral. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2013, S. 17-18.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Viel Kopfschütteln unter den journalistischen Spin-Doctors unseres Wirtschaftssystems: Papst verdammt Kapitalismus! In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2014, S. 15-23.
- Ulrich Duchrow, „Diese Wirtschaft tötet“ – Kirchen gemeinsam gegen das imperiale kapitalistische System. In: Sozial Extra, Nr. 2, 2016, S. 32-34.
- Christoph Fleischmann, Der grüne Papst und der Irrweg des käuflichen Glücks. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 1, 2016, S. 104-111.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Die Sache mit der Religion. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2005, S. 109-136. Online: http://www.gegenstandpunkt.com/gs/2005/2/gs20052109.html.
- Volker Hermsdorf, Gesegneter Putsch – Veröffentlichte Dokumente zeigen Unterstützung des Vatikans für Militär beim US-gelenkten Staatsstreich in Chile 1973. In: Junge Welt, 14.4.2016.
- Freerk Huisken, Der Papst als Kapitalismuskritiker: Unfehlbar? In: www.magazin-auswege.de, 24.1.2014.
- Freerk Huisken, Muße, oder: Über die Unterordnung des erlaubten Materialismus unter kapitalistische Notwendigkeiten. In: Die Freilerner, Nr. 69, 2016. Online: http://www.fhuisken.de/loseTexte.html.
- KAB – Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands (Hrsg.), Texte zur katholischen Soziallehre – Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln 1975.
- Benedikt Kern, Geht die Kirche mit Papst Franziskus an die Ränder? Die Auswirkungen einer „Revolution von oben“ an der kirchlichen Basis. In: Sozial Extra, Nr. 2, 2016, S. 23-26.
- LS – Laudato si. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 202, Bonn 2015 (zit. als LS nach den Nummern der Abschnitte).
- Radio Vatikan, Wir sagen nein zu allen Formen der Kolonialisierung. 10.7.2015. Online: http://de.radiovaticana.va/news/2015/07/10/volltext_wir_sagen_nein_zu_allen_formen_der_kolonialisierun/1157230.
- Radio Vatikan, Papstbotschaft an Weltwirtschaftsforum in Davos. 20.1.2016. Online: http://de.radiovaticana.va/news/2016/01/20/papstbotschaft_an_weltwirtschaftsforum_in_davos/1202312.
- Frank Schirrmacher, Ego – Das Spiel des Lebens. München 2013.
März 2016
Betrifft: Flüchtlingspolitik
Die Flüchtlingspolitik mit ihren nationalen wie europäischen Konsequenzen beherrscht seit Ende 2015 die Medien. Inzwischen gibt es aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften eine Reihe von Stellungnahmen, und aktuell ist die Flugschrift „Abgehauen“ von Freerk Huisken erschienen. Dazu Hinweise der IVA-Redaktion.
„Die Verantwortung für die 'Große Flucht' wird ebenso verdrängt wie deren Ursachen“, schreibt Conrad Schuhler als Ankündigung zu seinem Buch „Die große Flucht“ (Schuhler 2016), das unbequeme Fragen nach Grund und Folgen der aktuellen Flüchtlingskrise stellen will. In ähnlicher Weise versuchen andere Diskussionsbeiträge gegen das offizielle Selbstlob des 'hellen Deutschland' Stellung zu beziehen – ohne natürlich der rechten Aufwallung im Land recht zu geben, die ihre eigene Agenda abarbeitet. Im Folgenden soll es um Veröffentlichungen gehen, die vorwiegend der linken, alternativen, ausländerfreundlichen, antirassistischen etc. Szene zuzuordnen sind; abschließend wird die Flugschrift „Abgehauen“, die Freerk Huisken zum März vorgelegt hat (Huisken 2016), ausführlicher vorgestellt.
Die bloße Reproduktion des amtlichen deutschen Standpunkts – bis März 2016 Merkels „Wir schaffen das“ –, die man auch in Politikberatung oder Sozialwissenschaften antrifft, ist dabei nicht Gegenstand (vgl. dazu Luft 2016). Es sei nur angemerkt, dass dort Verantwortungsübernahme und Ursachenforschung nicht verdrängt, sondern auf eigene Weise Berücksichtigung finden. So schreibt der stellvertretende Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung in einem aktuellen Sammelband zur Flüchtlingspolitik: „Diese Krise ist auch eine Chance. Die Flüchtlingskrise zeigt uns Deutschen und auch der Welt, dass unser Land bereit ist, europäisch und international Verantwortung zu übernehmen, indem Zuflucht suchenden Menschen geholfen und unsere Wertvorstellungen von Freiheit, Pluralismus, Demokratie und Menschenwürde verstärkt ins Blickfeld gerückt und zu Bedingungen einer erfolgreichen Integration gemacht werden.“ (KAS 2016, 5)
Die Autoren aus der CDU-nahen Stiftung machen sich ferner – wie Bildzeitung, Kardinal Woelki oder Til Schweiger – den Kampf gegen Stammtischparolen oder den Slogan „Refugees Welcome“ zu eigen, wobei höchstens auffällt, dass den Ausführungen der christdemokratischen Experten für Entwicklungszusammenarbeit, Sicherheitspolitik, politische Bildung etc. das Thema Rechtsradikalismus & Ausländerfeindlichkeit nur eine Randnotiz wert ist. „Für Populisten und Extremisten würden große Einfallstore geöffnet“, wenn sich die politischen „Verantwortungsträger zur Verkündung von rein nationalen Scheinlösungen verleiten“ ließen (ebd., 82), heißt es einmal beiläufig zur innenpolitischen Situation. Ansonsten richten sich die Aufklärungsbemühungen der Adenauer-Stiftung vor allem auf die Propagierung der Willkommenskultur und eines neuen nationalen Selbstverständnisses, das der Globalisierungsära angemessen sein soll. Doch haben sich die Christdemokraten – siehe die Vorgänge in Sachsen – mittlerweile eindeutig gegen AfD und Co. in Stellung gebracht (vgl. Das Parlament, Nr. 9, 2016), verständlicherweise, denn die Populisten und Extremisten bedrohen die Wahlchancen der etablierten Parteien, wie die Landtagswahlen vom März 2016 noch einmal nachdrücklich klar gemacht haben.
Verdrängt wird im politischen Diskurs auch nicht die Frage nach den Fluchtursachen. Bei der Adenauer-Stiftung heißt es z.B.: „Fluchtursachenbekämpfung ist … nicht nur unsere humanitäre und christliche Pflicht, sondern liegt auch in unserem eigenen Interesse an einer funktionierenden staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung in Deutschland. Dabei sind Flucht und Migration langfristige Themen, die uns ungeachtet der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in Europas Nachbarschaft auch in Zukunft beschäftigen werden, und zwar in allen Ländern Europas. Deshalb ist die Strategie der Bundeskanzlerin, notleidenden und vor Krieg und Verfolgung fliehenden Menschen Zuflucht zu gewähren und gleichzeitig in das europäische Management der Flüchtlingsströme, die Bewältigung der Integrationsherausforderungen in Deutschland sowie in die Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort zu investieren, nur konsequent.“ (Ebd., 5)
Dass die Investition in eine neue weltpolitische Rolle Deutschlands bei der Wende der Flüchtlingspolitik vom Herbst 2015 eine entscheidende Rolle gespielt hat – und nicht die pure Barmherzigkeit, die eine Regierungschefin aus evangelischem Elternhaus befallen haben soll –, klingt in den kritischen Analysen und Statements zwar hier und da an, aber letztlich bleibt bei vielen Einwänden ein explizites oder implizites Einverständnis mit der Politik der deutschen Bundeskanzlerin – einer Politik, die zumindest als erster Schritt in die richtige Richtung gewürdigt wird.
Angekommen
„Auch wenn keiner der Geflüchteten es sich wirklich ausgesucht hat und wohl eher der Wunsch auf ein besseres Leben sie antrieb als der Wunsch, politische Botschaften zu übersenden, so tragen sie doch eine Botschaft nach Europa. Diese lautet: So wie wir wirtschaften und handeln, wie wir arbeiten, konsumieren und Politik machen – so kann es nicht weitergehen.“ (Kipping 2016b, 8) Mit dieser Feststellung greift Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, in ihrem zum Februar 2016 erschienenen Buch die Flüchtlingsfrage auf. Sie nimmt also die Realität der Massenflucht, die Ankunft von rund einer Million Menschen, gleich so auf, dass ihr Botschaften zu entnehmen seien, die zwar nicht wirklich überbracht werden, die sich aber einer deutschen Parteipolitikerin aufdrängen. Wie sie in der Einleitung ihres Buchs ausführt, handelt es sich im Grunde um zwei Botschaften: Erstens stellten sich jetzt „die grundlegenden Gerechtigkeitsfragen mit besonderer Dringlichkeit, und ihr globaler Charakter wird in aller Deutlichkeit klar“ (ebd., 8f). Es zeige sich ferner, dass „Einwanderung weniger als Problem, sondern vielmehr als Bereicherung erlebt werden sollte. Und darin liegt die zweite zentrale These, die mich zum Schreiben motiviert hat: Die jetzige Situation muss nicht zwangsläufig auf eine Apokalypse zulaufen. Sie kann vielmehr auch den Wendepunkt zum Positiven, zu einer wirklichen Demokratie in der Einwanderungsgesellschaft, zu einem Land für alle darstellen.“ (Ebd., 9)
Die Autorin fasst das auch so zusammen: „Im Kern verweisen die Migrationsbewegungen nach Europa auf ein grundlegenderes Problem (= als bloß aufs deutsch-europäische Politikversagen, IVA): auf die Ungerechtigkeit unserer Weltwirtschaftsordnung“ (Kipping 2016a, 78). Für die Misere seien ein „Wirtschaftsimperialismus“ (ebd., 79) und eine „imperiale Außenpolitik“ (ebd., 80) verantwortlich. Es gebe in Wirklichkeit keine „wertegeleitete Außenpolitik“ Deutschlands, entsprechende Ansagen seien „nur die schöne Verpackung einer imperialen Strategie… Die deutsche Politik selbst produziert Fluchtursachen in vielen Teilen der Welt und am laufenden Band“ (ebd.), und die „aktuellen Bedingungen des kapitalistischen Weltmarkts“ ließen den Staaten im globalen Süden „kaum eine realistische Chance“ (ebd., 84). Dies wird – gerade mit Blick auf die Krisenregionen Afrika, Naher Osten, Balkan – ausführlich belegt, wobei sich aber gleich Fragen auftun. Zum Beispiel: Was ist damit gemeint, dass sich hier „im Kern“ ein Problemfall der Gerechtigkeit zeigt? Liegt der Grund der Übel darin, dass die maßgeblichen Politiker diesen Höchstwert aus den Augen verloren haben? Die Welt, so viel ist klar, soll gerecht geordnet bzw. von ihrem in dieser Hinsicht bestehenden Defizit geheilt werden – doch hilft es weiter, dieses allseits geteilte Ideal zu beschwören? Und wer soll auf dem Globus jedem das Seine zuteilen? An welche Instanz ist gedacht, die die Interessen austariert und den Ansprüchen der verschiedenen Herr- bzw. Völkerschaften gerecht wird?
Für eine Politikerin der Linken ist natürlich klar, dass das die Bundesrepublik ist – nicht die real existierende, sondern eine veränderte, die einen „Politikwechsel“ (ebd., 86) hingekriegt hat und sich solidarisch verhält. Und der Politikwechsel ist aus dieser Perspektive schon auf den Weg gebracht, denn in die „heile Welt des Merkelschen Biedermeiers“ (ebd., 87) seien massiv die Herausforderungen des Globalisierungszeitalters eingedrungen: „Faktisch platzt mit den Flüchtlingsbewegungen die Systemfrage in unsere Gesellschaft.“ (Ebd., 75) Dass die deutsche Politik dieses Eindringen zugelassen hat, ist gewissermaßen der Beginn eines Weges, der nur konsequent weiter beschritten werden muss. Die deutsche Bundeskanzlerin scheint schon einiges begriffen zu haben, bedarf aber noch der Nachhilfe, damit endlich „Einwanderung als Bereicherung erlebt werden“ kann. Der deutschen Regierung werden auch konkrete Vorschläge gemacht, wie man vorgehen müsse – von, erstens, dem Verbot des Land Grabbings bis „neuntens: … muss die deutsche Handelspolitik völlig neu justiert werden“ (ebd., 86).
Hier erscheint also die politische Linie, wie sie von der deutschen Bundeskanzlerin (zumindest bis Ende Februar 2016) hartnäckig verfolgt wird, als Aufbruch zu neuen Ufern. Natürlich hat Kipping – wie die Linkspartei überhaupt – an der Aufführung der Großen Koalition einiges auszusetzen und sie schlägt auch radikale Töne an: Es müsse jetzt „ans Eingemachte, das heißt an die herrschende Wirtschaftsordnung selbst“ (ebd., 86), gehen. Aber die Chefin der Linken versichert, dass das keineswegs revolutionär oder extremistisch gemeint sei, bemüht vielmehr als welthistorischen Vergleich das Beispiel des „New Deal“ von US-Präsident Roosevelt. Das weit ausholende Investitions- und Aufbauprogramm aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg habe damals der undemokratischen Welt gezeigt, „dass die US-amerikanische Demokratie … überlegen ist“ (ebd., 88). Diese praktisch beglaubigte Überlegenheitsdemonstration der amerikanischen Führungsmacht hat es in der Tat gegeben. Es verwundert nur, dass sich eine linke Politikerin eine Phase der US-Politik zum Vorbild nimmt, die nach den düsteren Krisenjahren die neue Ära des kämpferischen US-Weltherrschaftsanspruchs einleiten sollte.
Aber will und kann Deutschland diesen Weg gehen? Hier melden dann neuere Studien, so der Wissenschaftler Hans Kundnani in seinem Buch übers „Paradox der deutschen Stärke“ (2016a), Zweifel an. Die Bewältigung der Eurokrise habe bereits Deutschlands zögerliche oder widersprüchliche Initiative, die mangelnde Führungsstärke oder die endemische „german angst“ dokumentiert. „Die Ereignisse der letzten fünf Jahre – und insbesondere die Flüchtlingskrise – lassen also vermuten, dass Deutschland nicht nur nicht willens, sondern auch nicht in der Lage ist, ein europäischer Hegemon zu sein“ (Kundnani 2016b, 74). Das deutsch dominierte Europa – bis zum Sommer 2015 noch ein machtvolles, beeindruckendes, wenn auch nicht unbedingt anheimelndes Projekt – wird als Abbruchunternehmen gehandelt. „Das Projekt 'Demokratie'. Und das Projekt 'Europa'. Beides steht, wie man so sagt, derzeit auf der Kippe. Allerdings werden die Demokratie und Europa nicht etwa von den Flüchtlingen bedroht, ganz im Gegenteil: Sie sind es ja gerade, die auf ein demokratisches, humanes Europa hoffen, bevor sie zum 'Problem' erklärt werden und ihnen Hass entgegenschlägt.“ (Metz/Seeßlen 2016, 8)
Die Schwierigkeiten der deutschen Politik, die Flüchtlingskrise zu lösen, werden von vielen linken Kritikern mitfühlend problematisiert – sei es im Blick auf die europapolitischen Zerwürfnisse, sei es angesichts von Verunsicherung und Angst, die sich im Innern Deutschlands, speziell nach den Kölner Silvesterereignissen, dank kräftiger Nachhilfe der öffentlichen Meinung und einschlägiger politischer Expertisen ausbreiten. „Umso notwendiger ist es, diese Angst an ihrer Wurzel zu packen“, schreibt Albrecht von Lucke zur neuesten deutschen Stimmungslage 'nach Köln' und fährt fort: „Nur wenn die deutsche Politik klar macht, dass der Rechtsstaat weiter funktioniert und die immensen Herausforderungen bewältigen kann, wird dieses Beispiel positiv ausstrahlen, wird ein offenes, solidarisches Europa doch noch eine Chance haben.“ (Lucke 2016, 8; zur Situation 'nach Köln' siehe jetzt zudem Decker 2016.)
Doch auch die Linke beherrscht die christdemokratische Dialektik von der Krise als Chance. „Paradoxerweise birgt gerade die Krise Europas die Chance zu einem Kompromiss in der Flüchtlingsfrage“ (Menzel 2016, 44), schreibt der Sozialwissenschaftler Ulrich Menzel und sieht die langfristige Lösung in einem neuen europäischen Selbstverständnis als „Einwanderungskontinent“ (ebd., 45), während sich die kurzfristigen Optionen – neben der unproduktiven Renationalisierung Europas – in zwei Möglichkeiten, nämlich eine „benevolente“ und eine „malevolente“ Rolle Deutschlands als „Eurohegemon“ (ebd., 44), auseinander dividieren würden. Auch aus osteuropäischer Perspektive, so beim Sozialwissenschaftler Helmut Fehr von der Universität Budapest, erhält die deutsche Willkommenskultur Unterstützung. „Die Krise der ostmitteleuropäischen Demokratie kommt nicht nur im Versagen der politischen Führungsgruppen in der Flüchtlingskrise zum Ausdruck“, so Fehr (2016, 83), sondern auch im politischen Autoritarismus, der sich von der Zivilgesellschaft abkopple. In letzterer lebe der Gedanke eines offenen, solidarischen Europas, also einer Gemeinschaft im Sinne Merkels, fort. „Während die Visegrád-Regierungen sich über das 'Diktat' Brüssels und den 'moralischen Imperialismus' (Orbán) empören, engagieren sich zahlreiche NGOs für Flüchtlinge“ (ebd.). Osteuropa ist also noch nicht ganz verloren…
Ob Merkel weiter durchhält, wird dann zur Frage. „Sofern es den reaktionärsten Kräften im Kabinett nicht gelingt, Merkel zu stürzen, wird erst im Herbst 2017 gewählt“, schreibt Stefan Ripplinger (2016, 13), aber „bis dahin kann viel geschehen“. Der Autor hat wohl kaum Sympathie für die Kanzlerin, Humanismus sieht er bei ihr nicht am Werk. „Solidarität gehörte nicht zu ihren Motiven, denn Solidarität war kurz zuvor griechischen Rentnern und portugiesischen Jugendlichen verweigert worden… Vielmehr stand sie im Einklang mit den Interessen des Kapitals, das vom Aufbau einer industriellen Reservearmee träumt. Und dennoch ließ diese Politik hoffen…“ (Ebd.) Trotz alledem bleibt am Ende irgendwie die Hoffnung, dass man es hier mit dem kleineren Übel zu tun hat, zumindest im Vergleich zum 'dunklen Deutschland'. Mit den Interessen des Kapitals ist dann eine andere Ebene angesprochen, auf der sich die linke Kritik der deutschen Flüchtlingspolitik ausgiebig zu Wort meldet. Das beginnt mit der Feststellung, „dass die neuen Wanderungsbewegungen erhebliche Auswirkungen auf das Verhältnis von Reichtum und Armut im Lande haben werden“ (Butterwegge 2016a, 13), dass sie nämlich eine Zufuhr und Zunahme von Armut bedeuten, den deutschen Niedriglohnsektor verstärken etc.
Der Armutsforscher Christoph Butterwegge bringt diesen Aspekt in die schönfärberische Debatte über Integration ein. Und soweit ist es korrekt: Die Flüchtlinge kommen zwar in einer deutschen Willkommenskultur an, diese gibt ihnen aber kein Zuhause. Das müssen sie sich dadurch verschaffen, d.h. unter härtesten Bedingungen erkämpfen, dass sie sich in die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft einreihen. Dabei werden sie, wie Butterwegge bilanziert, bestehendes Elend vermehren und verschärfen. Merkwürdig ist hier jedoch die Annahme, mit der weiteren Verelendung würde man Argumente in die Hand bekommen, konsequenter gegen die hiesige soziale Ungerechtigkeit vorzugehen: „Ein triftigeres Argument für die Notwendigkeit der Verwirklichung größerer Steuergerechtigkeit als den Hinweis, dass Gering- und Normalverdiener/innen keinesfalls für hilfsbedürftige Flüchtlinge zahlen dürfen, Wohlhabende und Reiche aber viel stärker in die Pflicht genommen werden müssen, gibt es schließlich nicht.“ (Butterwegge 2016b, 84) Mit solchen Sorgen ums nationale Gerechtigkeitsempfinden finden linke Kritiker auch leicht Anschluss an die offizielle Lagebeurteilung. „Die Abwertung der Armen untergräbt den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, schreiben zwei arbeiterfreundliche Autoren zu dem sozial- und arbeitsmarktpolitischen Druck, der auf die zugewanderten Armen ausgeübt wird (Dörfler/Fritzsche 2016, 79). Den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat die offizielle Politik freilich längst zum Sorgeobjekt gemacht und achtet – nach ihren Maßstäben – darauf, dass hier nichts aus dem Ruder läuft.
Wenn man die harte Realität der Eingliederung in die Konkurrenz um Bildungs- und Berufschancen nicht in den Blick nimmt, wird die Integrationsaufgabe idealistisch überhöht, so als ginge es hierzulande bloß noch um den Ausbau „eines inklusiven Bildungssystems, in dem ethnonatiokulturelle Diversität nicht als Risiko und Problem, sondern als Chance und Bereicherung betrachtet wird“ (Frieters-Reermann 2015, 9; kritisch zur deutschen Leitkultur: Heinelt 2016). Das Bildungssystem erscheint dann als eine einzige Hilfestellung dafür, dass alle mitgenommen werden und keiner zurückbleibt. Dass der Arbeitsmarkt mit seinem Bedarf über die Verwendung qualifizierter Kräfte entscheidet, wird vornehm ausgeblendet. Oder dessen Härten werden zur Kenntnis genommen, aber mit einem Appell an die Arbeitsministerin versehen, solche Belastungen für Flüchtlinge abzumildern (Schwarzer 2016). Bei der sozioökonomischen Argumentation, die den Realismus der Marktwirtschaft gegen den Idealismus der Willkommenskultur ins Spiel bringt, fallen mehrere Punkte auf.
Einmal wird, so von Elmar Altvater, eine Krise des Weltkapitalismus diagnostiziert, um vor allem die gesamteuropäischen Abschottungstendenzen – und nicht die deutsche Öffnung – hervorzuheben: „Die Freiheit gilt für das Kapital, nicht aber für die Menschen als Träger der Ware Arbeitskraft.“ (Altvater 2016a, 93) Verantwortlich dafür soll ein neoliberales Konzept sein – die „negative Integration entbetteter Märkte“ (Altvater 2016b, 23) –, das allein dem Kapital die Schranken aus dem Weg räumt. Die menschlichen Kosten der Krisenbewältigung fänden folglich keine Berücksichtigung: „Der Umgang mit der Flüchtlingswelle seit 2015 in der Europäischen Union zeigt die Fratze von Hartherzigkeit, Borniertheit und antidemokratischer Repression.“ (Ebd.) Bei einer solchen Lagebeurteilung bleibt im Grunde am Schluss stehen, dass sich die neue deutsche Politik der Willkommenskultur auf einer alternativen Schiene bewegt. Das wird zwar nicht direkt als Zustimmung zur Merkel-Linie ausgesprochen, aber „vielleicht bietet die Alternative“, wie es am Schluss von Altvaters Aufsatz heißt (2016a, 94), „die einzige Chance zur Überwindung der Krisen unserer Zeit.“
Zum andern werden die Interessen der Wirtschaft an Zuwanderung als treibende Kraft, als Aktivposten oder problematische Größe verbucht. Wie von Kipping angesprochen, soll es wichtig sein, in Migration die Potenziale und die Bereicherung für Deutschland zu sehen. „In Deutschland sprechen mittlerweile … selbst konservative PolitikerInnen von einem 'Einwanderungsland' und neoliberalen Diskursen entsprechend wird Migration zudem vermehrt als 'Potenzial' für die Wirtschaft betrachtet.“ (Ratfisch/Schwiertz 2016, 2) Die deutsche Willkommenskultur erscheint dann eher als ein Projekt der Zivilgesellschaft, entstanden aus spontaner Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, dem sich die Politik angeschlossen habe oder das jetzt von der Wirtschaft ausgenutzt werde. Die zitierten Autoren aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung wehren sich dagegen, dass die Politik diese Hilfsbereitschaft für ihre Selbstdarstellung in Anspruch nimmt. „Zu Recht wurde in linken Analysen kritisiert, dies werde dazu genutzt, das Image der deutschen Nation aufzupolieren, das durch die rassistischen Proteste international stark beschädigt worden war.“ (Ebd., 24) Auch die wirtschaftlichen Interessen müssten in ihre Grenzen verwiesen werden. Integration soll als ein „gegenhegemoniales“ Projekt der Zivilgesellschaft betrieben werden, wobei darauf zu achten sei, „dass Unternehmen und Arbeitgeberverbände, die immer wieder ihr Interesse an migrantischen Arbeitskräften äußern, davon abgehalten werden, das gegenhegemoniale Projekt zu vereinnahmen“ (ebd., 31).
Drittens und als entscheidender Punkt ist hier festzuhalten: Mit der ökonomischen Argumentation, mit den Interessen des Kapitals an Zufuhr weiterer Arbeitskräfte, wie von Ripplinger behauptet, lässt sich die aktuelle Politik Deutschlands nicht erklären. Merkels Kurswechsel vom Herbst 2015 ist nicht aus einer Bestandsaufnahme am Arbeitsmarkt oder aus dem Druck wirtschaftlicher Pressure Groups hervorgegangen. Die Zeitschrift Z hat dies in einem Beitrag einerseits zur Kenntnis genommen, wenn sie davon spricht, dass es Deutschland mit seiner Wende in der Flüchtlingspolitik um „Führungsverantwortung“ gehe (Z-Redaktion 2016, 8). Andererseits wird dies aber wieder dadurch zurückgenommen, dass etwas anderes zu vermuten sei, das „hinter der Haltung Merkels in der Flüchtlingsfrage steckt: Deutschland ist das einzige große Land in Europa, das Interesse an Einwanderung in größerem Umfang hat. Die deutschen Unternehmerverbände lassen derzeit keinen Zweifel daran, dass sie Zuwanderung von Arbeitskräften (nicht nur von hochqualifizierten) wünschen.“ (Ebd., 10f) Dass es darüber Streit in der EU gibt, soll dann wieder an den unterschiedlichen Bedarfslagen der „Kapitalfraktionen“ in den europäischen Ländern liegen.
Dagegen muss man dann doch an die eingangs erwähnten Bemerkungen Kippings über die „imperiale Außenpolitik“ Deutschlands erinnern. Oder wie es andere Beobachter voller Enttäuschung über die europäische Wertegemeinschaft ausdrücken: „Die europäischen Nationalstaaten machen nicht nur Politik für oder, vor allem, gegen die Flüchtlinge, sondern sie machen sogar Politik mit den Flüchtlingen. Macht- und Wirtschaftspolitik mit hilfsbedürftigen, rechte- und machtlosen Menschen zu treiben ist das Ende jeder humanistischen und demokratischen Gesellschaft.“ (Metz/Seeßlen 2016, 12) In der Tat, es wird in Deutschland Politik mit Flüchtlingen gemacht. „Die deutsche Weltflüchtlingsmacht entwickelt Ordnungsbedarf“, wie die Autoren der Zeitschrift Gegenstandpunkt schreiben (Decker 2015, 16). Dabei ist natürlich „Weltflüchtlingsmacht“ ein eigenartiger Status für einen anspruchsvollen Global Player in der Staatenkonkurrenz. Mit humanitärer Betroffenheit, mit „moralischem Imperialismus“ anzutreten – wie ausgerechnet der auf nationalen Machtzugewinn bedachte ungarische Staatschef der deutschen Regierung vorwarf –, könnte eher als das Abstandnehmen von Machtpolitik erscheinen. Doch nicht zuletzt die europäischen Kontroversen dürften diesen Schein zerstört haben. Deutschland zeigt sich hier ja nicht als weltfremder „Hippie-Staat“, wie ausländische Experten befürchteten; es „präsentiert sich als einer der Hauptbetroffenen von den Lasten, die die Problemlage mit sich bringt, deshalb zuständig für die Anleitung dringend anstehender Regelungen sowie bereit und angesichts seiner Potenzen in der Lage zu substantiellen Beiträgen dazu.“ (Ebd.)
Abgehauen
Huiskens Flugschrift „Abgehauen“ (2016) legt den imperialistischen Charakter des modernen Flüchtlingsproblems systematisch dar. Sie beginnt mit dem Selbstlob Deutschlands als „Flüchtlingsparadies“ – also mit der maßlosen Übertreibung, die seit dem Herbst 2015 unterwegs ist und die von Befürwortern einer Willkommenskultur, aber auch von Kritikern geteilt wird. Huisken stellt zunächst klar, dass die deutsche Politik die Grenzöffnung nicht als Einladung an die Flüchtlingsmassen der Welt verstanden wissen wollte, „sondern allein als deutsche Fähigkeit, jene Flüchtlinge 'menschlich' zu behandeln, die Europas Grenzbefestigungen überwinden und die von Ungarns Orbán … so schändlich behandelt werden“ (Huisken 2016, 7f). Er hält allerdings auch fest, dass hier ein Politikwechsel stattgefunden hat. Dessen Analyse widmet sich die Veröffentlichung, wobei sie schrittweise vorgeht und mit dem im Titel angesprochenen Tatbestand „Abgehauen“ beginnt. Daher widmet sich nach den einleitenden Bemerkungen das zweite Kapitel ausführlich der Frage „Was ist ein Flüchtling?“. Eine Frage, die sonst oft als banaler Ausgangspunkt – es sind eben Zeitgenossen in Not, die nicht viel mehr als einen Appell an unser Mitgefühl darstellen – abgetan wird. Behandelt wird in dem Kapitel die politische Klassifizierung von Menschen in einer nationalstaatlich durchorganisierten 'Völkergemeinschaft', deren UN-Organisationen fest mit dem Tatbestand Flucht rechnen und sich als zuständige Instanzen aufbauen.
Sachlich naheliegend thematisiert das folgende dritte Kapitel die Fluchtursachen, wobei exemplarisch drei Fälle – Syrien, Somalia und das Horn von Afrika sowie der Westbalkan – herausgegriffen werden. Registriert wird hier auch die neue Tonlage in Deutschland, wie sie etwa in der Studie der Adenauer-Stiftung zum Ausdruck kommt: dass 'der Westen' nämlich möglicher Weise 'nicht ganz unschuldig' an der Misere in den Herkunftsländern der Flüchtlingsströme ist. Huisken nimmt dies allerdings nicht als Sinneswandel der Politik, sondern als eine erneuerte Zuständigkeitserklärung, die im Grunde das alte imperiale Regime über die Elendsregionen der Welt fortschreibt. Genau aus diesem Regime lassen sich, wie an den drei Fällen exemplarisch vorgeführt wird, die Elendslagen erklären: „Die ökonomischen und politischen Verhältnisse in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge fliehen, sind immer in irgendeiner Weise das Produkt der Staaten, in die sie fliehen und deren Betreuung sie sich dann auch noch unterstellen.“ (Ebd., 38)
Die Art und Weise, wie Menschen sich im Rahmen von Asylgrundrecht und Schengengrenzregime diesen Staaten unterstellen, ist Gegenstand in den folgenden beiden Kapiteln. Gerade für Ausländerfreunde dürften die Ausführungen zum Asyl einen provokativen Denkanstoß bedeuten. Huisken sieht darin nämlich nicht die gnädige, sogar völkerrechtlich verbürgte Gewährung einer Zufluchtsstätte für Schutzsuchende – die angeblich als Dokument der Selbstlosigkeit und als Erbschaft der Emigration zur Nazi-Zeit über jede Kritik erhaben ist –, sondern ebenfalls eine anspruchsvolle Zuständigkeitserklärung: „Es ist eine Richterrolle über die Innenpolitik eines anderen Staates, die sich der deutsche Staat mit dem Art.16 GG heraus- und ganz selbstverständlich in Anspruch nimmt.“ (Ebd., 42) Die Fortentwicklung des Asylrechts seit dem Kalten Krieg ist dann ausführlich Thema, ferner die Ausgestaltung des europäischen Grenzregimes, das bereits in den letzten Jahren seine Katastrophenfälle (Lampedusa!) kannte.
Das sechste Kapitel geht auf den Paradigmenwechsel ein, der im September 2015 mit Merkels „Wir schaffen das“ in die Welt kam. Dass die deutsche Kanzlerin, die sich zuletzt bei der Regelung der griechischen Krise als unbarmherzige Verfechterin von Sparpolitik und Volksverarmung erwiesen hatte, womöglich Mitleid mit notleidenden Menschen empfunden habe, will Huisken nicht groß bestreiten. Er weist nur auf den politischen Gehalt dieses Kurswechsels hin, der immerhin von allen maßgeblichen Parteigrößen in Deutschland – mit Ausnahme natürlich von AfD & Co. – so weit mitgetragen wird, dass die Regierung im Amt bleibt und alle einschlägigen Gesetzesvorhaben realisieren kann. Fazit: „Der Schlussfolgerung, die Merkels flüchtlingspolitische Offensive bestimmt, liegt das nationale Selbstbewusstsein einer Staatsmacht zugrunde, die mit ihrer weltpolitischen Rolle im zweiten Glied nicht zufrieden ist und aus ihrem Status als Führungsmacht in Europa ableitet, dass ihr mehr an Einfluss in der Konkurrenz ums Weltordnen zusteht. “ (Ebd., 78)
Dieses Fazit wird dann im siebten Kapitel („Deutsche Flüchtlingspolitik als imperialistische Offensive“) und im achten („Integration der 'Neubürger' und neue Nationalerziehung für 'Altbürger'“) expliziert. In dem einen Fall wird noch einmal ausdrücklich aufs Thema Fluchtursachenbekämpfung, wieder an den drei Fällen Westbalkan, Afrika, Syrien festgemacht, eingegangen; im andern Fall stehen die Integration in die „nationale Konkurrenzgesellschaft“ und die notwendige „Umerziehung“ des deutschen Volkes im Mittelpunkt. Das neunte und abschließende Kapitel liefert dann eine „Zwischenbilanz nach Köln“. Es bilanziert die verschärften Anstrengungen in Deutschland seit Anfang 2016, sowohl im Innern als auch nach Außen das charakterisierte Programm eines deutschen Machtzugewinns zu realisieren. Dabei kommt auch die Spaltung, die es im Regierungslager gibt – verkörpert im Querschläger Seehofer – zur Sprache. Mit der CSU, aber auch mit anderen Bedenkenträgern von Seiten der SPD oder der Grünen hat ja die Sorge, dass das Nationalgefühl der deutschen Mehrheit überfordert sei, einen offiziellen Platz in der Politik von Bund und Ländern gefunden.
Hier hat auch der Bundespräsident seinen Beitrag geleistet und im Streit über das Für und Wider von Obergrenzen eine merkwürdige vermittelnde Position („Begrenzung schafft Akzeptanz“) eingenommen. Ihm ging es dabei nicht um eine Unterstützung politischer Strömungen von AfD bis CSU, sondern – ganz staatspolitisch – darum, eine Spaltung des deutschen Volkes entlang der Flüchtlingsfrage zu verhindern. Huisken kommentiert: „Die Einheit der Deutschen in dieser 'Schicksalsfrage der deutschen Nation' geht ihm über alles, auch über den Versuch der Kanzlerin, 'altes Denken' in Sachen nationaler Identität durch ein Nationalbewusstsein zu ersetzen, das für sie zur angestrebten Rolle Deutschlands als Führungsmacht in der 'globalisierten Welt' besser passt.“ (Ebd., 136) Merkel, kann man sagen, ist hier ihrer Zeit voraus. Wie seinerzeit Kanzler Schröder arbeitet sie eine Agenda ab, die ganz den Zukunftserfordernissen des Standorts gewidmet ist und die ihre eigene, zurückgebliebene Parteibasis verunsichert.
„Wie auch immer der Streit um Führungsstärke und nationale Entschlossenheit zwischen den beteiligten Figuren ausgehen wird, an den imperialistischen Gründen für die Massenflucht von Menschen, welche ihr Leben in ihrer Heimat massiv bedroht sehen, am Massensterben in Wüsten und Meeren, an Flüchtlingen, die sich an Grenzzäunen ballen, Einlass in kapitalistische 'Paradiese' fordern, zwecks Durchsortierung monatelang in Erstaufnahmelagern konzentriert werden, dort entweder gleich abgewiesen oder als Ballast bzw. als billige Arbeitskräfte integriert werden, ändert das nichts“ (ebd., 142), heißt es zum Schluss des Buches. Dessen Redaktionsschluss lag Anfang Februar. Die jüngsten Entwicklungen – die Auseinandersetzungen mit Griechenland und der Türkei, das von Merkel angekündigte Ende der „Politik des Durchwinkens“ (FAZ, 1.3.2016) oder die entsprechenden EU-Kontroversen – wurden nicht mehr berücksichtigt.
Aber die grundsätzliche Klärung des deutschen Politikwechsels vom Herbst 2015 ist hier geleistet. Außerdem enthält das Buch einige Zusätze, nämlich zwei Exkurse, die sich mit dem Lob der Flüchtlinge durch deutsche Arbeitgeber und mit den Schwierigkeiten demokratischer Werteerziehung befassen. Zudem gibt es einen kurzen Rekurs auf das „antirassistische Tagebuch“ des Autors aus dem Jahr 1993, das unter anderem die einzelnen Schritte hin zur deutschen Asylrechtsreform von Anfang der 90er Jahre dokumentiert (vgl. Huisken 1993; das Buch ist vergriffen, die 2. Auflage von 2001 „Nichts als Nationalismus 1“ ist jedoch als Download zugänglich: http://www.vsa-verlag.de/uploads/media/Huisken_Deutsche_Lehren_aus_Rostock_und_Moelln.pdf). In Huiskens beiden Bänden „Nichts als Nationalismus“ (2001) findet sich auch eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem rechten Rand, der sich jetzt als Pegida, AfD etc. neu formiert.
Literatur
- Elmar Altvater, Zerstörung und Flucht – Von der Hierarchie der Märkte zur Migrationskrise in Europa. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 1, 2016a, S. 84-94.
- Elmar Altvater, Offene Märkte, geschlossene Grenzen – Ohne Migration endet die europäische Integration als monströser Markt. In: Z – Zeitschrift für marxistische Erneuerung, Nr. 105, März 2016b, S. 14-28.
- Christoph Butterwegge, Flucht in die Armut? In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2016a, S. 13-16.
- Christoph Butterwegge, Dritte-Welt-Armut in Deutschland? Fluchtzuwanderung als Folge der Globalisierung und als Herausforderung des Sozialstaates. In: Z – Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Nr. 105, März 2016b, S. 76-86.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Politik mit Flüchtlingen – Deutsche Drangsale auf dem Weg zur globalisierten Nation. In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2015a, S. 15-30.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), „Ich sag' nur Köln!!“ In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2016, S. 45-56.
- Helmut Fehr, In geschlossener Gesellschaft – Ostmitteleuropa und die Rückkehr des Autoritären. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 1, 2016, S. 77-83.
- Norbert Frieters-Reermann, Für unser Leben von morgen – Das Thema Flucht und Flüchtlinge in der Erwachsenenbildung. In: Erwachsenenbildung, Nr. 4, 2015, S. 6-9.
- Julia Fritzsche/Sebastian Dörfler, Die Verachtung der Armen – Vom Bild des faulen Arbeitslosen zur Figur des „Asylschmarotzers“. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 3, 2016, S. 73-80.
- Peer Heinelt, Deutschstunde – Die hiesige Debatte über Grundwerte und Leitkultur flankiert ideologisch die repressive Flüchtlingspolitik. In: Konkret, Nr. 1, 2016, S. 28-31.
- Freerk Huisken, Nichts als Nationalismus – Deutsche Lehren aus Rostock und Mölln. Ein antirassistisches Tagebuch. Hamburg 1993, Neuauflage (Nichts als Nationalismus 1) 2001.
- Freerk Huisken, Brandstifter als Feuerwehr: Die Rechtsextremismus-Kampagne. Nichts als Nationalismus 2. Hamburg 2001.
- Freerk Huisken, Abgehauen – Eingelagert aufgefischt durchsortiert abgewehrt eingebaut: Neue deutsche Flüchtlingspolitik. Eine Flugschrift. Hamburg 2016.
- KAS – Konrad-Adenauer-Stiftung (Hg.), Flucht und Migration als Herausforderung für Europa – Internationale und nationale Perspektiven aus der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sankt Augustin/Berlin 2016, online verfügbar unter: www.kas.de/wf/de/33.44292.
- Katja Kipping, Nicht immer mehr, sondern ganz anders – Warum uns die Flüchtlingsbewegung die Systemfrage stellt. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2016a, S. 75-88.
- Katja Kipping, Wer flüchtet schon freiwillig – Die Verantwortung des Westens oder warum sich unsere Gesellschaft neu erfinden muss. Frankfurt/M. 2016b.
- Hans Kundnani, German Power – Das Paradox der deutschen Stärke. München 2016a.
- Hans Kundnani, Die Geschichte kehrt zurück: Deutschlands fatale Rolle in Europa. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2016b, S. 64-74.
- Albrecht von Lucke, Staat ohne Macht, Integration ohne Chance. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2016, S. 5-8.
- Stefan Luft, Die Flüchtlingskrise – Ursachen, Konflikte, Folgen. München 2016.
- Ulrich Menzel, Welt am Kipppunkt – Die neue Unregierbarkeit und der Vormarsch der Anarchie. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 1, 2016, S. 35-45.
- Markus Metz/Georg Seeßlen, Hass und Hoffnung – Deutschland, Europa und die Flüchtlinge. Politik aktuell 3. Berlin 2016.
- Philipp Ratfisch/Helge Schwiertz, Antimigrantische Politik und der „Sommer der Migration“ – Rassistische Mobilisierungen, das deutsch-europäische Grenzregime und die Perspektive eines gegenhegemonialen Projekts. Reihe Analysen, hg. von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Januar 2016.
- Stefan Ripplinger, Entsichert und geladen – Nach der Kölner Silvesternacht macht sich das deutsche Bürgertum auf den Rückweg in autoritäre Verhältnisse. In: Konkret, Nr. 3, 2016, S. 12-13.
- Conrad Schuhler, Die Große Flucht – Ursachen, Hintergründe, Konsequenzen. Neue Kleine Bibliothek, Bd. 221, Köln 2016 (erscheint im April).
- Anke Schwarzer, Integration im Sanktionsmodus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 3, 2016, S. 9-12.
- Z-Redaktion, Migration, „Flüchtlingskrise“ und die überschätzte deutsche Hegemonie in Europa. In: Z – Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Nr. 105, März 2016, S. 8-13.
Streit um die Flüchtlingspolitik
„Nach Köln“ und „nach Brüssel“ wird der Streit um die deutsche Flüchtlingspolitik schärfer. Und man fragt sich: Gibt es eigentlich neben der Angst vor der „arabischen Invasion“ (Papst Franziskus) auch noch eine linke Opposition oder Debatte, die mehr will als das „Wir schaffen das“ der Kanzlerin „mit Leben zu erfüllen“ (Linkspartei)? Dazu Anmerkungen von Johannes Schillo.
Von der rechten bis rechtsradikalen Opposition abgesehen scheint fast alle progressiven, alternativen, linken und sonstwie wohlmeinenden Stimmen im Lande eins zu einen: die Sorge, dass 'Mutti Merkel' bei ihrer ursprünglichen humanistischen Linie vom September 2015 bleibt und nicht mit Asylpaketen, Türkei-Deal und anderen realpolitischen Machenschaften die großartige Integrationschance verspielt, letztlich die Strahlkraft des 'hellen Deutschland' zerstört. Es ist schon erstaunlich, wie man im Innern der Nation angesichts der konstatierten globalen Herausforderungen zusammensteht, wie Kritik verstummt, wie eine 'eiskalte', 'neoliberale' Macherin, die jüngst noch ganze EU-Standorte in die Volksverarmung trieb, an allgemeinem Ansehen gewinnt. Ist denn in der Flüchtlingspolitik der Großen Koalition wirklich die reine Humanitas am Werk? Hilft in unserer „brüchigen Gemeinschaft“ nur noch der Osterglaube, wie die FAZ (24.3.2016) passend zum Karfreitag kommentierte, indem sie das Beispiel Jesu beschwor, der „trotz Zorn und Wut über den Verräter“ (Judas alias Seehofer?), trotz „Enttäuschung über die zerbrochene Gemeinschaft … seiner Sache treu geblieben“ sei? Ist, speziell der Linken, eine Kritik am imperialistischen Charakter der deutschen Weltflüchtlingsmacht, wie sie Freerk Huisken mit seiner profunden Streitschrift „Abgehauen“ vorgelegt hat (vgl. den oben stehenden IVA-Text „Betrifft: Flüchtlingspolitik“ vom 14.3.2016), fremd oder zu gewagt?
Parlamentarischer Konsens
Für die grüne und linke parlamentarische Opposition heißt der Imperativ jedenfalls glasklar: Integration muss gelingen; das, was begonnen wurde, ist in eine nationale Erfolgsgeschichte zu verwandeln. „2016 muss ein Jahr der Integration werden, ein Jahr des Aufbruchs zu einem neuen Miteinander. Dafür gibt es bereits gute Ansätze: Integration von Flüchtlingen findet täglich erfolgreich statt. Sie wird längst gelebt in Städten und Gemeinden… Der gegenwärtige Integrationsprozess ist die Grundlage für unser zukünftiges Zusammenleben. Jetzt muss der Boden für die ersten Schritte in Deutschland bereitet werden, für die mittelfristige Integration von Flüchtlingen in Bildung und Beruf und für die Klärung, ob sie eine langfristige Perspektive als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands anstreben.“ (Bündnis 90/Die Grünen 2016, 1, 2). Für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat die regierende Koalition Deutschland auf einen guten Weg gebracht. Der muss jetzt weiter beschritten werden, wobei man natürlich auch, wie es sich für eine Opposition gehört, vielfaches Versagen beim Regierungskurs feststellen kann. So vermissen die Grünen, was immer gut kommt, ein „Gesamtkonzept“ (ebd., 8), ohne das selbstverständlich Politik nie im Ganzen gelingen kann.
Aus der Linkspartei gibt es ähnliche Stimmen. Die Brandenburger Linke hat nach den Landtagswahlen vom März „in Diskussionen mit anderen Landesverbänden formuliert, wie 'Einwanderungs- und Integrationspolitik aus Ländersicht' gestaltet sein sollte. Die aktuelle Aufgabe laute, das 'Wir schaffen das' der Kanzlerin 'mit Leben zu erfüllen'“ (faznet, 21.3.16). Demnach soll Integration mit einem „Anreizsystem“ attraktiv gemacht werden, bei der Arbeitsmigration aber „die volkswirtschaftliche Gesamtsituation“ den Rahmen abstecken. „Falls jemand 'den Einstieg in das Erwerbsleben' nicht schaffe, sei 'die Rückkehr in das Heimatland' die logische Konsequenz. 'Entschlossen stellen wir uns denen entgegen, die aus Furcht, Neid, Egoismus oder Ideologie anderen Menschen ihr Leben bei uns verweigern wollen und unser Land sowie unsere Kultur abschotten wollen', heißt es in dem Papier. Andererseits wird auch gesagt: 'Wer bei uns und mit uns leben will, soll das Grundgesetz und die jeweiligen Landesverfassungen kennen und anerkennen', schließlich liege 'öffentliche Sicherheit' im Interesse aller. Integration sei nicht 'Politik nur im Interesse einzelner Gruppen', sondern müsse 'Chancen für alle' eröffnen und Risiken für einzelne und die Gemeinschaft vermeiden. Die Linkspartei kämpfe 'für ein gutes Leben für alle'. Ein 'universelles Glücksversprechen' aber könne und wolle sie nicht abgeben.“ (Ebd.)
Das ist aber nicht mehr unbedingt der Konsens der Partei. Die FAZ informiert genüsslich über die Fortschritte im linksoppositionellen Diskurs: „Solche Töne sind innerhalb der Linkspartei nicht mehr selbstverständlich. Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, kommentierte die Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof mit dem Satz, wer 'Gastrecht' missbrauche, verwirke es damit. Sie sprach im Januar von einer 'objektiven Kapazitätsgrenze' für die Aufnahme von Flüchtlingen und wiederholte das am Tag vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie sprach von 'Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung' und wies zurück, was selbst der linke Flügel ihrer Partei, deren Star sie ist, nicht gefordert hatte: 'Es können nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen'… Lafontaine sagte der Zeitung 'Tagesspiegel', viele Bürger fragten sich, wenn Geld für die Integration von Flüchtlingen da sei, 'warum war es dann vorher für unsere Anliegen nicht da?' Er lehnt es ab, AfD-Wähler als rechtsradikal oder rassistisch … zu bezeichnen. Er bezieht sich auf eine 'Politikverdrossenheit', die seiner Ansicht nach auf fehlendem sozialen Wohnungsbau, Mangel an Lehrern und ähnlichen Beschwerden beruht.“
Muss man sich also perspektivisch nicht nur auf eine Mitwirkung der Partei Die Linke bei einer Deutschland-Koalition, eventuell auf ein schwarz-rotes Bündnis, sondern auch noch auf Allianzen mit sozial unzufriedenen Patrioten von AfD oder Pegida einstellen?
Linke Debatte
In der Linken sind Zweifel am humanistischen Charakter der deutschen Linie in Sachen Flüchtlingselend aufgekommen. Bis in die Reihen der Linkspartei hinein, etwa bei der Vorsitzenden Katja Kipping, wurde der Verdacht einer „imperialen Außenpolitik“ (Kipping 2016, 80) laut und die Sorge vor weiteren Verelendungsschüben am Standort D geäußert (siehe IVA-Blog vom 14.3.2016). Doch ein solcher Verdacht wurde vielerorts nur vorgebracht, um ihn gleich wieder zu zerstreuen. Eine Meisterleistung in dieser Hinsicht ist der Besprechung von Huiskens Buch im Neuen Deutschland (Speckmann 2016) gelungen. Auch dem Rezensenten Guido Speckmann ist die seltsame Allianz zwischen rechts und links aufgefallen: „Selbst viele linke Kritiker des deutschen Asylsystems fühlten sich bemüßigt, Merkel und ihren vergleichsweise liberalen Kurs zu unterstützen…“ (ebd.). Dass es das neueste Deutschland so weit gebracht hat, dass oppositionelle Linke treu hinter der Regierung stehen, Gefolgschaft beim nationalen Zusammenschluss befürworten und praktizieren, ist ja schon ein bemerkenswerter Fortschritt. Stört der jemanden? Ist diese seltsame Übereinstimmung nicht Einspruch und/oder Klärung wert? Oder soll sie nur als das Kuriosum Erwähnung finden, dass Merkel in der Republik „einiges durcheinander gebracht“ hat (ebd.)? Fürs ND reicht das anscheinend aus.
Eine Klärung bietet dagegen Huisken an. Doch die will der Rezensent nur als interessante Interpretation gelten lassen, die „erfrischend zu lesen“ sei: „Auf einer abstrakten analytischen Ebene mag man Huisken in vielem zustimmen. Doch seine Argumentation greift mit ihrer Rigidität und Einseitigkeit letztlich doch zu kurz.“ (Ebd.) Dürftiger kann die Auseinandersetzung mit einem Buch und seiner Grundthese, die der Rezensent ja zur Kenntnis genommen hat, nicht ausfallen. Dass der Autor am Flüchtlingselend die „imperialistischen Gründe“ namhaft macht, wird als eine mögliche Sichtweise generös zugestanden: „Sicher ein zutreffender Aspekt“; gleichzeitig könne man aber auch wie Friedrich Schorlemmer, der vorher im Neuen Deutschland schrieb, „Humanität und Mitgefühl“ Merkels (ebd.) herausstellen. Man kann es so und so sehen – zu dieser haltlosen Konsequenz bekennt sich Speckmann. Genauso dubios ist die kleine Würdigung, die er Huisken, dem Urheber von diversen „im besten Sinne streitbaren politischen Interventionen“ (ebd.), zukommen lässt. Sie wird nämlich gleich durch die Mitteilung zurecht gerückt, dass man es bei dem Autor mit einem in der Wolle gefärbten Marxisten und notorischen Nestbeschmutzer zu tun habe, der gern „oberlehrerhaft“ auftrete. Merke: Eine Dosis persönlicher Schmähung kommt immer gut, wenn man sich mit der Sache nicht auseinander setzen will.
Wenn er schon die „anspruchsvollen“ Publikationen Huiskens würdigt, hätte der Rezensent dies auch auf die vorliegende beziehen können. Die argumentiert nämlich gar nicht so einseitig und platt, dass sie Merkel alle Menschlichkeit absprechen würde. Im Gegenteil, ein eigenes Kapitel (Huisken 2016, 68ff) analysiert die deutsche Entscheidungsfindung vom Spätsommer 2015 und fragt danach, ob man diese allein auf berechnungslose Barmherzigkeit zurückzuführen habe, ob es nicht vielmehr notwendig sei, den politischen Gehalt der Entscheidung zu überprüfen – einer Entscheidung übrigens, die im Konsens der gesamten politischen Führung getroffen wurde. Huisken schreibt dazu: „Das mit der Barmherzigkeit soll gar nicht geleugnet werden. Bei den Bildern aus Ungarn, garniert mit den Sprüchen von Orbán, kann einem schon die Galle hochkommen. Gegen Mitleid mag auch die Kanzlerin einer Mittelmacht wie Deutschland, die für jede Menge harte Schicksale nicht nur, wie in jüngster Zeit, in Griechenland gesorgt hat, nicht gefeit sein. Aber deswegen erschöpft sich Flüchtlingspolitik nicht in selbstloser Nothilfe und Humanität, die allein Maß nimmt an dem, was die geflohenen Menschen nötig haben.“ (Ebd., 68)
Ganz ohne Begründung will Speckmann dann die Abkanzelung des für halbwegs interessant befundenen Buchs nicht stehen lassen. „Einwände liegen umgehend auf der Hand“ und er nennt wenigstens einen: „Für Geflüchtete, die aufgrund einer etwaigen von Seehofer und AfD durchgesetzten Obergrenze irgendwo auf dem Balkan im Dreck ausharren müssen, macht es schon einen Unterschied, ob Merkel – aus welcher Motivation auch immer – Kurs hält oder von den strammen Nationalisten zur Wende gezwungen wird (wobei diese mit dem jüngsten Deal zwischen der EU und der Türkei bereits eingeleitet scheint).“ (Speckmann 2016) Eine interessante Verteidigung der Bundeskanzlerin! Dass Flüchtlinge im Dreck ausharren, im Mittelmeer ihr Leben riskieren, der Erpressung von Fluchthelfern, vulgo Schleuserbanden ausgeliefert sind, dass ganze Elendsregionen sich der Einstufung als sichere Herkunftsländer erfreuen, die begrenzte Anzahl der Hereingelassenen mit kategorischen Forderungen zur Anpassung bzw. zur Entwicklung von Rückkehrbereitschaft konfrontiert wird, all das findet ja schon unter einer Kanzlerin statt, die Kurs hält. Und dieser Kurs schließt gerade ein, dass man Mitglieder und Anrainer der EU mit Statuszuweisungen behelligt sowie das Grenzregime der 'Festung Europa' perfektioniert. Für Merkel ist der Türkei-Deal jedenfalls keine Wende, sondern die konsequente Fortsetzung ihrer Politik der Willkommenskultur, die von vornherein auf eine europapolitische Lösung zielte und so auch bekannt gemacht wurde. Warum und wie diese Konsequenz schon immer im Programm war, kann man in Huiskens Buch en détail nachlesen.
Die Ehrenrettung der Bundeskanzlerin ist überhaupt äußerst abgebrüht. Es stimmt ja, es gibt alternative imperialistische Strategien, wie dies die Führungsmacht des westlichen Bündnisses seit Jahrzehnten vorexerziert: Man kann einen widerspenstigen Staat in die Steinzeit zurückbomben oder ihm mit dem Sponsern einer terroristischen Untergrundbewegung zusetzen, man kann per „leading form behind“ vor Ort aktiv sein oder den ausgemachten Störfällen mit „carpet bombing“ kommen, um herauszufinden, ob „sand can glow in the dark“, wie es jüngst ein republikanischer US-Präsidentschaftskandidat formulierte. Man kann wie die BRD seit Adenauers Zeiten und der Proklamation einer Politik der Stärke sich des Rückhalts der weltgrößten Militärmaschinerie namens NATO bedienen, um als ziviler Imperialismus aufzutrumpfen, sich etwa in Form von Scheckbuchdiplomatie oder jetzt als Weltflüchtlingsmacht in Szene zu setzen. Man kann kriegsträchtige Feindschaftserklärungen – Beispiel Russland, Beispiel Iran – auf den Weg bringen, zunächst aber auf der Ebene des Wirtschaftskriegs versuchen, den Feind zu treffen, bevor man den Kalten Krieg zu einem heißen macht. In der Tat, es gibt imperialistische Varianten, die Menschen an dem einen oder anderen Ort, jetzt oder erst später, durch Bombenteppiche oder Drohnenbesuch sterben zu lassen. All das ändert nichts an der Feststellung dass man es hier mit einer „imperialen Außenpolitik“ zu tun hat.
Und Huisken legt gerade Wert darauf, die spezielle deutsche Variante eines humanistischen Imperialismus – der ungarische Premier sprach vom „moralischen Imperialismus“ – und dessen Schwierigkeiten, rivalisierenden Weltordnungsansprüchen zu begegnen, herauszuarbeiten. Dass solche Differenzierungen nicht „Sache des Autors“ wären, wie Speckmann behauptet, ist schon eine Dreistigkeit. Das ganze Buch ist eine solche Differenzierung. Es bemüht sich, den speziellen Fall einer imperialistischen Politik kenntlich zu machen, die sich aus der untergeordneten Rolle einer Mitmacher-Nation ergibt. Es nimmt gerade zum Ausgangspunkt, dass hier nicht mit Kanonenbooten, sondern mit Flüchtlingshilfe Weltpolitik gemacht, genauer gesagt: der Versuch einer europa- und weltpolitischen Aufwertung Deutschlands gestartet wird. Dass dem mit der CSU- oder AfD-Linie brutale nationalistische Alternativkonzeptionen gegenüberstehen – im Rahmen eines patriotischen Verantwortungsbewusstseins, das alle teilen –, ist bei Huisken ausführlich Thema. Die Feststellung des ND-Rezensenten, dass dank Merkels Kurs immerhin einige Menschen im deutschen Flüchtlingsparadies Aufnahme gefunden haben, wischt den ganzen analytischen Aufwand beiseite. Es wird gar kein theoretischer Einwand formuliert, sondern der pure Wille bekundet, in einer nationalen Sache Anschluss an die Führung zu finden und das Kritikastertum sein zu lassen. Insofern sind für Speckmann Kritikpunkte, wie er sie bei Huisken findet, bloß „Interpretationen“. Der Realismus des Mitmachens ist das Handfeste, Einblicke in den politischen Betrieb liefern höchstens subjektive Deutungen, die man besser bleiben lässt.
In der linken Debatte spielen natürlich die neueren Entwicklungen „nach Köln“ und auf dem Weg zum Asylpaket II eine besondere Rolle. (Überblicksdarstellungen zu den Einzelheiten der rasch aufeinander folgenden nationalen wie europäischen Maßnahmenpakete finden sich auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de; vgl. Hanewinkel 2016.) Die Entwicklungen werden häufig als Abschied von der Willkommenskultur verstanden, wo sie doch – siehe oben – gerade deren Konsequenz sind. Dann erscheint es so, als ob die ursprünglich waltende Menschlichkeit mittlerweile in politisches Kalkül umgeschlagen sei. Ober die Beobachter sehen sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass es der deutschen Kanzlerin sowieso nie um Hilfe für Flüchtlinge gegangen ist.
Die verschärfte Tonlage, die „deutsche Härte“ (Heinelt 2016), wird aufmerksam registriert. Aus dem christ- und sozialdemokratischen Lager lassen sich natürlich massenhaft Belege dafür finden, dass die nationalistischen Bedenken im Volk bei der Führung auf Verständnis stoßen. „Wenn Merkel erst wie Petry auftritt, braucht es die eine nicht mehr. Oder die andere“, kommentiert Hermann L. Gremliza (2016, 9). Die praktischen Verschärfungen, heißt es, betreffen ausschließlich die Flüchtlinge. Das 'dunkle Deutschland' werde toleriert, der Innenminister verdrücke bloß „Krokodilstränen über die mehr als 1.000 Attacken auf Flüchtlingsheime, die das Bundeskriminalamt allein 2015 gezählt hat… Im Unterschied zu Flüchtlingen werden Rassisten hierzulande nicht ganz so hart angefasst.“ (Heinelt 2016, 13f; vgl. Schaffmann 2016) Gegen diese nationalistische Stimmungsmache wird Position bezogen, etwa indem man davor warnt, die Flüchtlinge allein als Last zu sehen. Man soll, so heißt es, deutsche nicht gegen ausländische Hilfsbedürftigkeit ausspielen; der „entbrannte Verteilungskampf“ sei „nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv“ (Fratzscher 2016a, 99). „Große Teile der Wirtschaft werden von der Flüchtlingsmigration langfristig profitieren, denn es stehen mehr qualifizierte als gering qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung. Sie können sowohl die Produktivität als auch die Nachfrage erhöhen und letztlich auch das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand aller Menschen im Land verbessern, nicht nur ihren eigenen. Das geht aber nur, wenn die Integration erfolgreich gestaltet wird.“ (Ebd., 98; vgl. Fratzscher 2016b)
Das sehen andere Autoren ähnlich, wenden sich aber gegen die vorherrschende „neoliberale Integrationslogik“ (Koch/Niggemeyer 2016): Man sollte, statt dieser Logik zu folgen, die Integrationsfrage im Rahmen „solidarischer Zukunftsentwürfe“ aufgreifen (Ebd., 83). Dafür müsste aber, anders als von Marcel Fratzscher, dem neuen Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gefordert, „die Fluchtdebatte als verteilungspolitische geführt und mit der Vision einer grundsätzlich anderen Wirtschaftspolitik verbunden werden.“ (Ebd.) Wer solche – im Grunde gar nicht radikale, sondern an gesellschaftlichem Zusammenhalt und Wirtschaftswachstum interessierte – Bedenken gegenüber der praktizierten Integrationspolitik äußert, wird übrigens von konservativer Seite rasch mit dem Verdacht der nationalen Unzuverlässigkeit konfrontiert. Die FAZ z.B. entnimmt Kippings Buch die „Botschaft an die Zugewanderten: Ihr braucht euch nicht zu integrieren, ihr braucht euch nicht in die freiheitliche Demokratie und die freie Marktwirtschaft einzugliedern, hier soll sich sowieso alles ändern, hier soll – mit oder auch ohne euch – kein Stein auf dem anderen bleiben.“ (Hefty 2016) Aus dieser Perspektive soll sich nicht bei uns, sondern bei den Fremden alles ändern, der Islam z.B. – um ein anderes wichtiges Feld der Integration zu nennen – in seiner Gemeinde endlich „eine sexuelle Revolution“ zustande bringen (Ateş 2016).
Fatal ist es, wenn auf solche ausländerskeptischen bis -feindlichen Positionen damit reagiert wird, dass man ein idealistisches Bild der Integration entwirft, sie als zweiseitige Angelegenheit in einer auf Inklusion getrimmten Gesellschaft definiert, was eine Bring- und eine Holschuld oder die Chance der kulturellen Bereicherung einschließe, wenn man sie als Win-Win-Situation vorstellig macht, die allseits Vorteile bringen könnte etc. In der Hinsicht kann man Conrad Schuhlers Fazit zustimmen: „Eine humanistische Flüchtlingspolitik ist eine politische Kampfaufgabe“ (Schuhler 2016), nämlich, ernst genommen, kein Programm, das rasch mit einigen Änderungen in der Sozial- oder Steuergesetzgebung zu realisieren wäre, sondern eine gegen viele Widerstände zu realisierende Aufgabe. Dass ein solcher Kampf sich mit einer ganzen, fertig eingerichteten Welt politisch-ökonomischer Sachzwänge anzulegen hätte, macht Huiskens Flugschrift schlagend deutlich.
Literatur
- Seyran Ateş, „Der Islam braucht eine sexuelle Revolution“ – Seyran Ateş im Interview mit Natascha Roshani. In: Fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, Nr. 58, 2016, S. 40-42.
- Bündnis 90/Die Grünen, Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Antrag der Abgeordneten Amtsberg u.a., Deutscher Bundestag, Drucksache BT 18/7651, 24.2.2016.
- Marcel Fratzscher, Republik ohne Chancengleichheit: Deutschland am Wendepunkt. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 4, 2016a, S. 91-100.
- Marcel Fratzscher, Verteilungskampf: Warum Deutschland immer ungleicher wird. München 2016b.
- Hermann L. Gremliza, Er ist wieder da. In: Konkret, Nr. 4, 2016, S. 8-9.
- Vera Hanewinkel, Migrationspolitik – Februar 2016. Themenseite Flucht der Bundeszentrale für politische Bildung, online: www.bpb.de, 1.3.2016.
- Georg Paul Hefty, Vor lauter Schlagbaum die Grenze verpasst. In: FAZ, 12.3.2016.
- Peer Heinelt, Deutsche Härte – Über den deutschen Einfallsreichtum in Sachen Flüchtlingsabwehr. In: Konkret, Nr. 4, 2016, S. 12-14.
- Freerk Huisken, Abgehauen – Eingelagert aufgefischt durchsortiert abgewehrt eingebaut: Neue deutsche Flüchtlingspolitik. Eine Flugschrift. Hamburg 2016.
- Katja Kipping, Nicht immer mehr, sondern ganz anders – Warum uns die Flüchtlingsbewegung die Systemfrage stellt. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2016, S. 75-88.
- Martin Koch/Lars Niggemeyer, Der Flüchtling als Humankapital – Wider die neoliberale Integrationslogik. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 4, 2016, S. 83-89.
- Christa Schaffmann, Und was machen wir? Rückblick auf den Kongress „Migration und Rassismus“ der Neuen Gesellschaft für Psychologie in Berlin. In: Junge Welt, 11.3.2016.
- Conrad Schuhler, Wie wir es wirklich schaffen können, die „Flüchtlingskrise“ humanistisch und solidarisch zu meistern. Online: https://isw-muenchen.de/, 19.3.2016.
- Guido Speckmann, Alles Berufsnationalisten – Freerk Huisken interpretiert die neue deutsche Flüchtlingspolitik als Machtstreben. In: Neues Deutschland, 21.03.2016.
IS: macht Staat
„Die in missverständlicher Weise 'Islamischer Staat' genannte terroristische Organisation hält die Welt in Atem“, so eröffnet ein politikwissenschaftlicher Experte eine maßgebliche Expertise in Sachen IS (Politikum 3/15). Was von dieser Hauptlektion zu halten ist, kommentiert die IVA-Redaktion und informiert über die neue Analyse der Zeitschrift Gegenstandpunkt.
„Bei jeder Nennung des Namens 'Islamischer Staat'“, schreibt der Gegenstandpunkt in seiner neuen Analyse (Decker 2016, 57), „fügen seine Gegner hinzu, dass er nur 'so genannt' wird, weil er sich dazu unverschämterweise 'selbst ernannt' hat.“ In diesem Sinne stellt Politik-Professor Johannes Varwick im Editorial der Fachzeitschrift Politikum (Varwick 2015, 1) als Erstes klar, dass man die Terrorbande IS auf keinen Fall als Staatsgründer missverstehen dürfe. Dem folgt meist die zweite Lektion in Sachen Religion auf dem Fuße. Der Islam als Glaubensgebäude, als eine Säule des heutzutage vorherrschenden Monotheismus, heißt es, habe mit der Pseudo-Staatsgründung nichts zu tun. Anlässlich der Brüsseler Anschläge ist dies jetzt wieder von maßgeblichen Experten – sofern sie nicht gerade für Pegida oder Politically Incorrect (www.pi-news.net) im Marktsegment „Islamkritik“ tätig sind – verlautbart worden. Bis hin zur letzten Hinterhof-Moschee, die mittlerweile auch eine Presserklärung abgeben muss, heißt es dann: „Terror hat keine Religion“ (General-Anzeiger, 24./25.3.16).
Das ist schon interessant: „Der Ruf, den Staat und Religion im allgemeinen haben, ist offenbar so gut, dass aufgeklärte Abendländer mit und ohne Professorentitel fürs Islamisch-Orientalische dem IS weder das I noch das S konzedieren mögen“ (Decker 2016, 57). Womit man es bei dieser Aufklärung des Publikums zu tun hat, soll im Folgenden anhand aktueller Stellungnahmen und speziell der Analyse des Gegenstandpunkts Thema sein.
Eine „heilige Staatsgründung“...
„Wie wenig es Extremisten um den Glauben an sich geht, offenbart besonders zynisch der 'Islamische Staat'“, schreibt der Spiegel (Nr. 13, 2016) in seiner Oster-Titelstory „Die gefährliche Rückkehr der Religionen – Der missbrauchte Glaube“. Den Brauch, zu den beiden Highlights des Kirchenjahres (Weihnachten, Ostern) einen entsprechend religiös gefärbten Artikel beizusteuern, hält übrigens das aufgeklärte Nachrichtenmagazin wie auch der sonstige Qualitätsjournalismus treu ein. So viel christliche Orientierung muss in unserer säkularisierten Gesellschaft sein! „Die Religionen haben Kraft, leisten viel Gutes“, weiß der Spiegel, „aber die Macht des Glaubens hat auch eine unheimliche Seite“. Diese folgt kurioser Weise aus ihren wohltätigen Leistungen, dass sie nämlich dem Leben „einen Sinn, einen Rahmen“ und „ganzen Gesellschaften eine Basis der Gemeinsamkeit“ zu geben vermag. Die konstruktive religiöse Kraft wird aber leider immer wieder missbraucht – für ein neues „Gottessoldatentum“ oder für die Stärkung des Selbstwertgefühls sozialer Randexistenzen. Das gelte im Prinzip für alle Religionen, aber für den Islam in besonderer Weise, denn er „ist für die Nutzung als Allmachtsinstrument anfälliger als andere Religionen.“
Man erfährt in dem Spiegel-Artikel zwar auch – was in dieser Schärfe hier erstmals zu lesen ist –, dass der gegenwärtige fundamentalistisch-terroristische Spuk im Namen Allahs ein Werk der USA ist, die sich in Afghanistan zur Zeit des Ost-West-Gegensatzes entschlossen, „den Glauben zum Treibstoff im Krieg zu transformieren“, und damit die neue Guerilla-Konzeption schufen. Die US-Führung kam laut Spiegel auf die Idee, diese „taktische Ressource“ als Kampfinstrument gegen den gottlosen Kommunismus zu nutzen; eine eher klandestin-geheimdienstliche Variante davon stellte die Untergrundtätigkeit in Polen dar, die über den Vatikan gesponsert und dirigiert wurde. Aber die jetzt gelieferte Aufklärung über die Macher und Ausstatter des „Missbrauchs“ ändert nichts daran, dass der schwarze Peter beim Islam hängen bleibt: Als Religion ist er wie alle anderen zu wohltätigen Leistungen fähig, nur muss er endlich seine Anfälligkeit für politisch unerwünschte Zweckentfremdungen kurieren, sein Immunsystem stärken, d.h. sich in die westliche Wertegemeinschaft integrieren, wozu die selbst ernannten Antiterrorkrieger des Westens viele gute Ratschläge inklusive einer eurokompatiblen Reformation parat haben.
Auch der Gegenstandpunkt weist darauf hin, dass der Aufstieg fundamentalistischer Gotteskrieger erst einmal seine brauchbaren Seiten für die westlichen Weltordnungsansprüche hatte und, im Fall des Falles, immer noch hat. Von wegen Missbrauch der Religion! Wenn sich in deren Namen antikommunistische Mudschaheddin in Afghanistan oder sezessionistische Milizen in Bosnien-Herzegowina aufmachten, fand das den Segen der Nato und der Koalitionen unter US-Führung. In Syrien und Libyen haben die Gotteskrieger ebenfalls gute Dienste geleistet etc. So kann man konstatieren, „dass vor – und noch ziemlich lange neben – der Verurteilung als 'Macht des Bösen' die diversen Guten mit dem IS einiges anzufangen wussten“ (Decker 2016, 63). Dies ist in der Analyse des Gegenstandpunkts aber nicht das Entscheidende. Hinweise in die Richtung, dass nicht das übereifrige Koranstudium, sondern die westliche Indienstnahme nationalreligiöser Aufregung eine Infrastruktur ansehnlicher Gewaltexzesse aufgebaut hat, kann man heutzutage ja auch, wie gezeigt, in deutschen Nachrichtenmagazinen lesen.
Die Analyse von Decker und Co. widerspricht vor allem der gängigen Nicht-Erklärung des IS: Weder Religion noch Staat! Diese Fehlanzeige stellte der Westen, dessen Führungsmacht 2014 den neuen Krieg gegen den Terror ausrief, dem frommen Projekt aus. Politiker und Öffentlichkeit sprachen „dem störenden Emporkömmling überhaupt jedes politische Motiv und jeden Zweck ab“ (Decker 2014, 97). Statt dessen gelten die frommen Krieger als „das reine Böse, das nichts will als die Vernichtung des Guten: Gewalt um der Gewalt, Mord um des Mordes willen. Der Islamische Staat wird zum Feind der Menschheit deklariert, der vernichtet werden muss, um die Zivilisation zu retten. Gegen ihn ist alle Gewalt legitim und die Mithilfe aller Länder fällig“ (ebd.). Die erste Analyse des Gegenstandpunkts von 2014 konzentrierte sich auf den Nachweis, dass sich das IS-Unternehmen aus einer – zwar verrückten, aber im Rahmen imperialistischer Logik nachvollziehbaren – Zwecksetzung speist und dass die Dämonisierung des IS nur den fundamentalistischen Furor reproduziert, mit dem die Kalifats-Anhänger auf den von ihnen diagnostizierten Sittenverfall reagieren.
Der neue Gegenstandpunkt (GS 1/16), der seit Mitte März vorliegt, setzt diese Analyse fort. Hier wird dann auch ausführlich die Kampfansage der gesamten 'Völkerfamilie', die sich ja inzwischen mit einer UNO-Resolution auf das Feindbild IS geeinigt hat, thematisiert; die „abgestuften Störfalldiagnosen“ (Decker 2016, 63) kommen zur Sprache, dann das gemeinsame Vorgehen unter Führung des Westens, das statt Gemeinsamkeit lauter Konkurrenzaffären hervorbringt, schließlich der Kampf gegen den IS an der europäischen Heimatfront, also die „antiterroristische Praxis des staatliche Souveränitätsanspruchs über Leben und Gesinnung aller Volksteile“ (ebd., 71). Bei Letzterem geht es um die Aufrüstung der demokratischen Staatssicherheit, um die praktisch ergriffenen Maßnahmen. Daneben findet natürlich auch ein Kampf um die Köpfe statt. Für pädagogisch Interessierte sei darauf hingewiesen, dass sich in der GS-Ausgabe 1/16 auch ein Beitrag „Neues von der Anti-Terror-Front: 'Prävention gegen islamistische Radikalisierung von Jugendlichen'“ findet. Thema sind hier die neuen staatlich geförderten Präventions- und Bildungsmaßnahmen, die die Extremismusbekämpfungsprogramme der Bundesregierung fortsetzen.
Der entscheidende Streitpunkt dürfte aber, wie erwähnt, die Frage nach Religion und Staat sein. Dass beides dem IS abgesprochen wird, verdankt sich nicht, wie der GS-Artikel nachweist, der Kenntnisnahme der Besonderheiten dieser Staatsgründung, sondern nur deren praktischen Konsequenzen für die eingerichtete imperialistische Weltordnung. Weil der IS sich hier unübersehbar als Störfall, als nicht auf Anerkennung, Teilhabe und Benützung eingestelltes Gebilde, erweist, weil man ihn zwar bei bestimmten Gewaltaffären in Dienst nehmen kann, er sich aber seinem Selbstverständnis nach jeder Indienstnahme und geregelten Mitwirkung in der Staatenkonkurrenz versagt, ja die Berufung auf ein Menschenrecht zur Herrschaft über Staatsvölker kategorisch ablehnt, wird er ausgegrenzt. Der Sache nach schließen aber die Besonderheiten, die diese „heilige Staatsgründung“ auszeichnen, den IS gerade nicht aus der modernen Staatenwelt aus.
„Dass Menschenmassen als nationale Kollektivsubjekte definiert, auf einem – dafür gegebenenfalls erst zu 'befreienden' – Territorium versammelt und zur Basis eines Nationalstaates hergerichtet werden, der über sie in ihrem Namen regiert und sich auf dem komplett zwischen Staaten aufgeteilten Globus seinen Platz in der Konkurrenz um Reichtum und Macht verschaffen will“ (ebd., 57) – nichts erscheint den Befürwortern der westlichen Good Governance natürlicher. „Dass in diesem Zuge auch die Religion ihren Stellenwert als eine Form erhält, in der sich die sittliche Qualität der nationalen Kollektive bebildern und feiern lässt – auch das finden sie normal, auch wenn sie selbst gar keinem Gottesglauben anhängen. Und alle Gewalttätigkeiten, die im Laufe der Gründung von ehrenwerten Staaten fällig werden, können sie – je nachdem, ob sie wollen – wunderbar von den guten staatsgründerischen Absichten trennen“ (ebd.). All das könnte man auch beim IS entdecken, wenn man wollte. Nur vermisst der Westen dessen gute Absichten und hat damit übrigens recht, denn diese Staatsgründung verfolgt ein abweichendes Programm. Sie basiert aber – wie bei allen ehrenwerten Mitgliedern der UN – auf einem herrschaftlichen Verhältnis von Oben und Unten, in dem beide Seiten zu einem sittlichen Kollektiv zusammengeschlossen werden (sollen). Auch wenn es seine Besonderheiten aufweist, die in der Analyse des Gegenstandpunkts im Einzelnen gewürdigt werden, ist dieses Projekt kein Fremdkörper der modernen Staatengemeinschaft, sondern erweist sich als Geist vom Geist einer imperialistisch geordneten Welt.
… und die Aufklärung des Westens
Die Fachzeitschrift Politikum hat in ihrer Ausgabe 3/15 den IS zum Schwerpunktthema gemacht und Politikwissenschaftler, Nahostexperten, Terrorismusforscher, aber auch offizielle Vertreter der deutschen Staatssicherheit, so Oberst Peter Härle von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und den Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, zu Wort kommen lassen. Die Beiträge der beiden Letztgenannten liefern ein Musterbeispiel für die Nichterklärung des neuen Menschheitsfeindes, über den das Publikum aufgeklärt werden soll. Ja, es gibt diesen Feind, das erfährt der Leser, er nennt sich Staat, ist freilich nur eine „Terrororganisation“ (Härle 2015, 37), die entschieden bekämpft werden muss, was aber über den Einsatz militärischer Mittel hinausgeht und eine politische Stabilisierung in der Nahost-Region bzw. in weiteren Problemgebieten erfordert, so der Fachmann von der staatlichen Bundesakademie. Ja, dieser bösartige Feind bekämpft „uns“, heimtückischer Weise auch noch mit dem Internet, dabei stößt er Drohungen aus, zeigt bunte Bilder seiner Gräueltaten und wirbt damit sogar noch Anhänger in den westlichen Demokratien; das erfährt man im Wesentlichen vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Was der IS ist, woher er kommt, was er will, bleibt im Dunklen, genauer gesagt: löst sich ganz in die manichäische Betrachtung der Welt auf, derzufolge das Böse als der Gegner der Völkerfamilie auftritt, den wir als die Guten – oder diejenigen, die das Gute wollen – auszumerzen haben. Bzw. eigentlich zu tun hätten, aber wegen einer eigenartigen Uneinigkeit der UNO und, nachdem diese beseitigt ist, auf Grund der nachfolgenden „gegenläufigen Interessen der Koalitionsmitglieder“ (ebd., 39) nicht richtig hinkriegen. Fazit: An der Erkenntnis, dass dem IS-Unwesen „zunächst nur mit Gewalt begegnet werden kann, führt kein Weg vorbei“ (ebd., 38). Das „zunächst“ bedeutet aber nicht, dass Oberst Härle Bedenken beim eigenen Gewalteinsatz hätte – bei dem die BRD, wie er berichtet, maßgeblich beteiligt ist – und eine zu anderen Strategien führende Lagebeurteilung oder Ursachenforschung betreiben würde. Es ist damit nur gemeint, dass nach einer gewaltsamen Niederschlagung des IS-Unternehmens eine stabile, also durch NATO-Gewalt garantierte, politische Ordnung zu errichten sei. Den Hauptfehler sieht der Autor ja auch darin, dass der Westen mit seiner Gewalt zu lange gezögert habe: „Oftmals könnte ein rasches Eingreifen die weitere Ausbreitung eindämmen. Praktisch erfolgt dies jedoch meist nicht, da es an entsprechenden Krisenpräventionsmechanismen und vor allem dem politischen Mut fehlt, frühzeitig aktiv zu werden.“ (Ebd., 42)
Aussagen zu dem, was diesen Feind treibt, gibt es nicht, dafür scheinbar aufschlussreiche Einblicke in seinen Werdegang oder seine Hintergründe. Der IS kommt nicht aus dem Nichts, erklärt z.B. Härle gleich eingangs, denn, so die geniale Auflösung, er existiert schon seit längerem, circa seit dem Jahr 2000. Nachdem man also weiß, dass er nicht aus dem Heute, sondern aus dem Gestern kommt, gibt es eine weitere Entdeckung: Der IS hat in der Nahost-Region „ein Machtvakuum“ (ebd., 37) ausgenutzt. Ein Vakuum ist bekanntlich ein Nichts in der materiellen Welt, aus dem der Spuk also hervorgegangen sein soll. Aber war das nicht gerade zurückgewiesen worden? Egal! Spurenelemente einer Erklärung finden sich auch bei Maaßen, der ja bei seiner Schilderung der Propaganda, mit der der IS die Welt überflutet und aufs geschickteste die modernen Informationskanäle bestückt, irgendwo einmal mit einigen Sätzen auf die Inhalte dieser Propaganda eingehen muss. Drei Sätze finden sich denn auch in dem Text: Mit der Protestpose, die sie in ihren Publikationen kultiviere, verbinde die jihadistische Propaganda „die Utopie einer gerechten Weltordnung, die nur mittels Gewaltanwendung etabliert werden könne. Auch solle diese Weltordnung nach den Normen der Scharia ausgerichtet sein. Dabei wird suggeriert, dass auf diese Weise eine göttliche Ordnung errichtet werde, die keinen Raum für menschliche Schwächen lasse und daher gerecht sei.“ (Maaßen 2016, 45)
Wegen seiner Bedenklichkeit im ersten Satz sollte der Autor einmal bei Oberst Härle vorstellig werden. Dort könnte er etwas darüber erfahren, warum das Weltordnen ein hartes Brot ist und nur mit Gewaltanwendung geht, ja dass man sich sogar damit brüsten kann, dass Deutschland bei diesem brutalen Geschäft vorne mit dabei ist. Dass die „Normen der Scharia“ für den IS maßgeblich sind, kann man nicht bestreiten. Doch ist es etwas Ungewöhnliches, dass sich staatliche Projekte auf eine Bindung ans Recht und höhere Werte berufen? Ist nicht 'god's own country' oder die 'europäische Wertegemeinschaft' – laut feierlicher Selbstauskunft – genau so an Werten statt an Interessen orientiert und immer bestrebt, ihrem Recht, das einer höheren Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen soll, Geltung zu verschaffen? Woher resultiert denn die Diagnose des IS, die ja bei vielen Menschen Anklang findet, dass die Lebenslage der islamischen Community – weltweit – durch lauter Ungerechtigkeiten gekennzeichnet ist? Handelt es sich hier um einen Erfindung verblendeter Islamisten? Das vorherrschende Expertentum weiß dagegen eins mit Bestimmtheit: dass man es beim IS mit dem Feind der Menschheit zu tun hat. Und mit der Ausmalung dieses Feindbilds ist die Aufklärung auf weite Strecken hin befasst. So wird auch passender Weise in der Politikum-Ausgabe als weiterführende Literatur das aus Vor-Ort-Recherchen hervorgegangene Buch „ISIS – Der globale Dshihad“ des Journalisten Bruno Schirra empfohlen. Es zeichne sich durch Schilderungen aus, die den Leser „dicht heranführen an die Gräuel des IS“ und die „einzufangen versuchen, welche Motive einen gut behüteten Jugendlichen aus Deutschland in die Fänge einer Terrororganisation treiben“ (Matlé 2015, 88). Alles in allem sei es dem Autor gelungen, Einblicke in das neueste Terror-Unwesen zu geben, und „die persönliche Note verleiht der Erzählung Authentizität“ (ebd.). Ein erstaunliches Lob!
Das Buch des Journalisten Schirra (der für die Zeit, Cicero und die Welt tätig war) erschien Anfang 2015, nachdem der Autor sich 2003 und 2014 im Nahen Osten aufgehalten hatte und Augenzeuge des Siegeszugs des IS geworden war. Er sprach u.a. mit Kämpfern und Opfern, mit deutschen Salafisten und Dschihad-Aussteigern, mit Islamgelehrten und vielen Nachrichtendienstlern. Dies verarbeitete er dann zu einer Mischung aus Analyse, Reportage und Interviews. Der Redaktionsschluss des Buchs lag im Dezember 2014, so dass nur noch die Ausrufung des neuen War on Terror, den die USA 2014 starteten, berücksichtigt werden konnte. Dabei macht Schirra aus seiner Unzufriedenheit mit Obama, dem schwächsten Präsidenten, „den die USA seit dem Zweiten Weltkrieg hatten“ (Schirra 2015, 164), keinen Hehl.
In analytischer Hinsicht – vor allem im Blick auf Gründe, Ziele und Mittel der terroristischen Neuformierung – hat das Buch kaum etwas zu bieten. Das verdankt sich dem von vornherein gewählten Blickwinkel des Autors, der eine klare Zuweisung von Verantwortung und Opferrolle vornimmt: „Wir“ sind das unschuldige, machtlose Opfer, „ISIS ist zu einer global agierenden Massenbewegung geworden… Der Westen steht dem hilflos gegenüber.“ (Ebd., 173) Dies ist die Kernaussage, die ständig variiert wird. Das Abendland sieht Schirra bedroht, weil ihm aus dem Morgenland ein purer Zerstörungswille, „gefangen im blindwütigen Hass“ (ebd., 58), entgegenschlage. Dass „der Westen“ nicht nur Opfer ist, sondern sich seit Jahrzehnten in der nahöstlichen Region machtvoll, gerade auch mit Militär und Geheimdiensten, engagiert – von der Unterstützung islamistischer Kämpfer in Afghanistan bis zum jüngsten syrischen Schlachtfeld –, spielt bei Schirra keine Rolle. Kritik übt er nur an den Interventionsgelüsten der Anrainer, allen voran am Iran, aber auch in gemäßigter Form an den westlichen Verbündeten wie Saudi-Arabien, Katar, den Golfstaaten und der Türkei. Bei diesen Bündnispartnern gibt es dann schon einmal Andeutungen dazu, dass der IS ein politisches Projekt darstellt, das sogar machtvolle Promotion kennt, und nicht einfach aus dem Amoklauf gescheiterter Existenzen besteht.
Das Buch hat vielleicht als Dokument einer Geisteshaltung Wert. Es macht den Leser mit dem Weltbild eines Embedded Journalist bekannt, also mit der selbstbewussten Haltung eines Menschen, der, unterstützt von militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Kontakten, vor Ort recherchiert und sein Material so aufbereitet, dass es in den medialen Mainstream seiner 'Einbetter' passt. Die Faktenerarbeitung beginnt bei der zielstrebigen Auswahl der Zeitzeugen. Wenn Schirra und sein ortskundiger Führer mit IS-Opfern sprechen, erhalten diese sofort einen Bonus: „Wir glaubten ihnen… und sei es auch nur, weil wir ihnen glauben wollten.“ (Ebd., 14) Aus dem O-Ton werden dann Bausteine fürs Feindbild genommen, das das Buch an seinen Anfang stellt. Im IS tritt uns, dem guten Westen, „die Kultur des Todes“ (ebd., 8), entgegen, heißt es. Schirras kurdischer Freund sagt über die IS-Kämpfer: „Sie sind keine Menschen. Sie sind schlimmer als die schlimmsten Tiere.“ (Ebd., 13) „Sie sind Ratten“ (ebd., 11), wird eine andere Zeugin zitiert. Ein ungutes Gefühl, dass er in dieselbe mörderische Diktion verfällt wie die IS-Kämpfer, die den ungläubigen Untermenschen den Krieg angesagt haben, beschleicht den Autor dabei nicht.
Das hängt mit seiner klar entschiedenen Parteilichkeit zusammen. Dass die Region von Nordafrika bis zum Nahen Osten durch Krieg und Bürgerkrieg verwüstet ist, darf per definitionem nichts mit dem Westen zu tun haben. Zwar kennt auch Schirra die Verwüstungen, nennt den Irak z.B. einen „Failed State“ (ebd., 143), aber das habe sich die Region selber zuzuschreiben: „Die arabische Zivilisation hat sich diese Wunden selbst geschlagen. Es war nicht der böse Westen“ (ebd., 8), es waren vielmehr böse Menschen, „Barbaren“ (ebd., 9), die aus den Glaubenstumulten der arabischen Welt hervorgingen. „Muss da die Unschuld des George W. Bush noch eigens erwähnt werden?“ (ebd., 9), fragt Schirra, nachdem er sein Bekenntnis zur westlichen Güte abgeliefert hat, ganz ohne Ironie. Nein, wer so bekenntnisstark agiert, muss sich mit Nachweisen nicht mehr aufhalten.
Andere Expertisen gibt es natürlich auch, die sich von der Anlage her wissenschaftlicher geben, so das Buch von Behnam T. Said (2015), das in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen ist. Der Autor ist Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hamburg, wie ja überhaupt ein Großteil der neueren islamwissenschaftlichen Literatur von Angestellten der Sicherheitsbehörden stammt (vgl. Schoene 2015) – was dem Leser nicht immer mitgeteilt wird. Wenn die Autoren weiter ausholen (vgl. Buchta 2016, Steinberg 2015), wird dann eine Vielzahl von Faktoren aufgezählt, die historische Spaltung in Sunniten und Schiiten, der Verlauf des syrischen Bürgerkriegs oder die Geschichte des Iraks nachgezeichnet. Oder es werden Szenarien entworfen (Hanne/Flichy de la Neuville 2015), wie sich die Nahost-Region in den nächsten Jahren entwickeln könnte – kurz gefasst: Der IS könnte siegen bzw. sich stabilisieren, was nicht gut wäre, oder die westlich geführte Koalition könnte durch koordinierten Gewalteinsatz den Sieg davon tragen, was dann eine optimistische Prognose wäre. Die Hauptlektion bleibt jedenfalls bei aller Differenzierung bestehen: Der IS ist ein Unstaat, ein einziger Störfall der Weltordnung, was nur zu der einen, alles entscheidenden Frage führt, wie er mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden kann.
Literatur
- Wilfried Buchta, Terror vor Europas Toren – Der Islamische Staat, Iraks Zerfall und Amerikas Ohnmacht. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Nr. 1695, Bonn 2016.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Antiterrorkrieg nächster Akt – Luftschläge und eine neue Allianz-Politik der USA gegen den Heiligen Krieg des Islamischen Staates. In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2014, S. 97-108.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Staat des Islamischen Kalifats (IS) – Ein Störfall für die imperialistische Weltordnung und seine ordnungsgemäße Verarbeitung. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2016, S. 57-75.
- Peter Härle, Eine globale Strategie gegen den „Islamischen Staat“. In: Politikum, Nr. 3, 2015, S. 36-42.
- Oliver Hanne/Thomas Flichy de la Neuville, Der islamische Staat – Anatomie des neuen Kalifats. Berlin 2015.
- Hans-Georg Maaßen, Jihadistische Propaganda im Internet – Der „Islamische Staat“ nimmt den Westen ins Visier. In: Politikum, Nr. 3, 2015, S. 44-48.
- Aylin Matlé, Bücher zum Thema (u.a. Rezension zu Schirra, ISIS). In: Politikum, Nr. 3, 2015, S. 88-91.
- Behnam T. Said, Islamischer Staat – IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Nr. 1546, Bonn 2015.
- Bruno Schirra, ISIS – Der globale Dshihad. Wie der „Islamische Staat“ den Terror nach Europa trägt. Berlin 2015.
- Stefanie Schoene, Literaturagenten. In: Freitag, Nr. 9, 2015.
- Guido Steinberg, Kalifat des Schreckens – IS und die Bedrohung durch den islamistischen Terror. München 2015.
- Johannes Varwick (Hg.), Islamischer Staat. Schwerpunktheft von: Politikum – Analysen, Kontroversen, Bildung, Nr. 3, 2015.
Februar 2016
Arbeit und Reichtum – Thesen
Die „Kluft zwischen Arm und Reich“ ist der geläufige Klagetitel, mit dem sich die politische Öffentlichkeit, hierzulande speziell seit der rotgrünen Einführung einer offiziellen Armuts- und Reichtumsberichterstattung, ein soziales Gewissen macht. Gegeninformation Köln hat dagegen mit einer Veranstaltung auf den Gegensatz von Arbeit und Reichtum aufmerksam gemacht. Dazu die folgenden Thesen.
Arbeiten in der Marktwirtschaft steht unter dem Gebot der Rentabilität und des darin enthaltenen Widerspruchs, dass Rentabilität einerseits möglichst viel, andererseits möglichst sparsamen Arbeitseinsatz gebietet. Arbeit unter dem Diktat der Rentabilität ist für Lohnarbeiter ein untaugliches Mittel für den Lebensunterhalt.
Thesen zum kapitalistischen Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum
I. Das Arbeiten für Geld ist von der Eigentumsordnung erzwungen und dient der Vermehrung des Privateigentums durch fremde Arbeit.
II. Für seine Vermehrung beugt unternehmerisch angewandtes Eigentum die Bezahlung und Anwendung der Arbeit unter das Gebot der Rentabilität: Die Arbeit hat dem Unternehmen mehr geldwerte Leistung einzubringen, als sie an Lohnkosten verursacht, und mit ihrer Rentabilität die Rentabilität des gesamten aufgewandten Kapitals zu gewährleisten.
III. Unternehmen steigern ihre Rentabilität entscheidend dadurch, dass sie die technische Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zur Senkung der Lohnstückkosten nutzen, um mit gesenkten Warenpreisen um das Geld der Gesellschaft zu konkurrieren.
IV. Unternehmen nutzen den Kredit, die vergesellschaftete Privatmacht des Geldes, zur Steigerung ihrer Produktivität bzw. Rentabilität für die Konkurrenz um das Geld der Gesellschaft. Wegen der Wucht, die der Kredit für die Rentabilitätssteigerung hat, konkurrieren die Unternehmen mit ihrer Produktivitäts- bzw. Rentabilitätssteigerung um Kredit. Da der Kredit den Unternehmen in der Spekulation auf künftige Konkurrenzerfolge zur Verfügung gestellt wird, haben Unternehmen gegenüber den Kreditgebern ihre Kreditwürdigkeit durch eine konkurrenzfähige Senkung der Lohnstückkosten zu belegen.
V. Auf dem Weltmarkt konkurrieren Unternehmen mit der Produktivitäts- bzw. Rentabilitätssteigerung um das Geld bzw. die Gelder der Welt. In der Weltmarktkonkurrenz setzen Unternehmen aus Nationen mit fortgeschrittener Produktivität bzw. Rentabilität den weltweit gültigen Maßstab für die Rentabilität der Arbeit, an dem sich die Unternehmen und Gelder aller Nationen zu bewähren haben; weswegen sie eine dem nationalen Rentabilitätsniveau entsprechende Sortierung erfahren.
VI. Staaten, die mit Geld regieren, konkurrieren auf dem Weltmarkt mit der Produktivität bzw. Rentabilität der nationalen Arbeit um die Stabilität ihres nationalen Geldes. Für dessen Gebrauch als globales Geschäftsmittel leisten sie nationalen Unternehmen und Kreditinstituten politische Hilfestellung bei der Steigerung ihrer internationalen Konkurrenz- und Finanzmacht, indem sie ihre Staatsmacht einsetzen zur indirekten und direkten Senkung der Lohnstückkosten. Mit ihrer Finanzmacht organisieren und finanzieren sie den „technischen Fortschritt“ im Lande, und mit der Macht des Sozial- und Rechtsstaates senken sie das nationale Lohnniveau.
Die Thesen basieren auf dem Buch von Margaret Wirth und Wolfgang Möhl „'Beschäftigung' – 'Globalisierung' – 'Standort': Anmerkungen zum kapitalistischen Verhältnis zwischen Arbeit und Reichtum“ (München 2014, Gegenstandpunkt-Verlag, 132 Seiten, ISBN 978-3-929211-14-6, auch als E-Book erhältlich. Website: ww.gegenstandpunkt.com/anavlg.html). Das Buch ist die überarbeitete und erweiterte Fassung eines Artikels, der in den Ausgaben 3-12 und 4-12 der Zeitschrift Gegenstandpunkt erschienen ist. Beim Münchner Jour Fixe des Gegenstandpunkts wurde übrigens im Jahr 2012 eine längere Diskussion über die in dem Buch entwickelten Thesen zu „Arbeit und Reichtum“ gestartet. Dazu liegen ausführliche Diskussionsprotokolle vor, die auf der Gegenstandpunkt-Homepage greifbar sind (Adresse: http://www.gegenstandpunkt.de/jourfixe/prt/jfix201…). Insgesamt handelt es sich um vierzehn Protokolle, beginnend mit dem 3. Dezember 2012 und endend am 10. Februar 2014.
Oh Gott, katholische Kapitalismuskritik!
Wenn man heutzutage auf kritische Statements zum Turbo-, Raubtier-, Ego- oder Kasinokapitalismus stößt, fällt über kurz oder lang ein Name: Papst Franziskus. Er gilt als die Berufungsinstanz zeitgenössischer Kapitalismuskritik. Was es damit auf sich hat, erläutert Johannes Schillo.
In neueren Diagnosen, die vor dem Siegeszug eines ungezügelten Kapitalismus warnen, erfährt seit Jüngstem wieder – worauf bereits der IVA-Blogeintrag „Noch ein Gespenst: Der Ego-Kapitalismus“ hinwies – das Kuriosum einer katholischen Kapitalismuskritik Auftrieb. Im Kontext solcher Warnungen, aber auch in sonstigen linken Einlassungen wird speziell der berühmte Ausspruch des Bergoglio-Papstes „Diese Wirtschaft tötet“ zitiert. Die Zeitschrift „Sozialismus“ brachte in ihrer Nummer 7-8/2015 friedlich vereint die Köpfe von Marx, Engels und Papst Franziskus auf dem Titelblatt. Die Theologen Franz Segbers und Simon Wiesgickl, die im Sommer 2015 einen einschlägigen Sammelband veröffentlichten, wählten das Statement als Hauptüberschrift. Für sie ist der Papst Kronzeuge der gegenwärtigen Sozialkritik. Andere Fachleute, etwa aus dem Lager der akademischen katholischen Soziallehre, greifen unter dem Motto „Den Kapitalismus bändigen“ das Erbe des Jesuiten Oswald von Nell-Breuning auf, der als maßgebliche Autorität ihres Fachs gilt. Wieder andere benützen die Klage über den menschlichen Egoismus für den Entwurf einer von Grund auf moralischen Kapitalismuskritik (vgl. Schirrmacher 2013). Und, last but not least, wirbt jetzt die Linke bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz mit Papstfoto und -spruch auf ihren Plakaten.
Segbers und Wiesgickl halten die genannte Kritik zudem für den sozialethischen Grundsatz der heutigen christlichen Kirchen – und tendenziell darüber hinaus. Erstmals gebe es eine „große Ökumene“ der Kirchen, also der weltweiten Christenheit, in klarer Absage an „Geist, Logik und Praxis des Kapitalismus.“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 10) Eine Merkwürdigkeit nebenbei: Der Sammelband, den die beiden Theologen vorlegten, schließt zwar programmatisch an das Papstwort aus „Evangelii gaudium“ (2013) an, es handelt sich aber nicht um eine katholische Publikation. Das zeigt sich schon an den Autoren, die größtenteils aus dem evangelischen Raum stammen, aus der Wissenschaft, aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder, in einem Fall, aus dem „muslimischen befreiungstheologischen Kollektiv Baraka“; verstärkt wurden sie durch drei katholische Autoren mit papsttreuer Haltung (Franz Hinkelammert, Kuno Füssel, Michael Ramminger). Ein rund 50seitiger Anhang dokumentiert vor allem die jüngsten Erklärungen des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), dazu auch Auszüge aus der von dem Rat initiierten São-Paulo-Erklärung „Umwandlung des internationalen Finanzsystems zu einer Wirtschaft im Dienst des Lebens“ (2012).
Der ÖRK ist ein weltweiter Zusammenschluss von 345 Kirchen. „Mitglieder sind die meisten großen Kirchen der evangelischen Traditionen, die anglikanischen Kirchen, die altkatholischen Kirchen und die meisten orthodoxen und altorientalischen Kirchen“ (Wikipedia). Aus deren Umkreis kommen auch die beiden kapitalismuskritischen Theologen. Sie dokumentieren in ihrem Buch einige Aussagen von Papst Franziskus, so die Ansprache beim „Welttreffen der sozialen Bewegungen“ (2014). Wegen des Redaktionsschlusses konnte dessen neue Umweltenzyklika „Laudato si“ vom Juli 2015 allerdings nicht mehr berücksichtigt werden. Die Enzyklika ist in der Öffentlichkeit erneut als Fall expliziter Kapitalismuskritik aufgenommen worden (vgl. Fleischmann 2016), wobei sich die Begeisterung der deutschen Medien in Grenzen hielt. Der Wortlaut der einschlägigen katholischen Dokumente findet sich übrigens im Netz auf den kirchlichen Homepages, etwa der Pressestelle des Vatikans (www.vatican.va/news_services/press/index_ge.htm) oder der Deutschen Bischofskonferenz (www.dbk.de).
Zu dieser angeblich „verdrängten und verschwiegenen Übereinstimmung“ (Segbers/Wiesgickl 2015b, 2) des religiösen Antikapitalismus, die zur Zeit von sich reden macht und mit diversen Veröffentlichungen hervortritt, im Folgenden einige Anmerkungen.
Kritisches Christentum?
Segbers/Wiesgickl sehen in ihr, wie gesagt, den neuen kirchlichen Konsens: „Erstmals gibt es eine große Ökumene der orthodoxen, anglikanischen, baptistischen, lutherischen, methodistischen, reformierten, alt-katholischen und römisch-katholischen Kirchen in der klaren Ablehnung von Geist, Logik und Praxis des Kapitalismus.“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 10) Diese erreichte Übereinstimmung im sozialethischen Grundsatz wollen die beiden Autoren bekannt machen. Dabei bemüht sich ihr Sammelband, die nicht gerade geläufige Sichtweise einer antikapitalistischen Christenheit in mehreren einführenden Beiträgen zu belegen, um dann in einem ersten Teil auf das breiter gefasste Thema „Der Kapitalismus in der Kritik der Religionen“ einzugehen. Der abschließende zweite Teil bringt unter der Überschrift „Von einer von Habgier getriebenen Wirtschaft zu einer Kultur des Lebens“ eine Sammlung von Texten, die sich unterschiedlichen Aspekten der sozialen Rolle der Kirchen – kirchliche Sozialarbeit, spirituelle Techniken, Dialogerfahrungen, Nord-Süd-Konflikt etc. – widmen. In den Beiträgen geht es etwa um den Versuch, die marxistisch inspirierte Befreiungstheologie (die Bergoglio als argentinischer Kirchenführer seinerzeit bekämpfte) wiederauferstehen zu lassen, die Marxsche Kritik am Warenfetisch als Fetischismus-, d.h. Religionskritik zu lesen (also den Kapitalismus als Religion und die bestehenden Religionen tendenziell als Antikapitalismus zu interpretieren) oder in der Occupy-Bewegung religiös relevante Phänomene wie eine „Tiefensolidarität“ (ebd., 55) auszumachen (d.h. eher virtuelle als reale Berührungspunkte zu den neuen Protestbewegungen zu identifizieren).
Was das Buch auf jeden Fall leistet: Es ruft die breite, heterogene Tradition christlicher bzw. religiöser Kapitalismuskritik in Erinnerung. Diese hat ja auf katholischer Seite im autoritativen Korpus der Sozialenzykliken von „Rerum novarum“ (1891) bis zu „Quadragesimo anno“ (1931) – letztere kurz nach der Weltwirtschaftskrise geschrieben, mit den schärfsten Worte gegen den „Imperialismus des internationalen Finanzkapitals“ (KAB 1975, 130) – und von dort bis „Laudato si“ ihren Niederschlag gefunden. Die Publikation macht auch deutlich, dass die hierzulande übliche Behauptung, man lebe als Deutscher in einer im Prinzip sozialverträglich angelegten Marktwirtschaft und habe mit den unschönen Tendenzen des Weltkapitalismus nichts zu tun, unhaltbar ist. Außerdem gibt es nebenher zutreffende Charakterisierungen der politischen Rolle, die die christlichen Kirchen in Deutschland spielen. Von Antikapitalismus ist hierzulande ja wenig zu spüren, denn die Kirchenleitungen ergreifen auch nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise weiterhin „Partei für die politischen und ökonomischen Eliten mit ihrer Agenda-Reform“ (Segbers 2014, 27). Das Manko des Diskussionsbeitrags der beiden Theologen besteht in zweierlei:
Erstens weicht man, obwohl viel auf Marxsche Texte rekurriert wird, der Auseinandersetzung mit marxistischer Kritik aus. So zeigen sich die Herausgeber gleich auf der zweiten Seite ihrer Einführung unwillig, den Argumentationsgang einer solchen Kritik, wie sie Freerk Huisken mit dem Text „Der Papst als Kapitalismuskritiker: Unfehlbar?“ (www.magazin-auswege.de) vorgelegt hatte, auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Huisken insistierte in seiner „Gegenrede“ darauf, dass in „Evangelii gaudium“ das Produktionsverhältnis ausgeblendet und statt dessen der Konsum in den Mittelpunkt gerückt werde. Auffällig ist ja schon, dass in den beiden einschlägigen Schriften von Bergoglio kein einziges Mal das Wort „Kapitalismus“ fällt, in „Laudato si“ wird z.B. nur an einer Stelle beiläufig vom „Kapital“ als ökonomischem Sachverhalt gesprochen – ein markanter Unterschied etwa zur Soziallehre in der Tradition von „Quadragesimo anno“, wo vom Kapitalverhältnis, dem darin eingeschlossenen Gegensatz zur Lohnarbeit oder der Klassengesellschaft die Rede war. Mit der Frage nach dem Produktionsverhältnis müsste eigentlich die Auseinandersetzung beginnen, doch die wird durch ein – gewolltes Missverständnis der beiden Schriftgelehrten – sofort umgangen. Huisken hatte seine Gegenrede mit der zustimmenden Festellung eröffnet, dass sich der Blick des Papstes „auf Erscheinungen (richtet), die niemand ernstlich bestreiten kann“ (Huisken 2014, 1), dass aber die Feststellung des päpstlichen Schreibens, der Mensch sei nur noch als Konsument gefragt, an der Sache vorbeigehe. Huisken: „Diese Reduktion 'des Menschen' auf einen Konsumenten ist nicht nur deshalb kaum zu halten, weil dort, wo konsumiert wird, 'der Mensch' wohl auch als Produzent gefragt ist; und weil dort, wo kapitalistisch produziert wird, 'der Mensch' gleich doppelt gefragt ist, nämlich als jemand der arbeitet und als jemand der arbeiten lässt. Zugleich stellt sich darüber heraus, dass mit dieser Eindampfung der diversen ökonomischen Charaktere dieser Produktionsweise auf die Abstraktion 'Mensch' nicht eine einzige der aufgezählten Erscheinungen einer Erklärung zugeführt werden kann.“ (Ebd., 2)
Die Erwiderung von Segbers/Wiesgickl ist bemerkenswert. Als Erstes heißt es, die neu in Stellung gebrachte „große Ökumene“ des Antikapitalismus irritiere offensichtlich „'rechts' wie 'links' gleichermaßen“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 11). Beleg dafür ist ein Artikel von Rainer Hank aus der „Frankurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS, 1.12.2013), in dem es heißt, der Papst habe nichts anderes anzubieten „als das Konzept 'Mutter Teresa in Kalkutta' – also Barmherzigkeit und Almosen. 'Dass es zur Überwindung der Armut Marktwirtschaft und Kapitalismus braucht, kann dieser Papst nicht sehen'.“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 10) Die beiden Sozialethiker bemerken dazu: „Rainer Hanks Kritik eines naiven Antikapitalismus des Papstes berührt sich interessanterweise mit jener des marxistischen Publizisten Freerk Huisken“ (ebd., 11). Was sich hier berühren soll, ist einigermaßen unerfindlich. Der FAZ-Autor Hank ist offenkundig Parteigänger des Kapitalismus und will auf ihn nichts kommen lassen: Nur durch diese Wirtschaftsweise könne das Elend der Welt überwunden werden. Huisken vertritt genau das Gegenteil. Er hält die Kritik der „herrschenden Wirtschaftsweise“ für notwendig und vermisst in der päpstlichen Äußerung gerade, dass sie das leistet. In der Erwiderung der Theologen heißt es dann weiter: Huisken „attestiert dem Papst zwar einen 'heiligen Zorn über die herrschende Wirtschaftsweise', doch mehr nicht. Er zitiert aus einer Pressemeldung den Papst: 'Der Mensch sei nur als Konsument gefragt'.“ (Ebd.) Hier trifft man auf eine Eigenart frommer Schriftgelehrter, die man auch sonst in Begegnungen mit Juden, Christen und Muslimen erlebt. Kaum hat man einen Satz aus den (mehr oder weniger) heiligen Texten zitiert, wird man darüber belehrt, dass dieser anders zu verstehen, zu übersetzen oder aus dem Kontext zu erklären sei. Segbers/Wiesgickl (ebd.) wenden ein: „Auch wenn Huisken dies ein authentisches Zitat des Papstes nennt, hat der Papst das Gegenteil gesagt: Der Papst wendet sich gerade dagegen, dass der Mensch 'nur als Konsument' gefragt sei; er werde zu einem 'Konsumgut', also zu einem Objekt, das man wie 'Müll' oder 'Abfall' entsorge (EG 239).“ Auch wenn es jetzt akribisch wird, muss man doch einmal den exegetischen Kunststücken der Theologen nachsteigen. Huisken hatte nicht irgendeine Pressemeldung über den Papst zitiert, sondern korrekt und sachgerecht „aus der vom Vatikan autorisierten übersetzten Zusammenfassung seiner Schrift“ (Huisken 2014, 2). Dort hieß es: „Der Mensch sei nur noch als Konsument gefragt, und wer das nicht leisten könne, der werde nicht mehr bloß ausgebeutet, sondern ausgeschlossen, weggeworfen. Diese Kultur des Wegwerfens habe etwas Neues geschaffen. ,Die Ausgeschlossenen sind nicht 'Ausgebeutete', sondern Müll, 'Abfall''.“ Wiedergegeben ist diese Meldung komplett in der betreffenden Gegenrede am selben Ort.
Was steht nun im Apostolischen Schreiben. Im Abschnitt 55 (EG, zitiert nach den Nummern) schreibt der Papst: „Die weltweite Krise macht … vor allem den schweren Mangel an einer anthropologischen Orientierung deutlich – ein Mangel, der den Menschen auf nur eines seiner Bedürfnisse reduziert: auf den Konsum.“ Die angesprochene anthropologische Fehlorientierung, die Reduktion auf die Konsumentenrolle, hält der Papst also für das existierende Grundübel. Und sie lässt sich sinnvoller Weise so zusammenfassen – wie es die offizielle Pressemeldung getan hat –, dass der Mensch nur noch als Konsument gefragt sei. Man kann das auch als den Systemcharakter der heutigen Wirtschaft bezeichnen; so heißt es an anderer Stelle in dem päpstlichen Schreiben, heute herrsche der „zügellose Konsumismus“ (EG 60). Genau das hat Huisken aufgegriffen und dabei natürlich vermerkt, dass der Papst dies als Kritik meinte. Die harten Worte über die „Kultur des Wegwerfens“ wurden ja ebenfalls zitiert. Gutwillig müsste man hier also von einem eklatanten Lesefehler der päpstlichen Exegeten sprechen…
Segbers/Wiesgickl dagegen stellen ihren Kontrahenten erst einmal völlig ins Abseits: Er sei d'accord mit kapitalistischen Schönfärbern und habe keine Ahnung vom Text! Dann bringen sie jedoch noch in drei Sätzen eine Zurückweisung der geäußerten Kritik, die ihnen nicht ganz entgangen zu sein scheint: „Huisken unterstellt dem Papst, lediglich abstrakt von dem Menschen zu reden. Doch dem Papst geht es gar nicht, wie unterstellt, um 'den Menschen an sich', sondern um den konkreten, den ausgebeuteten, den an den Rand gedrängten, den verarmten Menschen, der wie Müll weggeworfen wird. Franziskus geht es nicht darum, eine bessere Wirtschaftstheorie zu entwicklen, sondern darum, die Perspektive der Ausgeschlossenen und Armgemachten einzuklagen.“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 12) Das ist nun wirklich ein Treppenwitz. Dem Papst geht es, wie man seinen Schriften unschwer entnehmen kann, nicht um konkrete Elendsschilderungen, um Zustandsbeschreibungen der mannigfaltigen Lebenslagen, sondern um eine anthropologische Grundsatzbestimmung „des“ Menschen (vgl. dazu ausführlich McDonald 2013 und Fleischmann 2016). Ihm geht es um uns alle, wie gleich der Eingang seines Schreibens deutlich macht (EG 2): Ob wir nun arm sind oder reich, vor Jesus sind wir alle gleich – nämlich Sünder. Alles Übel kommt daher, wie es in „Laudato si“ heißt, dass „der Mensch sich selbst ins Zentrum stellt“ (LS 122).
Diese sündhafte Haltung, dass sich „der“ Mensch selbst zum Maß der Dinge macht, habe sich im modernen Wirtschaftsleben verbreitet und verfestigt. Dort stehe seit einiger Zeit das „technokratische Paradigma“ (LS 101) im Mittelpunkt. Die Herrschaft dieses Paradigmas habe zu der Misere geführt, die nun zu beklagen sei. Das soziale Grundproblem besteht demnach in der „Art und Weise, wie die Menschheit tatsächlich die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem homogenen und eindimensionalen Paradigma angenommen hat. Nach diesem Paradigma tritt eine Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf des logisch-rationalen Prozesses das außen liegende Objekt allmählich umfasst und es so besitzt. Dieses Subjekt entfaltet sich, indem es die wissenschaftliche Methode mit ihren Versuchen aufstellt, die schon explizit eine Technik des Besitzens, des Beherrschens und des Umgestaltens ist. Es ist, als ob das Subjekt sich dem Formlosen gegenüber befände, das seiner Manipulation völlig zur Verfügung steht. Es kam schon immer vor, dass der Mensch in die Natur eingegriffen hat. Aber für lange Zeit lag das Merkmal darin, zu begleiten, sich den von den Dingen selbst angebotenen Möglichkeiten zu fügen.“ (LS 106)
Das Schreiben spricht – der religiösen Logik folgend und dabei vielleicht einige Modifikationen gegenüber der Tradition anbringend (vgl. Fleischmann 2016) – vom Menschen überhaupt und von allen Menschen, denen es Gottes Willen nahebringen will. Das ist der höchste Abstraktionsgrad, den man sich vorstellen kann. Konkret wird das Schreiben hin und wieder, wenn es Beispiele bringt. Aber diese sollen wiederum symptomatisch für den Gesamtzustand der Welt sein. Eine detaillierte Bestandsaufnahme der Elendslagen auf dem Globus leistet der Text nicht, sie ist nicht beabsichtigt (und ihr Fehlen übrigens auch kein Defizit, denn dafür gibt es die Berichte von UN und anderen Institutionen, die die Enzyklika hinsichtlich der Umweltschäden immer wieder zitiert). Beim Blick auf die Weltwirtschaft werden verschiedenen Stände und Lebenslagen – Klassen kennt der Papst nicht – erwähnt, darunter die Armen und Ausgeschlossenen, denen das besondere Mitleid gilt. Aber genau so werden die Macher und Verantwortlichen mit warmen Worten bedacht. Nur zwei Beispiele. Das erste zur Welt der Politik: „Die in Misskredit gebrachte Politik ist eine sehr hohe Berufung, ist eine der wertvollsten Formen der Nächstenliebe, weil sie das Gemeinwohl anstrebt.“ (EG 205) Dasselbe gilt zweitens für die Unternehmer: „Die Tätigkeit eines Unternehmers ist eine edle Arbeit, vorausgesetzt, dass er sich von einer umfassenderen Bedeutung des Lebens hinterfragen lässt; das ermöglicht ihm, mit seinem Bemühen, die Güter dieser Welt zu mehren und für alle zugänglicher zu machen, wirklich dem Gemeinwohl zu dienen.“ (EG 203) Und bei den notwendigen Veränderungen ist für den Papst klar, dass die politische Klasse das Heft in der Hand behalten muss: „Es ist Sache der Politik und der verschiedenen Vereinigungen, sich um eine Sensibilisierung der Bevölkerung zu bemühen.“ (LS 214)
Franziskus nimmt also gerade die politisch-ökonomisch bestimmenden Akteure in Schutz, wenn und insofern sie sich, wie alle anderen Menschen auch, um die wahre christliche Gesinnung bemühen. Genau hier macht sich bemerkbar, dass der Papst, wie Segbers/Wiesgickl eingestehen und wie Huisken kritisiert, keine „Wirtschaftstheorie“ liefert. Daher muss man als Fazit festhalten: Die Zurückweisung marxistischer Überlegungen durch die beiden kritischen Theologen geht zielstrebig an der Sache vorbei und zeigt sich desinteressiert daran, den ins Auge gefassten Kapitalismus näher zu bestimmen. Das zweite Manko des Querschnitts durch die religiöse Kapitalismuskritik ist auf einer anderen Ebene angesiedelt. Es betrifft den von Segbers/Wiesgickl vorgestellten neuen kirchlichen Grundkonsens, der sich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise herauskristallisiert haben soll: die „große Ökumene“ des Antikapitalismus. Dieser Konsens bildet den Ausgangspunkt ihrer Schrift und wird im Weiteren mit zahlreichen Interpretationen, Beispielen, Dokumenten zu belegen versucht. Doch im Kontrast dazu erfährt der Leser schon in den ersten Texten, dass z.B. in den deutschen Kirchen – Stichwort: Ökumenische Sozialinitiative (vgl. Segbers 2014) – von einer solchen Wirtschaftskritik nichts zu spüren ist. Im Gegenteil, kirchliche Sozialethik gibt hier dem Dienst am Kapital, wenn er als sozial oder politisch „gestaltete Marktwirtschaft“ firmiert, wie gehabt ihren Segen. Der Theologe Jörg Rieger hält z.B. im Blick auf die USA und andere kapitalistische Staaten ausdrücklich fest: „Religion, wenn sie an die Öffentlichkeit tritt und dort diskutiert wird, ist heute meist ein konservatives Phänomen.“ (Segbers/Wiesgickl 2015a, 46) Ja, der Autor bescheinigt dieser systemerhaltenden, konservativen Religiosität sogar eine „Allgegenwärtigkeit“ (ebd., 47). Es mag sein, dass religiöse Kongresse andere Impulse geben – so wie eben die Statements, die das Buch versammelt. Doch die hier proklamierte universelle Absage an „Logik und Praxis des Kapitalismus“ bleibt ein eher imaginäres Gebilde.
Kritischer Katholizismus?
Eine genuin katholische Publikation haben die beiden Sozialethiker Bernhard Emunds und Hans Günter Hockerts im Sommer 2015 vorgelegt: „Den Kapitalismus bändigen“ – gewidmet der Erinnerung an das Wirken des berühmten Sozialethikers Oswald von Nell-Breuning SJ (1890-1991). Eins fällt hier sofort auf: Es gibt keine einzige Erwähnung der wirtschaftskritischen Äußerungen von Papst Franziskus, der bei Segbers und Wiesgickl als die entscheidende Bezugsgröße kirchlicher Kapitalismuskritik figuriert. Diese Distanz – ob nun gewollt oder nicht – ließe sich begründen, denn in den beiden päpstlichen Schriften „Evangelii gaudium“ und „Laudato si“ ist, wie erwähnt, vom „Kapitalismus“ nicht die Rede. Und das ist nur konsequent, denn Franziskus setzt ja beim Konsum an und rückt den Ausschluss der Mehrheit der Weltbevölkerung von den heute gegeben Konsummöglichkeiten in den Mittelpunkt. Das Produktionsverhältnis wird bei ihm, wie dargelegt, ausgeblendet. Letzteres macht einen markanten Unterschied zu Nell-Breuning aus, wie der Sammelband von Emunds und Hockerts in Erinnerung ruft. Das Buch will den Altmeister, den „Nestor“ der katholischen Soziallehre würdigen, ohne am „Mythos Nell-Breuning“ (Emunds/Hockerts 2015, 11) weiterzustricken. Das Unterfangen, an dem sich vornehmlich Autoren aus Sozialwissenschaften und Sozialethik beteiligt haben, zeugt in der Tat von intellektueller Redlichkeit und einem Interesse an Entmythologisierung. Es gesteht gleich eingangs ein, dass Nell-Breuning als Soziallehrer einer kardinalen Täuschung erlegen ist, dass er nämlich mit seiner Erklärung die soziale Welt verfehlt hat. Nach seinen noch wirtschaftsfreundlichen Anfängen als Ethiker einer „Börsenmoral“ (siehe seine Schrift von 1928) wurde, wie ein Fachmann schreibt (Große Kracht, in: Emunds/Hockerts 2015, 27), die Aufgabe „Den Kapitalismus im Kapitalismus überwinden“ zu seinem Lebensthema. Dazu bilanzierte Nell-Breuning 1960: „Unsere Sozialpolitik mag in vielen Stücken unvollkommen sein, was sie aber geleistet hat in Bändigung und Zähmung dieses wie ein wildgewordener Elefant dahin stürmenden Liberalkapitalismus, ist eine ungeheure Leistung“ (ebd., 12).
Die Herausgeber kennzeichnen dies – speziell nach den Krisenerfahrungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts – als Illusion; und sie stehen auch nicht an, die meisten sozial- und wirtschaftspolitischen Ideen Nell-Breunings als veraltet oder unbrauchbar einzustufen. Dabei gibt es allerdings in ihrem Sammelband unterschiedliche Blickwinkel. Während etwa die Herausgeber einleitend darauf aufmerksam machen, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Problemlage (erstens durch Finanzialisierung, zweitens durch Globalisierung und drittens) durch die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses bestimmt sei, durch die Zunahme „atypischer“, „prekärer“ Arbeitsverhältnisse, durch die Ausbreitung eines Niedriglohnsektors – dem nur mit Hilfe einer Mindestlohngesetzgebung wieder ein zweifelhafter Ordnungsrahmen verpasst wird –, hält der Sozialethiker Arnd Küppers die Sozialpartnerschaft im Rahmen der Tarifautonomie als Erfolgsgeschichte der bundesdeutschen Marktwirtschaft hoch. „Zumindest einstweilen“ (Küppers, in: ebd., 176) sei diese wohlgeordnete Partnerschaft, die im 20. Jahrhundert immer wieder durch den Klassenkampf von oben in Frage gestellt wurde, von Unternehmern bzw. unternehmerfreundlicher Politik anerkannt und könne sich so als „komplexes ordnungspolitisches Instrument des Interessenausgleichs“ (Küppers, in: ebd., 177) bewähren. Bleibt die Frage, worin die Aktualität Nell-Breunings bestehen soll. Die Auskunft, die das Buch gibt, lässt sich etwa so zusammenfassen: Es ist die analytische Leistung, mit der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Wirtschaftsweise und die daraus folgende Konstituierung einer Klassengesellschaft auf den Begriff gebracht oder zumindest in den Blick genommen wurden. Die Leistung ist dabei nicht ganz einfach zu bestimmen, denn Nell-Breuning hat ja keine abgeschlossene Theorie hinterlassen. Sein intellektueller Werdegang war vielmehr durch den Versuch geprägt, auf der einen Seite den Kapitaleinsatz als eine unumgängliche, progressive wirtschaftliche Methode zu rechtfertigen, um auf der anderen Seite die gesellschaftliche Wirkung, dass eine Klasse die andere in Dienst nimmt und so ein Herrschaftsverhältnis aufrecht erhält, zu kritisieren sowie durch gesellschaftspolitische Initiativen (Vermögensbildung, Mitbestimmung, Reform der Unternehmensverfassung) zu ihrer Überwindung beizutragen.
Der Kapitalismus erscheint also gewissermaßen doppelt, als ökonomischer Fortschritt und gesellschaftlicher Rückschritt. Der einleitende Beitrag von Hermann-Josef Große Kracht macht dieses Problem, mit dem sich Nell-Breuning sein Leben lang beschäftigte, in prägnanter Weise deutlich. Er verweist zudem darauf, dass der prominente Soziallehrer der Adenauerära, auch wenn er sich in puncto Bändigungsmöglichkeit und -erfolg täuschte, stets auf Distanz zu der beschönigenden westdeutschen Formel von der „sozialen Marktwirtschaft“ blieb. Nell-Breuning sprach statt dessen, im Anschluss an den Nationalökonomen Götz Briefs, vom „sozial temperierten Kapitalismus“ (Große Kracht in: ebd., 38). So weit war ihm nämlich der Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise, der Gegensatz von Kapital und Arbeit, bewusst und er machte, z.B. als Autor der Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“, auf dieses Problem – gegen harmonistisch verklärende Fortschrittsvisionen oder reaktionär-berufsständische Ideen, die im deutschen Sozialkatholizismus auch stark vertreten waren – nachdrücklich aufmerksam.
Wie soll man nun an dieses theoretische Erbe anknüpfen? Eine Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist und mit der sich Emunds/Hockerts selber schwer tun. Ihr Band ist nach dem Prinzip der Gegenüberstellung von zwei Positionen entlang von Nell-Breunings Hauptthemen gegliedert. Das ist gleich beim ersten Thema der Kapitalismuskritik instruktiv, wo das Koreferat zum Beitrag des Sozialethikers Große Kracht von dem Soziologen Berthold Vogel stammt. Hier erfährt man, wie die moderne soziologische Betrachtungsweise die analytische Stringenz, die in der älteren Soziallehre teilweise noch anzutreffen war, in eine postmoderne Beliebigkeit auflöst. Heute sind überlieferte Theorien anscheinend nur noch dazu da, interessante Stichworte zu liefern, um neue Diskurse zu generieren. Ob das Vorhaben, den Kapitalismus zu bändigen, widersinnig und praktisch widersprüchlich ist oder ob man die Sache mit neuem Elan und neuen Methoden angehen soll, erfährt man in dem soziologischen Koreferat jedenfalls nicht. Wenn wirklich das Interesse besteht, das sozialkritische Denken Nell-Breunings wieder zugänglich zu machen, und wenn im Rückblick die Schwäche der Bändigungstheorie deutlich wird, müsste alle Anstrengung darauf zielen, eine konsistente Sozialtheorie der modernen Ökonomie zu entwickeln – wozu man vielleicht einmal bei Marx nachschlagen sollte, was von dessen Theorie zu übernehmen oder zu lernen ist. Das macht, von Randerscheinungen abgesehen, die moderne katholische Soziallehre aber nicht.
Ist das Antikapitalismus?
Das, was der Bergoglio-Papst bisher verlautbart hat, geht jedenfalls nicht in diese Richtung. Wenn er sich z.B. programmatisch zum Sozialismus oder Marxismus äußert, steht er ganz in der Tradition des kirchlichen Antikommunismus eines Wojtyla oder Ratzinger. Bei seinem Kuba-Aufenthalt im September 2015 begrüßte Franziskus die Annäherung des Landes an die kapitalistischen USA und erinnerte daran, dass „ebendies auch der Wunsch des heiligen Johannes Paul II. (war) mit seinem brennenden Aufruf: 'Möge Kuba sich mit all seinen großartigen Möglichkeiten der Welt öffnen und möge die Welt sich Kuba öffnen!'“ (Papstworte bei der Begrüßungszeremonie, Papst Franziskus 2015). Wie beim Ende des Ostblocks geht es also darum, dass sich alle Länder der kapitalistischen Weltwirtschaft öffnen und ihre Abschottung aufgeben. Radio Vatikan fasste die Hauptrede auf dem Platz der Revolution so zusammen: „Papst Franziskus hat im kommunistischen Kuba Cliquenwirtschaft und elitäres Verhalten verurteilt. Mancher missbrauche seinen Dienst für die Gesellschaft, um im Namen des Allgemeinwohls die eigenen Leute zu begünstigen“ (ebd.). „Spiegel-online“ meldete (20.9.2015 ): „Papst Franziskus hat bei seinem Besuch im kommunistischen Kuba Ideologien als falschen Weg bezeichnet und mehr religiöse Freiheiten gefordert. Der Dienst am Menschen dürfe niemals ideologisch sein, sagte er bei einer Messe vor Hunderttausenden Menschen auf dem Revolutionsplatz in Havanna. 'Denn man dient nicht Ideen, sondern man dient den Menschen.'“
Mit dem Wort „Ideologie“ wird gleich klargestellt, was gemeint ist: der gottlose Sozialismus/Kommunismus. Und wenn der Papst bei seinem nächsten Zwischenstopp in Havanna im Februar 2016 – anlässlich der Begegnung mit dem Patriarchen Kyrill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche – „dem großartigen kubanischen Volk“ und sogar dem kubanischen Präsidenten Raúl Castro seine Anerkennung ausspricht, so gilt das vor allem der neuen Annäherung des Landes an die USA und der Hoffnung auf eine Evangelisierung der Welt. „Wenn es so weitergeht“, erklärte der Papst in Havanna, „wird Kuba die Hauptstadt der Einheit sein“ (Junge Welt, 15.2.2016), nämlich der Einheit der Christenheit unter katholischer Führung. Beide Kirchenführer waren sich auch noch in der Verurteilung des „zügellosen Konsums“ einig und warnten in einer gemeinsamen Erklärung: „Die wachsende Ungleichheit in der Verteilung der irdischen Güter erhöht den Eindruck von Ungerechtigkeit im Hinblick auf das … System der internationalen Beziehungen“ (ebd.). Zurückhaltender kann man den Eindruck, dass in den sozialen Beziehungen etwas schief läuft, kaum zum Ausdruck bringen. Aber der Papst kann auch heftig werden. „Mexiko erlebt einen zornigen Papst“ (General Anzeiger, 19.2.2016), hieß die Schlagzeile zum nachfolgenden Besuch in Ciudad Juárez, wo der Papst die Jugend Lateinamerikas zu einem gottgefälligen Lebenswandel aufrief. Grund für den Zorn des Pontifex gab übrigens ein junger Mann, der ihn an der Soutane gezupft hatte, so dass er ins Stolpern geriet. „So zornig hat man Jorge Bergoglio selten erlebt“, kommentierte ein mitreisender Journalist, der gleichzeitig von einem Treffen mit Arbeitern berichtete, wo „Franziskus seine Kapitalismuskritik“ mit den vornehm mahnenden Worten wiederholt habe: „Der Fluss des Kapitals darf nicht den Fluss und das Leben der Menschheit bestimmen“ (ebd.).
Wenn der Papst grundsätzlich wird, so in seiner letzten Enzyklika „Laudato si“, liefert er natürlich die obligatorische Verurteilung des Kommunismus – also der bekannten Alternative zum Kapitalismus. Der Kommunismus wird von Franziskus, ganz selbstverständlich, in einem Atemzug mit dem Nationalsozialismus genannt: „Nie hatte die Menschheit so viel Macht über sich selbst, und nichts kann garantieren, dass sie diese gut gebrauchen wird, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Weise sie sich gerade jetzt ihrer bedient. Es genügt, an die Atombomben zu erinnern, die mitten im 20. Jahrhundert abgeworfen wurden, sowie an den großen technologischen Aufwand, den der Nationalsozialismus, der Kommunismus und andere totalitäre Regime zur Vernichtung von Millionen von Menschen betrieben haben“ (LS 104). Das ist schon ein starkes Stück, die Judenvernichtung, auf die hier offensichtlich angespielt wird, zum Paradigma der aus der Humanitas ausgegrenzten Regime zu erheben und dabei den ehemaligen Ostblock (wahrscheinlich auch die VR China) mit einzuschließen! Und ein solches Bekenntnis zum Westblock samt seiner wirtschaftlichen Räson soll „dem Kapital an die Wurzel“ gehen (so Füssel/Ramminger 2013), also eine radikale Verurteilung des global in Kraft gesetzten und gehaltenen Kapitalismus bedeuten?
Dass der Papst – wie einst der Ordensgründer Franziskus oder der Bußprediger Savonarola – bei den Mächtigen dieser Welt gelegentlich aneckt, kann man nicht bestreiten. So führte ihn seine erste Reise 2013 nach Lampedusa, wo er das EU-Abschreckungsregime als eine einzige Sünde geißelte, und zwar von uns allen, von dir und mir, vom kleinen Mann und vom politisch Verantwortlichen gleichermaßen. Dieses Anecken zielt darauf, dass wir alle in uns gehen und über unsere „Kultur der Gleichgültigkeit“ erschrecken. Jeder hat sich wegen seines Egoismus zu prüfen und anzuklagen. Und so weit hat die politische Öffentlichkeit die päpstliche Moralpredigt ja auch gutgeheißen – damit gleichzeitig klar gemacht, wohin die Predigt gehört, nämlich in die Gewissenserforschung angesichts einer Welt, die ein Jammertal ist und kein Paradies sein kann. Damit hat die Öffentlichkeit eine beachtliche Lektion übers moralische Klagewesen erteilt: „Die Affirmation der beklagten politischen Realität, an der sich nun einmal nichts ändern lässt, wird hier ergänzt durch die Wahrheit über die Moral: Sie ist kein ernst zu nehmender Einspruch gegen irgendwelche 'Missstände' und ihre Gründe, sondern gehört in den Gewissenshaushalt der Erdenbürger und des öffentlichen Diskurses als gute 'menschliche' Haltung, die man zu und neben den praktisch gültigen politischen Interessen pflegt, die als 'persönliche Einstellung' Hochachtung verdient, aber niemals als wirkliche Leitlinie politischen Handelns missverstanden werden darf. Um dessen Bereicherung hat sich der Papst verdient gemacht…“ (Decker 2013, 18).
Analoges gilt für den Angriff auf die moderne globalisierte Marktwirtschaft, den der Papst sich mit seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ einige Monate später leistete. Gegen die skandalösen Resultate des „herrschenden Wirtschaftssystems“ – vor allem in der Dritten Welt – und gegen die schönfärberischen Ideologien legte er heftigen Einspruch ein, wobei auch der berühmte Satz fiel: „Diese Wirtschaft tötet“ (EG 53). In diesem Fall war die politische Öffentlichkeit – gelinde gesagt – wenig begeistert. In Deutschland mühte sich z.B. der Qualitätsjournalismus damit ab, diese Anklagen als moralischen Weckruf zu würdigen, der auf keinen Fall als Antikapitalismus interpretiert oder gutgeheißen werden dürfte. Dafür mussten wieder Interpretationskunststücke vorgenommen werden, um die (An-)Klagen weichzuspülen. Was man dem Kirchenmann demgegenüber zugute halten kann, ist seine Entschiedenheit, das Elend der Welt beim Namen zu nennen und nicht die übliche Rhetorik von den Licht- und Schattenseiten der Globalisierung anzustimmen. Doch muss man auch hier festhalten, dass den Papst mehr umtreibt als das Elend und dessen systematische Ursachen. Er beklagt die flächendeckende Gleichgültigkeit der Menschen dieser Lage gegenüber. Und „mit dem kleinen Themenwechsel ist er bei seinem eigentlichen hauptberuflichen Anliegen: der moralischen Gesinnung der Menschheit… Hilfe für die Armen, 'uneigennützige Solidarität', eine 'Ethik zugunsten des Menschen': Wenn die menschliche Gesellschaft ein einziger Ruf nach tätiger Nächstenliebe ist, dann produziert ihre Ökonomie offenbar lauter Not. Nur dann erwächst das unsinnige Bedürfnis, die Verhältnisse um eine ihrem Wirken entgegengesetzte Tugendleistung ihrer Insassen zu ergänzen, die wie selbstverständlich von laufend produzierter Armut ausgeht. Aber nicht zuletzt dafür gibt es ja Religion, und dazu ist ein religiöser Führer da: Um den billigen Idealismus, den die Welt der kapitalistischen Sachzwänge sich gönnt, in den Rang eines Höchstwerts zu erheben, dessen Verehrung alle realen Übel zwar nicht wirklich korrigiert, aber ziemlich bedeutungslos erscheinen lässt.“ (Decker 2014, 16, 18)
Literatur
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Papst prangert die Indolenz der Welt gegenüber dem Flüchtlingselend an: Klarstellungen der Öffentlichkeit zum Verhältnis von Politik und Moral. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2013, S. 17-18.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Viel Kopfschütteln unter den journalistischen Spin-Doctors unseres Wirtschaftssystems: Papst verdammt Kapitalismus! In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2014, S. 15-23.
- Bernhard Emunds/Hans Günter Hockerts (Hrsg.), Den Kapitalismus bändigen – Oswald von Nell-Breunings Impulse für die Sozialpolitik. Paderborn 2015.
- EG – Evangelii gaudium, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013 (zit. als EG nach den Nummern der Abschnitte).
- Christoph Fleischmann, Der grüne Papst und der Irrweg des käuflichen Glücks. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 1, 2016, S. 104-111.
- Kuno Füssel/Michael Ramminger, Dem Kapital an die Wurzel. In: Junge Welt, 28./29.12.2013, S. 10-11.
- Freerk Huisken, Der Papst als Kapitalismuskritiker: Unfehlbar? In: www.magazin-auswege.de, 24.1.2014.
- KAB – Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands (Hrsg.), Texte zur katholischen Soziallehre – Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln 1975.
- LS – Laudato si. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 202, Bonn 2015 (zit. als LS nach den Nummern der Abschnitte).
- Geoffrey McDonald, New Pope, Old Doctrine. In: Counterpunch, 25.12.2013, online: www.counterpunch.org.
- Papst Franziskus, Reisen/Zum Nachlesen: Alle Papstreden in Kuba und den USA. 2015. Im Internet: http://de.radiovaticana.va/news/2015/09/26.
- Frank Schirrmacher, Ego – Das Spiel des Lebens. München 2013.
- Segbers, Franz, Die Agenda 2010 als Kirchen-Agenda. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 4, 2014, S. 27-30.
- Franz Segbers/Simon Wiesgickl (Hrsg.), „Diese Wirtschaft tötet“ (Papst Franziskus) – Kirchen gemeinsam gegen Kapitalismus. Hamburg 2015a.
- Franz Segbers/Simon Wiesgickl, „Diese Wirtschaft tötet“ – Über eine verdrängte und verschwiegene Übereinstimmung der Kirchen. In: Sozialismus, Nr. 7-8, 2015b, S. 2-6. Im Internet: www.sozialismus.de.