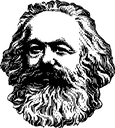Inhaltsverzeichnis
Textbeiträge 2015
An dieser Stelle veröffentlichen wir Texte, Debattenbeiträge und Buchkritiken.
Dezember 2015
Stichwort: Gerechtigkeit
Im Dezember 2015 ist die Ausgabe 4/15 der Politischen Vierteljahresschrift „Gegenstandpunkt“ erschienen, die u.a. eine ausführliche Auseinandersetzung mit der – vor allem von kritisch gesinnten Menschen ins Spiel gebrachten bzw. vermissten – Gerechtigkeit enthält. Dazu ein Hinweis von Gegeninformation Köln.
Gegeninformation Köln führte im Dezember 2015 eine Diskussionsreihe zu der Fragestellung „Wer verdient warum wie viel?“ durch. Die Grundthese lautete: Die kritisch gemeinte Frage nach dem gerechten Verhältnis von Einkommenshöhe und Leistung führt in die Irre, denn sie sieht bzw. lenkt einerseits ab von der Frage nach der Tauglichkeit des Einkommens für den Lebensunterhalt der arbeitenden Menschheit und andererseits von der Kenntnisnahme der Leistungserbringung bzw. der wirklichen Gründe für die Einkommensunterschiede. Ein aktueller Vortrag zum selben Thema (Universität Bielefeld, 12. November 2015) von Prof. Margaret Wirth ist jetzt im Netz dokumentiert (http://www.argudiss.de/node/350).
Ausgangspunkt des Vortrags waren Klagen und Forderungen wie „Leistung soll sich lohnen“ oder „Meine Arbeit ist mehr wert“, wie sie hierzulande – nicht nur in Tarifkämpfen – allgegenwärtig sind. Sie gehen ganz selbstverständlich von der Grundannahme aus, dass es, was immer jemand in seinem Job zu tun hat, wie wenig oder viel er da verdienen mag, auf jeden Fall nur dann mit rechten Dingen zugeht, wenn sich die Höhe des Einkommens aus der im Job erbrachten Leistung rechtfertigt oder rechtfertigen lässt. Dieser Grundüberzeugung verdankt die Marktwirtschaft ja sogar den Ehrentitel, eine „Leistungsgesellschaft“ zu sein – ganz im Unterschied zu jenen unguten Wirtschaftsformen, wo Gleichmacherei, Pfründenwirtschaft oder ähnliche Misswirtschaft herrscht. Bemerkenswert ist das schon deshalb, weil zugleich jede Menge Zweifel unterwegs ist, ob sich die tatsächlich vorfindliche Einkommensverteilung überhaupt nach diesem Kriterium richtet, es also wirklich leistungsgerecht zugeht. So werden kreuz und quer Einkommen und Leistungen verglichen und jede Menge Unstimmigkeiten entdeckt: Kann es denn sein, dass ein Fußballspieler oder Banker, die jährlich Millionen kassieren, hundertmal mehr leisten als ein Facharbeiter? Die Öffentlichkeit versorgt das Publikum regelmäßig mit Beiträgen zu dieser Frage und wartet mit Beispielen auf, die daran zweifeln lassen. Auch die Gewerkschaften mischen sich hier ein: Die IG Metall rechnet vor, dass ein Metallarbeiter 333 Jahre arbeiten müsste, um auf das Jahresgehalt des VW-Vorstandschefs Winterkorn zu kommen. Fazit: Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen!
Was heißt hier gerecht?
Die Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ hat diese populäre Kritik immer wieder zum Thema gemacht, so zum Beispiel am Fall des Entgeltrahmentarifabkommens (ERA), mit dem die IG Metall zu Beginn des 21. Jahrhunderts endlich den Standpunkt gerechter Vergütung im komplizierten deutschen Lohngefüge verankern wollte. Das seit den 1970er Jahren angestrebte Jahrhundert-Projekt der Gewerkschaft, die „willkürliche“ und „sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung“ der Tarife nach Arbeitern und Angestellten zu revidieren, kam nach zähem, beinahe dreißig Jahre währendem Ringen – und unter der Zusage an die Arbeitgeber, das Ganze im Blick auf die Gesamtlohnsumme „kostenneutral“ abzuwickeln – mit dem neuen ERA zu einem Abschluss (vgl. Held 2007). Statt des bisherigen „Zweiklassensystems“ mit Gehaltsklassen für Angestellte auf der einen Seite und Lohngruppen für Arbeiter auf der anderen Seite gibt es seitdem einheitliche Entgeltstufen für alle Mitarbeiter, die dafür sorgen sollen, dass Arbeit und Leistung nach zeitgemäßen Kriterien bewertet und bezahlt werden.
Die Tarifspezialisten der IG-Metall unter der Ägide des späteren Gewerkschaftschefs Berthold Huber tüftelten dafür ein neues hochkomplexes System aus, das aus Gewerkschaftsperspektive „nichts weniger als eine Revolution“ (Tietz 2007) darstellen sollte. Die Tarifvertragsparteien nahmen damit Abschied von dem über hundert Jahre alten System, wonach Angestellte und gewerbliche Mitarbeiter unterschiedlich bezahlt werden – „obwohl die Tätigkeitsbereiche häufig ähnlich sind, gibt es beim Einkommen zum Teil Unterschiede von bis zu tausend Euro“ (ebd.) – und beglückwünschten sich zur Einführung „einer total gerechten Einklassen-Lohnhierachie“ (Held 2007, 70). Die Analyse des „Gegenstandpunkts“ legte dagegen Nachdruck auf den Punkt, dass mit der Behebung des Gerechtigkeitsdefizits eine breite Lohnsenkungsoffensive einherging. Von der Öffentlichkeit wurde das Unterfangen – nach dem Motto „gute Idee“ bzw. gute „Papierlage“ wie es im Jargon der Gewerkschaften heißt (Ulbrich 2015, 28), aber leider mit negativen, weil einkommensmindernden Nebenwirkungen behaftet – als leicht widersprüchlich wahrgenommen: „Die schlichte Formel: Je komplexer die Aufgabe, desto besser die Bezahlung. Doch mitten im Prozess der ERA-Einführung scheint sich das Gutgemeinte ins Gegenteil zu verkehren.“ (Tietz 2007)
Für die Gewerkschaft stellte sich mit der Herstellung von Gerechtigkeit also gleich die nächste Herausforderung, neue Anschläge der Arbeitgeberseite auf das Gerechtigkeitsprinzip abzuwehren – und durch eine quälende Frage wurde „lange Zeit die Diskussion bestimmt: Haben wir jetzt was ganz Tolles gemacht oder war es doch eher ein Flop?“ (Ulbrich 2015, 28) Doch die politische Sekretärin beim Vorstand der IG Metall war sich beim Eqal Pay Day 2015, wo wieder einmal schreiende Ungerechtigkeit in Entlohnungsfragen beklagt wurde, sicher über den Erfolg des gewerkschaftlichen Jahrhundertwerks: „Inzwischen wissen wir: Unsere Entscheidung war richtig.“ (Ebd.) Wie das System der Einsortierung in Lohngruppen oder Entgeltstufen den Arbeitgebern dazu dient, eine Kostensenkung bei ihrer Belegschaft durchzuführen bzw. zu legitimieren, ist ausführlich Thema in dem Vortrag der Politikwissenschaftlerin Wirth. Der „Gegenstandpunkt“ hat dazu jetzt in seiner aktuellen Ausgabe ein „Stichwort: Gerechtigkeit“ beigesteuert, dass eine grundsätzliche Kritik an dem allseits geachteten Prinzip der Gerechtigkeit liefert.
„Dass statt der Gewalt Recht und Gerechtigkeit herrsche, und zwar stets und überall, dass zu diesem Zweck öffentliche Gewalten eingerichtet und demokratisch organisiert werden“, halten einschlägige Experten wie der politische Philosoph Otfried Höffe für schlüssig, ja „sogar für moralisch geboten“ (Höffe 2002, 25). Hier habe man das „universale Rechts- und Staatsgebot“ zur Hand, das mit Frieden und Wohlstand einhergehe, „auf dass sich ein uralter Traum der Menschheit verwirkliche“ (ebd.). Das Stichwort des „Gegenstandpunkts“ macht sich jetzt die Mühe, diesem uralten Traum hinterherzusteigen – keine unbedingt leichte Lektüre, aber ein Text, der den Aufwand lohnt. Als erstes wird hier das Gerechtigkeitsprinzip als Maxime herrschaftlicher Gewalt überhaupt aufgenommen und analysiert – also jenseits der speziellen bürgerlichen Verhältnisse thematisiert. In diesen – das behandelt das zweite Kapitel – wird mit dem Tausch, dem „do ut des“ (ich gebe, damit du gibst), also der gerechten Entsprechung von Leistung und Gegenleistung, die moderne Fassung des Prinzips zum elementaren „Ethos der bürgerlichen Gesellschaft“ (Decker 2015, 51). Hier findet dann auch in einem Abschnitt die Leistungsgerechtigkeit bei der Lohnfrage ihren Platz.
Doch geht die Analyse des „Gegenstandpunkts“ über diesen Bereich weit hinaus. Das dritte Kapitel greift Gerechtigkeit als Maßstab politisierter Kritik auf, untersucht also ihre Rolle als Berufungsinstanz für jedwede gesellschaftliche Unzufriedenheit, ob sie sich nun im politischen Betrieb, bei der Interessenvertretung oder in der (kritischen) Öffentlichkeit zu Wort meldet. Das verlängert das vierte Kapitel in den Bereich „zwischenmenschlicher Gemeinheiten“, denn auch hier habe der Standpunkt der Gerechtigkeit Einzug gehalten und „macht aus der Privatsphäre eine Sache des gerechten Tauschs“ (ebd., 59). Das ist aber noch nicht das Ende, ein fünftes und letztes Kapitel thematisiert das „letzte Dokument der Unwahrheit, durch das Recht wäre ein Entsprechungsverhältnis geregelt – die höhere Gerechtigkeit“ (ebd., 60). So wird am Schluss auch noch die Überhöhung gewürdigt, wie sie etwa für den christdemokratischen Gerechtigkeitsexperten Norbert Blüm selbstverständlich ist: „Das Streben nach Gerechtigkeit entspringt dem Heimweh nach dem Paradies.“ (Blüm 2006, 31)
Literatur
- Nobert Blüm, Gerechtigkeit – Eine Kritik des Homo oeconomicus. Freiburg u.a. 2006.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Stichwort Gerechtigkeit. In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2015, S. 47-60.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Das Entgeltrahmentarifabkommen (ERA): Noch eine prima Gelegenheit zur Lohndrückerei – sowie für ein gewerkschaftssinnstiftendes Aktionsprogramm erster Güte. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2007, S. 69-72.
- Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. Aktualisierte und überarbeitete Neuausgabe, München 2002.
- Janko Tietz, Gewerkschaften: 4,1 Prozent minus x. In: Der Spiegel, Nr. 22, 2007.
- Gabriele Ulbrich, Das Entgeltrahmentarifabkommen der IG Metall (ERA). In: Equal Pay Day 20. März 2015 – Transparenz. Spiel Mit Offenen Karten. Was verdienen Frauen und Männer? Berlin 2015, S. 26-28.
Weiteres vom TTIP-Protest
Die Protestbewegung gegen TTIP, das Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen, hat sich mit ihrer Demo vom Herbst 2015 als unübersehbarer Massenprotest in Stellung gebracht. Zu ihrer Opposition gegen die neueste Freihandelsinitiative hier ein Kommentar von Johannes Schillo.
Die EU-Kommission führt derzeit mit den Vereinigten Staaten Verhandlungen über das TTIP-Abkommen, um Zölle und andere Barrieren im transatlantischen Handel abzubauen. Offizielles Ziel ist eine stärkere Öffnung der Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks, mit im Paket sind die Verringerung von Einschränkungen für kommerzielle Dienstleistungen, die Vereinfachung des Zugangs zu öffentlichen Aufträgen auf allen staatlichen Ebenen oder die Verbesserung von Investitionssicherheit und Wettbewerbsgleichheit (zum politökonomischen Inhalt des projektierten Abkommens siehe Decker 2014). Die Regierungen der EU-Mitglieder erteilten im Juni 2013 der EU-Kommission das Mandat für die Verhandlungen, die sich über Jahre hinziehen können. Ursprünglich gab es den Plan, das Abkommen 2016 vertraglich abzuschließen. Dies gilt jedoch inzwischen als unrealistisch.
Wenn die 24 Kapitel des Vertrags ausverhandelt sind, soll der Gesamttext veröffentlicht werden. Verhandlungstexte oder Positionspapiere werden neuerdings auf der Website der EU-Kommission (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/) veröffentlicht; über den Stand der Verhandlungen berichtet auch die Website des deutschen Wirtschaftsministeriums (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Frei…). Sobald der gesamte Verhandlungstext rechtlich geprüft ist, soll er, so die bisherige Planung, an das Europäische Parlament und die 28 Regierungsvertreter übermittelt werden. Diese müssen TTIP dann ratifizieren. Ob auch alle 28 nationalen Parlamente zustimmen müssen, ist zur Zeit noch ungeklärt. Im September 2015 wurde zunächst die elfte Verhandlungsrunde beendet, eine zwölfte Runde ist für Anfang 2016 geplant. Wahrscheinlich werden die Verhandlungen dann erst 2017 oder 2019 abgeschlossen – wobei auch ein gänzliches Scheitern nicht ausgeschlossen ist.
Zum Herbst 2015 wurde in den TTIP-Verhandlungen ein neuer Akzent gesetzt (vgl. den IVA-Blogeintrag „Der Protest gegen TTIP“). Die Europäische Kommission hatte auf Bedenken europäischer Politiker reagiert und sich „für eine grundlegende Reform der umstrittenen Schiedsgerichte für Investoren“ ausgesprochen (FAZ, 17.9.2015). Die zuständige EU-Handels-Kommissarin Cecilia Malmström hatte dazu ein neues Schiedsgerichtssystem vorgeschlagen, und zwar in Form eines eigenen Investitionsgerichtshofs. Am 12. November 2015 legte die EU-Kommission die endgültige Fassung dieses Vorschlag vor und übermittelte ihn förmlich der amerikanischen Seite. Der Verhandlungsvorschlag, dessen Wortlaut auf der EU-Website steht (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?i…), zielt auf „safeguarding the right to regulate and create a court-like system with an appeal mechanism based on clearly defined rules, with qualified judges and transparent proceedings. The proposal also includes additional improvements on access to the new system by small and medium sized companies. The new system would replace the existing investor-to-state dispute settlement (ISDS) mechanism in TTIP and in all ongoing and future EU trade and investment negotiations.“ Ob und wie dieser Vorschlag eines court-like systems von der US-Seite aufgegriffen wird, bleibt abzuwarten.
Die Protestbewegung steht dem neuen Vorschlag der EU-Handelskommissarin skeptisch bis ablehnend gegenüber. Aus Sicht von ATTAC löst das Konzept eines eigenen Gerichtshofs im Rahmen des Abkommens keins der grundlegenden Probleme. „Legitime Allgemeininteressen werden weiterhin den Profitinteressen von Investoren untergeordnet, eine richterliche Unabhängigkeit ist nicht gewährleistet“, stellte Roland Süß vom ATTAC-Koordinierungskreis fest (http://www.attac.de, 13.11.15). Und weiter: „Malmströms Pinselstriche können die Fehlkonstruktion der Klagerechte für Konzerne nicht übertünchen. Auch mit einem reformierten Investitionsgerichtshof sind Gesetze im Interesse der Allgemeinheit in Gefahr. Die Bestimmungen, nach denen geurteilt wird, bleiben die gleichen. Die vorgesehene faire und gerechte Behandlung und die weite Definition von Enteignung und Investition räumt ausländischen Investoren weiterhin Eigentumsrechte ein, die weit über das hinausgehen, was in nationalen Verfassungen oder im Europarecht vorgesehen ist. Derart weitreichende Entschädigungsmöglichkeiten für entgangene Gewinne oder Gewinnerwartungen bietet nur der Investitionsschutz.“ Aus dem ATTAC-Koordinierungskreis hieß es abschließend: „Die bestehenden Rechtssysteme in den USA und in Europa bieten ausreichenden Schutz für Investoren. Es bleibt dabei: Konzernklagerechte sind nicht reformierbar, grundsätzlich nicht notwendig und brandgefährlich. Ihr einziger Zweck ist es, Investoren die Möglichkeit zu geben, sich gegen einen legitimen demokratischen Politikwechsel abzusichern.“
Was den Protest bewegt
In Deutschland hat sich gegen TTIP eine – verglichen mit anderen Fällen – große Protestbewegung herausgebildet, die von braven Sozialdemokraten bis ins linksradikale Lager reicht. Zu den gemäßigten Kritikern zählt etwa der Bestsellerautor und Foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode („Die Freihandelslüge“), der „von der Idee des fairen Handels, der allen Beteiligten Vorteile bietet,“ (Bode 2015, 8) im Prinzip überzeugt ist, in den konkreten Verhandlungen aber eine Fehlentwicklung sieht. Verstärkung hat er jetzt von der Wirtschaftsredakteurin der „Zeit“, Petra Pinzler, erhalten, die im November 2015 das Buch „Der Unfreihandel“ (2015a) vorlegte. Auch sie hält die Marktwirtschaft und den dazugehörigen grenzüberschreitenden Handel und Wandel im Prinzip für eine gute Sache, kennt aber viele Beispiele, wo es schief läuft. Dieser Fall sei jetzt bei den TTIP-Verhandlungen eingetreten. Das hat die Wirtschaftsjournalistin erstens am Verfahren entdeckt, speziell an der Geheimhaltung, die die Startphase kennzeichnete: „Das Verfahren, durch das solche Abkommen derzeit zustande kommen, ist einer erwachsenen demokratischen Gesellschaft einfach nicht würdig.“ (Pinzler 2014) Zweitens befürchtet sie eine „Privatisierung der Welt“ (Pinzler 2015a, 76), insbesondere einen Demokratieabbau durch die Einführung privater Schiedsgerichte.
Wenn die Politik jedoch ihre Gestaltungsmacht wieder gewänne, ließen sich solchen Expertisen zufolge aus einem weltweit vereinbarten Freihandel für alle Seiten und nicht nur für „die größten Konzerne der Welt“ (ebd., 262) Vorteile ziehen. „Dabei könnte TTIP vergleichsweise leicht zum Modellvertrag werden, denn beiden Partnern sollte es nicht schwer fallen, ein paar dieser Ideen (= die von ATTAC u.a. ausgearbeiteten Vorschläge eines 'Alternativen Handelsmandats') zu unterschreiben, zumindest wenn sie ihre eigenen Worte und Werte ernst nehmen“ (ebd., 260). In der Tat, was hier als „grundsätzliche Ideen für ein besseres TTIP“ (ebd., 255) ins Spiel gebracht wird deckt sich im Wesentlichen mit den Worten und Werten, die CDU/CSU oder SPD zur Begründung des TTIP-Mandats bemühen, und es dürfte wirklich leicht fallen, diese hehren Absichten (Rettung hoher Standards, Schutz der Umwelt…) gegenüber der Öffentlichkeit deutlicher herauszustellen. So ist die Autorin auch von sozialdemokratischen Vorschlägen angetan, die Möglichkeiten einer echt partnerschaftlichen Verhandlung auszuloten: „Statt gegeneinander zu verhandeln, müssten in den Handelsgesprächen vertrauensvoll gemeinsam Regeln und Standards, Verfahren und Normen entwickelt werden.“ (Ebd., 257) Man muss nur einfach die Gegensätzlichkeit des ganzen Unterfangens idealistisch in ein gemeinsames Anliegen umdeuten, das von der Politik entschieden zu verfolgen und dessen Fortschritt von der Bürgerschaft zu kontrollieren wäre, und schon wird aus dem bedrohlichen Jahrhundertprojekt TTIP, aus der angekündigten „Wirtschafts-NATO“ (Hillary Clinton), eine menschenfreundliche Angelegenheit zum Schutz von Umwelt, Arbeitnehmern und Menschenrechten…
Ganz in diesem Sinne wird etwa der sozialdemokratische Protest beruhigt. Die SPD, deren Basis sich zu großen Teilen im TTIP-Protest engagierte, einigte sich bei ihrem Bundesparteitag vom 10. bis 12. Dezember 2015 darauf, dass die Verhandlungen fortgeführt werden sollen. Im Beschluss Nr. 27 (https://www.spd.de/aktuelles/bundesparteitag-2015/…), der die Zustimmung der Parteitagsmehrheit erhielt, heißt es: „Die transatlantischen Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und mit Kanada (CETA) bieten die Chance, die wirtschaftliche Globalisierung politisch zu gestalten. Gerade ein Abkommen zwischen den beiden weltweit größten Handelsräumen Europa und den USA eröffnet die Möglichkeit, globale Standards für nachhaltiges Wirtschaften zu setzen. Auf dem Parteikonvent im September 2014 haben wir einen Grundsatzbeschluss zu den transatlantischen Freihandelsabkommen gefasst. Der Bundesparteitag bestätigt diesen Beschluss. Er ist für uns weiterhin maßgeblich und stellt die programmatischen Maßstäbe dar, die unsere Politik leiten: Erstens: Wir wollen fortschrittliche Regeln in den Abkommen vereinbaren und zugleich sicherstellen, dass bewährte europäische Standards bei Arbeitnehmerrechten, der Daseinsvorsorge, dem Verbraucher- und Umweltschutz, zur Wahrung der kulturellen Vielfalt erhalten bleiben. Zweitens haben wir vereinbart, dass der Primat der Politik uneingeschränkt gelten muss. Rechtsstaatliche Grundsätze und demokratische Beschlüsse dürfen nicht von Konzernen ausgehebelt oder umgangen werden können. Die dritte Mindestbedingung war: Der Verhandlungsprozess muss transparent sein, und am Ende müssen alle nationalen Parlamente sowie das EU-Parlament über die Abkommen abstimmen. Um solche Abkommen im Dialog mit der Zivilgesellschaft zu erarbeiten, haben wir größtmögliche Transparenz und Offenheit von der EU-Kommission eingefordert. Diesem politischen Druck sowie auch der öffentlichen Kritik von Verbänden, Gewerkschaften, Gruppen der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern ist es zu verdanken, dass die EU-Kommission mittlerweile umsteuert und erste wichtige Verbesserungen für mehr Transparenz auf den Weg gebracht hat.“
Damit ist, auch wenn es auf dem Parteitag einige kontroverse Diskussionsbeiträge gab, der SPD-Protest gegen TTIP erledigt. Parteivize Ralf Stegner beruhigte die Kritiker noch einmal mit der Erklärung, im SPD-Beschluss seien die drei wichtigen „rote Linien“ für den Verhandlungsprozess festgehalten: (1) Gute europäische Schutzstandards dürfen nicht sinken, (2) ein transparenter Prozess muss gewährleistet sein, (3) es darf keine „undemokratischen Schiedsgerichte oder ähnliche demokratieaushebelnde Verfahren“ geben. Zum dritten, besonders strittigen Punkt heißt es in dem Beschluss: „Wir wollen, dass Investitionsschutzregeln in Handelsabkommen nach rechtsstaatlichen Prinzipien ausgestaltet werden.“ Somit ist die frühere Position des sozialdemokratischen Partei-Konvents aufgegeben, derzufolge „Investitionsschutzvorschriften in einem Abkommen zwischen den USA und der EU grundsätzlich nicht erforderlich sind“ (vgl. Pinzler 2015b). Nun findet die SPD-Mehrheit eine Sache, die sie bisher für unnötig hielt, in reformierter Form sinnvoll. Parteichef Sigmar Gabriel kündigte in der Debatte an, dass die SPD auf einem Parteitag oder Konvent über das Ergebnis der Verhandlungen beraten werde.
So sind innenpolitisch einer Ratifizierung des Abkommens alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. CDU/CSU tragen ja sowieso das EU-Verhandlungsmandat mit (vgl. Freytag u.a. 2014); von einzelnen Parteimitgliedern, so vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, waren höchstens einmal Beschwerden über die intransparenten Verhandlungen und Beteuerungen der Rechte nationaler Parlamente zu hören (Die Zeit, 28.10. 2015). Für die Grünen gilt seit ihrem Parteitagsbeschluss vom November 2014 die Leitlinie: „TTIP – so nicht“. In dem Beschluss hieß es: „Wir wollen eine Handelspolitik, die fair für alle ist. Hierzu gehört, im Rahmen einer Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Staaten, ein Austausch über gute Standards, gute Arbeitsbedingungen und eine gute Regulierungspraxis, sowie eine Vereinheitlichung von technischen Normen. Dies würde auch insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen nutzen.“ (https://www.gruene.de) Das EU-Mandat und die bisher bekannten Ergebnisse der TTIP-Verhandlungen „gehen jedoch“, so die Grünen, „in eine andere Richtung“. Damit wird von der Partei bereits signalisiert, dass das Abkommen zwar „so nicht“ zustande kommen sollte, aber bei Modifikationen, die im Prinzip mit den vom SPD-Parteitagsbeschluss genannten übereinstimmen, durchaus grüne Zustimmung finden könnte. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann machte dies mit der Bemerkung explizit, dass ein Abkommen, das Deutschland nützt, wünschenswert sei; er persönlich jedenfalls „freut sich drauf“, dass die Sache gelingt: „Wir wollen eine ambitionierte TTIP, die unserer starken Exportwirtschaft im Land, aber gleichermaßen auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzt“ (taz, 19.3.2015).
Last but not least sind auch die deutschen Gewerkschaften größtenteils auf Linie. Im Dezember 2015 erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann beim Berliner Bürgerdialog mit der EU-Handelskommissarin: „Die Gewerkschaften sind nicht gegen TTIP, aber die Bedingungen müssen stimmen“ (http://www.europa-union.de/eud/news/berliner-buerg…). Auch von Einzelgewerkschaften, die sich kämpferischer geben und teilweise in der Protestszene mitwirken, kamen solche Signale. Der Verdi-Bundesvorstand z.B. unterstützte explizit die Position des deutschen Wirtschaftsministers; die Schaffung einer transatlantischen Freihandelszone müsste unter dem „Anspruch einer sozialen Gestaltung der Globalisierung“ stehen (Verdi 2015, 9): „Die Gewerkschaften streiten für einen fairen Handel, der auf ökologischen und sozialen Standards beruht.“ Nur die Linkspartei lehnt bislang TTIP generell ab (vgl. Junge Welt, 14.12.2015). Aber dies wird für eine eventuelle Parlamentsentscheidung belanglos sein – genau so wie die Übergabe von 3.284.289 Unterschriften der selbstorganisierten Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP. Die Unterschriften nahm Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, am 9. November 2015 entgegen (vgl. http://www.ttip-unfairhandelbar.de/start/ebi/). Die Europäische Kommission hatte der Initiative eine offizielle Registrierung verweigert, worauf diese sich als inoffizielle konstituierte. Ob offiziell anerkannt oder nicht, inhaltlichen Einfluss auf den Verhandlungsprozess kann eine solche „EBI“ jedoch nicht nehmen. Ebenso wenig stellt die vom EU-Parlament 2015 verabschiedete moderat-kritische Resolution eine Behinderung des TTIP-Prozesses dar (vgl. Pinzler 2015a, 255f).
Zu den prominenten Kritikern des Freihandelsabkommens gehört ATTAC Deutschland. Die NGO, die auch maßgeblich an der großen Berliner Protestaktion vom 10. Oktober beteiligt war, hat in zwei ATTAC-Basis-Texten (Klimenta u.a. 2014, 2015) ihre Grundsatzposition formuliert. TTIP ist demnach „die Fortsetzung eines alten Denkens, das statt auf die Teilhabe aller auf die Gewinne weniger fokussiert“ (Klimenta u.a. 2015, 7). Diese Kritik hält ATTAC, wie oben dargelegt, auch nach den Modifikationen aufrecht, die der deutsche Wirtschaftsminister angekündigt hat. Dabei ist in der Kritik allenfalls eine Akzentverschiebung feststellbar. Bisher machte sich die TTIP-Gegnerschaft vor allem und als Erstes an den versprochenen Wohltaten – Wachstum, Arbeitsplätze, Kostenersparnis – fest und bezweifelte aufgrund alternativer Berechnungen oder allgemeiner Überlegungen das Eintreten dieser Effekte. Dass das Wachstumsversprechen für die gewöhnlichen Arbeitskräfte, die für den Unternehmenserfolg einstehen müssen, eine Drohung darstellt und keineswegs als Verheißung zu nehmen ist, kam dabei nicht vor (vgl. Gegeninformation 2015). In der großzügig hochgerechneten volkswirtschaftlichen Wohlstandsmehrung sah ATTAC vielmehr eine Täuschung des Publikums. Die europäische Arbeiterschaft, so hieß es von Seiten der ATTAC-Experten, könne sich nicht auf eine Vermehrung hiesiger Hochleistungsarbeitsplätze freuen; in Wirklichkeit werde – verdeckt durch die Geheimhaltung und die propagandistisch verbreitete „Freihandelslüge“ (Bode) – an einer Bevorzugung der großen multinationalen Konzerne gearbeitet.
Harald Klimenta vom Wissenschaftliche Beirat von ATTAC hat in seiner neuen Argumentationshilfe von 2015 den Einstieg in die Kritik verändert. Ausgangspunkt ist nun das geostrategische Argument, mit dem die Befürworter einer transatlantischen Freihandelszone für ihre Position werben. Die Geostrategie brachte ja auch Minister Gabriel als erstes Argument, als er in der Bildzeitung (6.3.2015) „Fünf Gründe, warum TTIP gut für uns ist“ dem Publikum vorstellte: „1. Europa eine Stimme geben! Selbst das starke Deutschland wird in ein paar Jahren gegenüber den neuen Riesen in der Welt – China, Indien, Lateinamerika – zu klein sein, um gehört zu werden. Unsere Kinder haben entweder eine europäische Stimme oder keine Stimme in der Welt. Doch selbst als Europäer alleine sind wir zu klein, denn der Anteil der Europäer an der Weltbevölkerung sinkt… Wenn wir also die Balance in der Welt halten wollen, brauchen wir Partner. Zuallererst die USA.“ Klimenta stellt zu einer solchen Argumentationsweise fest: „Seit sich der angebliche Nutzen von TTIP & Co für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in Luft aufgelöst hat, hat das Argument Hochkonjunktur, mit TTIP würden wir die globalen Spielregeln für Handel und Weltwirtschaft setzen.“ (Klimenta u.a. 2015, 14) Und der ATTAC-Autor kontert: „Hört sich zunächst gut an“, die Frage sei aber, ob eine solche Strategie „realitätstüchtig“ ist (ebd.).
Das ist schon bemerkenswert! Die deutlich imperialistische Ansage einer Nation, die die Weltwirtschaft zum eigenen Vorteil bestimmen will, wird mit der Bemerkung aufgegriffen, dass sich das gut anhöre, um dann das Bedenken zu äußern, ob „diese Strategie funktioniert“ (ebd.). Das strategische Defizit soll darin bestehen, dass eine derartige Dominanz in eine „neue Blockkonfrontation“ führen könnte (ebd.). Die aufstrebenden Schwellenmächte, die BRICS-Staaten, würden nämlich angesichts eines solchen Projekts Gegenstrategien entwickeln. „Dabei wäre es gerade eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben internationaler Politik, diese Länder in eine stabile internationale politische und ökonomische Struktur einzubauen“ (ebd.). Und für die Durchsetzung des Vorhabens, andere Nationen im deutscheuropäischen Interesse in die Weltordnung einzubauen, sieht der ATTAC-Autor kaum Vorteile darin, wenn sich Deutschland und Europa zu stark an die USA binden. Eine solche Anbindung „dennoch weiter voranzutreiben, heißt unsere eigene Position in der Welt zu schwächen“ (ebd.). Eine „ökonomisch kluge Strategie“ sehe dagegen anders aus: „Die beste Strategie für Europa ist, nicht nur auf die USA zu schauen, sondern selbst die Beziehungen zu den wesentlichen Zukunftsmärkten auszubauen“ (ebd.). Eine kluge Politik der Stärke ist also das, was diese Kritik im Auge hat.
Das unterscheidet sich nicht groß von Positionen, wie sie etwa das staatliche Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) vertritt. Dessen Experten, die natürlich von Amts wegen den „Nord-Süd-Konflikt“ auf dem Schirm haben müssen, geben ebenfalls zu bedenken, dass die transatlantische Dominanz „als Gegenreaktion handelspolitische Blockbildungen von Schwellenländern“ provozieren könnte (Berger/Brandi 2015a). Also auch hier wird die Frage aufgeworfen, ob die „expansive Verhandlungsagenda“ (ebd.) von EU bzw. USA angesichts der Ambitionen von emerging markets und der Problemfälle der kapitalistischen Peripherie durchsetzbar ist, wobei das Fazit dann wieder recht ausgewogen ausfällt: „Die TTIP-Verhandlungen bergen sowohl Potenziale als auch Herausforderungen für die globale Entwicklung und die faire Gestaltung der Globalisierung.“ (Ebd.) Die DIE-Experten setzen schlussendlich – ähnlich wie die ATTAC-Autoren – auf multilaterale Verhandlungen, auf „eine Rückbesinnung auf die WTO“, wie es an anderer Stelle heißt (Berger/Brandi 2015b).
Antikapitalistische Kritik?
Dass bei der landläufigen Aufregung über Chlorhühnchen, Fracking oder Gentechnik der Kern des Problems – die Gegensätze der beiden kapitalistischen Zentren USA und Europa, ihre Konkurrenz ums Weltgeld und ihr angestrebtes „neues Regime für den Weltkapitalismus“ (Decker 2014, 112) – in den Hintergrund gerät, macht die Hauptschwäche der Protestbewegung aus (vgl. Decker 2015a). Das Profitinteresse, das hierzulande als ökonomisches Prinzip gilt, sowie dessen staatliche Aufsicht werden mit ihren nationalen bzw. europäischen Härten vom Protest zwar irgendwie zur Kenntnis, aber gleichzeitig aus der Schusslinie genommen. „Mit ihrem Anliegen 'TTIP verhindern!' halten sich die Kritiker bei ihrem Befund über die systematische Rücksichtslosigkeit des Geschäfts nicht lange auf. Sie beschäftigen sich gar nicht weiter mit der Frage nach der Natur des herrschenden 'Gewinninteresses', nach dessen systemischen Gründen, woher es seine Macht bezieht, die gesamte Gesellschaft von seinen geschäftlichen Notwendigkeiten abhängig zu machen: Man zielt nicht auf die Beseitigung der Quelle der beklagten Folgen kapitalistischer Geschäftstätigkeit, sondern auf eine staatliche Beschränkung bei der Wahrnehmung der Interessen, die diese Wirkungen zeitigen.“ (Decker 2015a, 109)
Die Protestbewegung gegen TTIP – die größte, die es zur Zeit in der BRD gibt – prangert die Macht des (Groß-)Kapitals und die (drohende) Ohnmacht des Staates immer wieder an, erscheint also wie eine systemkritische Opposition. Sie verfehlt jedoch – das ist der zentrale Einwand – das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Sie gibt sich antikapitalistisch und nährt gleichzeitig die Vorstellung, ein moderierendes politisches Eingreifen in den Kapitalismus, ja schon allein die Aufgabe des TTIP-Projekts und der Erhalt des Staus quo würden zu einem (relativ) fairen weltwirtschaftlichen Resultat führen. Wer so agiert, macht sich in der Konsequenz schwach gegenüber dem politischen Gegner – ob er nun als Kritiker intransigent bleibt oder letztendlich doch den Beteuerungen der regierenden Politiker glaubt, man werde die demokratischen und anderen Defizite des Abkommens beheben. Im Folgenden wird diese Schwäche des Protest noch einmal an acht Punkten verdeutlicht.
1. Freihandel soll, so die offizielle Ansage der Politik, dem „beiderseitigen“ Wirtschaftserfolg der „Partner“ Schranken aus dem Weg räumen. Dagegen wendet der Protest ein: Dann verändern, d.h. verschlechtern sich flächendeckend die Lebens- und Arbeitsbedingungen; dann kommen nämlich wirtschaftliche Interessen ungehemmt zum Zuge; dann fällt bisheriger staatlicher Schutz weg, weil eine „Selbstaufgabe des Staates“ (Glunk 2015) eintritt; dann regiert, kurzum, nur noch das Gewinninteresse. Dieses Interesse gilt also, so ist zu schlussfolgern, als Handlungsmaxime in der Wirtschaft. Deshalb wendet sich der Protest ja auch nicht an deren Vertreter, sondern an den Staat. Der soll tätig werden und beschränken statt sich aufzugeben. Dessen Handlungsfähigkeit wird also zum zentralen Sorgeobjekt. So hat auch eine Umfrage bei den (laut Veranstalterangaben) 250.000 Berliner Anti-TTIP-Demonstranten ergeben, dass das Hauptmotiv zur Teilnahme (61 %) die Befürchtung war, mit dem Abkommen „würde eine Beschränkung der Macht großer Konzerne sehr viel schwieriger“ (siehe das Interview mit dem Politikwissenschaftler Sebastian Haunss in: Junge Welt, 10.11.2015). An zweiter Stelle (53 %) stand die Sorge, „das Abkommen gefährde die Demokratie“. Mit großem Abstand folgten dann erst Motive wie die Angst vor dem Abbau von Umwelt- und anderen Standards.
Zu der Sorge über eine rücksichtslose Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen ist festzuhalten: Dass das Gewinninteresse systematisch (und nicht vereinzelt) gilt, wird vom Protest keiner näheren Befassung für wert befunden. Hier bestünde aber – erstens – gerade Klärungsbedarf. Was ist das für eine Wirtschaftsordnung, welche Rechnungsweisen gelten in ihr, welche Interessen kommen beim grenzüberschreitenden Handel und Wandel zum Zuge? Zweitens: Wenn der Verdacht auf eine ungute Machtentfaltung des Kapitals besteht und wenn angesichts dieser Lage nach Abhilfe gesucht wird, warum setzt diese dann nicht gleich 'an der Quelle' an, tritt also als Angriff auf diese Ökonomie an?
2. Statt dessen wird der Staat zum Adressaten. Den bzw. den „Kernbestand der Demokratie“ (Glunk 2015, 16) gelte es zu retten. So ist es ja auch laut Berliner Umfrage den Demonstranten in der Hauptsache „um Grundsätzliches, eben den Verlust von Demokratie und Kontrolle“ (Junge Welt, 10.11.2015) gegangen. Der Staat regelt das Wirtschaftsleben, und er soll, laut Antrag der Protestszene, die bestehenden Regulierungen bewahren, nicht opfern – „Ich bin ein Handelshemmnis“ lautet z.B. eine der zentralen Protest-Parolen, die die Politik darauf verpflichten will, den Konsumenten und Arbeitnehmern den gewährten Schutz zu erhalten.
Hier ist wieder ein gravierendes Manko des Protests festzuhalten: Wer diesen Antrag stellt, dem könnte eigentlich auffallen, dass der Staat das Profitinteresse, das er in der Tat reguliert, erst einmal in Kraft setzt, also über dessen Geltung bestimmt – sonst wäre es ihm ja nicht möglich, es zu be- und entschränken. Die erste Tat eines modernen Staates besteht eben darin, dem Grundsatz „Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt“ (wie es ein FDP-Wirtschaftsminister formulierte) Gültigkeit zu verschaffen. Private Bereicherung ist in der Marktwirtschaft – ob sie sich nun näherhin sozial, freiheitlich, sozialökologisch oder sonstwie definiert – staatlich gewollt. Diese Leistung übergeht der Protest, der Staat ist für ihn nur die Schutzmacht der von den privatwirtschaftlichen Interessen Betroffenen.
3. Es ist nicht zu bestreiten, dass der moderne Staat, der eine Marktwirtschaft betreut, zahlreiche Regulierungen vornimmt. Sie werden von der Protestszene aber in einer eigentümlichen Weise aufgefasst. Die umweltpolitischen oder arbeitsrechtlichen Auflagen des Staates gelten ihm als eine Wohltat für Konsumenten, Arbeitnehmer und sonstige Betroffene – jedenfalls im Prinzip, denn an der konkreten Ausgestaltung der nationalen oder europäischen Schutzmaßnahmen haben die einzelnen Interessenverbände und NGO's, die sich im Anti-TTIP-Bündnis zusammengeschlossen haben, vielfältige Kritik anzumelden.
Auch hier zeigt sich die Schwäche des Protests: Die politischen Beschränkungen, die es ja (mit all ihren nationalen Unterschieden) gibt, werden in eine Dienstleistung für die Bürger umgedeutet – so als ob der Staat den Standpunkt der Betroffenen einnähme. In Wirklichkeit greift er ein, weil die rücksichtslose Vernutzung von Mensch und Natur die Bestandsfrage für das ökonomische System aufwirft. Die Politik kümmert sich um Funktionserfordernisse, die das (Einzel-)Kapital nicht im Visier hat. So betreut der Staat in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner Sozialgesetzgebung die Funktionsfähigkeit der nationalen Arbeiterklasse – die Bundesrepublik konnte z.B. 2014 nicht nur auf 100 Jahre Weltkrieg zurückblicken, sondern auch auf den Beginn der Arbeitslosenversicherung, die im Krieg die Stabilität der Heimatfront sichern sollte (vgl. Butterwegge 2015). Oder er sorgt mit der genau dosierten Freigabe des Unkrautvertilgungsmittels Glyphosat dafür, dass ein weltweites Geschäft, an dem gerade auch deutsche Chemiekonzerne beteiligt sind, nicht durch zu niedrig angesetzte Grenzwerte behindert wird (vgl. Moldenhauer 2015).
4. Für den TTIP-Protest sind die gültigen Regulierungen natürlich auch nicht zufriedenstellend. Er betrachtet sie als Maßnahmen, die leider noch nicht konsequent genug durchgesetzt sind, die aber – immerhin – im europäischen Rahmen weiter gediehen seien (Stichwort: europäisches Vorsorgeprinzip) als beim atlantischen Partner (Stichwort: US-amerikanisches Nachsorgeprinzip). Die einschlägigen NGO's kennen, wenn sie im nationalen oder europäischen Rahmen unterwegs sind, lauter Kritikpunkte. Bei ihrer Begutachtung der Politik entdecken sie überall „Versäumnisse“ und „Unterlassungen“, die jetzt auf einer erweiterten, transatlantischen Stufenleiter auftreten sollen.
Dies ist ebenfalls ein unzutreffender Einwand: Wo der Staat gerade handelt, einem gültigen Interesse Grenzen setzt und dies jetzt transatlantisch – als Chefsache – neu justiert, erkennt der Protest nur Versagen, Nichtstun. Dabei kann von Nachlässigkeit, wenn man sich etwa die beiden großen Umwelt-Skandale der letzten Zeit ansieht (manipulierte Abgaswerte bei VW, vgl. Decker 2015b; Streit um Glyphosat-Grenzwerte), keine Rede sein. In diesen Fällen hat die deutsche bzw. europäische Politik der Tatsache Rechnung getragen, dass es um Milliarden-schwere Geschäfte geht, die durch Auflagen in ihrem grundsätzlichen Erfolg nicht behindert werden dürfen. Bezeichnender Weise hat hier auch nicht das europäische Vorsorgeprinzip gegriffen, dem die Protestszene so viel zugute hält, sondern der Einspruch, der von amerikanischer Seite (Abgasmessungen) bzw. der UN-Gesundheitsorganisation WHO (Glyphosatstudien) kam. Hier offenbart sich also, dass man in der hochgelobten europäischen Sicherheitsphilosophie namens „Vorsorgeprinzip“ wirklich nur eine Philosophie vor sich hat, nämlich den ideologischen Überbau einer politischen Praxis, die ganz andere, handfeste Geschäftsnotwendigkeiten zu berücksichtigen hat.
5. Die festgestellte Inkonsequenz des staatlichen Handelns wird von der Protestbewegung im Blick auf die TTIP-Verhandlungen dann in den Vorwurf der „Deregulierung“ überführt. Die europäischen Staaten hätten sich – von der Wirtschaftslobby bedrängt, was durch die Intransparenz der Verhandlungen verschleiert werde – von ihrer eigentlichen Aufgabe losgesagt. Ihnen gehe es jetzt nur noch darum, früher für notwendig befundene Schutzmaßnahmen als Handelshemmnisse einzustufen und zu beseitigen, das heißt: Regellosigkeit herzustellen.
Dies kann aber nicht das Ziel der Verhandlungen sein: Ginge es darum, die bestehenden Regulierungen einfach zu entsorgen, wäre der Aushandlungsprozess im Handumdrehen zu erledigen. Das ist jedoch erkennbar nicht der Fall. Gerungen wird gerade um neue Regulierungen, die – so das paradoxe Unternehmen – beiden Seiten Vorteile einbringen bzw. verhindern sollen, dass man selber über den Tisch gezogen wird. Dass dabei in einer ersten Phase Geheimhaltung beim strategischen Vorgehen praktiziert wird, gehört logischer Weise dazu. Bei der gegensätzlichen Interessenlage will natürlich keine Seite ihre Strategie offenlegen. Die Sache selber und die Gegensätze, die zur Sprache kommen, sind dagegen kein Geheimnis.
6. Der Protest gegen TTIP ist damit angetreten, die offiziellen Versprechungen der Politik als Angebot an die Bürger aufzunehmen, das er mit einer Gegenrechnung konfrontiert: Weder Wachstum noch Arbeitsplätze seien von dem Abkommen zu erwarten! Auch wenn mittlerweile Demokratieabbau und politischer Kontrollverlust im Vordergrund stehen, hat sich die Argumentation mit Alternativgutachten und -hochrechnungen für die TTIP-Kritiker nicht erledigt. Im Gegenteil: Weil Behörden und Wirtschaftsverbände einzelne vollmundige Prognosen über den wirtschaftlichen Auftrieb durch eine Freihandelszone revidieren mussten, Gabriel z.B. von den Hochrechnungen als „Voodoo-Ökonomie“ sprach (Handelsblatt, 11.04.2015), sieht sich der Protest ins Recht gesetzt (vgl. Klimenta u.a. 2015, 14, 44).
Auch dies ist ein bemerkenswerter Fehler: Der Protest stellt sich positiv zu dem Vorhaben, den wirtschaftlichen Ertrag für die (jeweils) eigene Seite zu mehren. Er greift nicht den Inhalt des Versprechens an, dass das Wachstum gesteigert, also die Bedienung des Gewinninteresses – dessen Erfolg populärer Weise in die Vermehrung von Arbeitsplätzen übersetzt wird – verbessert werden soll. Er fragt vielmehr danach, ob das Vorhaben realistisch ist. Ähnlich wie beim imperialistischen Standpunkt, der im geostrategischen Argument der Befürworter unübersehbar aufscheint, wird das zentrale kapitalistische Erfordernis wirtschaftlichen Wachstums, die Gewinnerzielung in privater Hand, in erster Linie daraufhin kritisch begutachtet, ob hier eine „Realitätstüchtigkeit“ der vorgeschlagenen Strategie gegeben ist.
7. So gelangt die Protestbewegung zu ihrem härtesten Vorwurf: Mit der von Europa gewählten Verhandlungsstrategie sollen ein Verzicht auf staatliche Gestaltungsmacht und eine Ermächtigung der Falschen stattfinden. Zum Hauptpunkt der Kritik, auf den die Politik mit Verständnis reagiert hat, avancierte ja das besagte ISDS-Thema, das Investor-Staat-Schlichtungsverfahren. Die Politik stellt damit angeblich die Demokratie zur Disposition und der Wirtschaft einen „Blankoscheck“ (Gunk 2015, 16) aus, weil sie in Zukunft vom Wohlwollen der Multis abhängig sei. Und der Verhandlungsprozess selber sei schon in die Hände der Wirtschaftslobby geraten, was natürlich (siehe den Vorwurf der Intransparenz) geheim gehalten werde.
Damit ist man wiederum bei dem Grundfehler: Gerade da, wo der höchste politische Aufwand betrieben wird, wo zudem – von vornherein – die Härte der Standortkonkurrenz das Scheitern des Vorhabens einschließt, wo jede politische Seite auf die Durchsetzung des eigenen Vorteils bedacht ist, soll die Politik abgedankt haben. Ganz fremd sind solche Bedenken in Sachen eigene Handlungsfähigkeit den politischen Instanzen nicht, denn sie befassen sich ja beim Verhandlungspoker mit der praktischen Durchsetzung ihrer Ansprüche. Ein Protest, der in diese Kerbe schlägt, kann ihnen sogar als Schützenhilfe gelegen kommen. Das politische Ziel ist die Mehrung wirtschaftlicher Stärke dadurch, dass man uneingeschränkt die Rechnungsweise des Kapitals gelten lässt. Und der projektierte Zuwachs an ökonomischer Stärke soll sich in politische Macht umsetzen. Dabei vertraut jeder auf die eigenen Potenziale, weiß natürlich auch, dass die Gegenseite einiges aufzubieten hat. Das ist es, was die beiden Verhandlungsparteien im Auge haben. Dabei treffen sie mit diametral entgegengesetzten Ansprüchen aufeinander, so dass höchste politische Wachsamkeit und Aktivität erfordert ist.
8. Diesen Konkurrenzcharakter nimmt der Protest auf seine Weise zur Kenntnis, nämlich leider so, dass er sich – in der Tendenz – auf eine Seite schlägt: Die an die Wand gemalten Gefahren sind letztlich ein amerikanischer Anschlag auf europäische Verhältnisse.
Damit geht die Kritik vollends in die Irre. Jetzt kommt zwar der Staat als Verursacher der marktwirtschaftlichen Misere ins Visier, aber der amerikanische. Der erscheint als Schutzmacht der Multis, während im Falle Europas ein Zutrauen in die staatliche Autorität genährt wird. So wird aus der Anspielung auf Antikapitalismus letztlich Antiamerikanismus, und es stehen gegen eins der größten wirtschaftspolitischen Projekte des Weltkapitalismus Patrioten auf. Da können sich am Schluss sogar Rechtsradikale an den Demos gegen TTIP beteiligen – was die politische Öffentlichkeit der deutschen Protestbewegung, allerdings mit maßlosen Übertreibungen (vgl. die Ergebnisse der empirischen Erhebung in Junge Welt, 10.11.2015), hämisch zum Vorwurf machte, so als ob der Protest nicht nur „hysterisch“ (Gabriel), sondern geradezu von der rechten Szene inszeniert sei.
Fazit: Die Kritik an TTIP gibt sich radikal, sie greift die Macht des Profitinteresses an und beschwört die Gefahr eines Klassenstaates, der dieses Interesse rücksichtslos zum Zug kommen lässt, um beide Vorwürfe dann wieder aus dem Verkehr zu ziehen – wenn bloß Deutschland und Europa dem amerikanischen Ansinnen widerstehen.
Literatur
- Axel Berger/Clara Brandi, Die Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP): Was sollte die Entwicklungspolitik tun? Analysen und Stellungnahmen, Nr. 1, hg. vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Bonn 2015a.
- Axel Berger/Clara Brandi, TTIP – Welthandel im Umbruch. In: Neu Zürcher Zeitung, 21.11.2015b.
- Thilo Bode, Die Freihandelslüge. Warum TTIP nur den Konzernen nützt – und uns allen schadet. Unter Mitarbeit von Stefan Scheytt. München 2015.
- Christoph Butterwegge, Hartz IV und die Folgen – Auf dem Weg in eine andere Republik? Weinheim und Basel 2015.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Mit TTIP zur Wirtschafts-NATO. Dollar-Imperialismus und Euro-Binnenmarkt – gemeinsam unüberwindlich. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2014, S. 103-114.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Anklagepunkt der TTIP-Kritiker – Die Degradierung des Gemeinwohls zum Handelshemmnis. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2015a, S. 107-119 (online unter: http://www.versus-politik.de/?cat=185).
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), „Dieselgate“ bei Volkswagen – Eine Schönheit kapitalistischen Wirtschaftens auf Weltniveau: Schadensfall Image-Ruinierung. In: Gegenstandpunkt, Nr. 4, 2015b, S. 38-46.
- Andreas Freytag/Peter Draper/Susanne Fricke, Die Auswirkungen von TTIP. 2 Teile. Hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin 2014 (online: www.kas.de).
- Gegeninformation, TTIP – Ein Kampfprogramm zur Neuordnung des Weltmarkts für Dollar- und Eurokapitalisten. Online: http://gegeninformation.org/ (2015).
- Fritz Glunck, TTIP: Die Selbstaufgabe des Staates. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 11, 2015, S. 14-16.
- Harald Klimenta, Andreas Fisahn u.a., Die Freihandelsfalle. Transatlantische Industriepolitik ohne Bürgerbeteiligung – das TTIP. Hamburg 2014.
- Harald Klimenta, Maritta Strasser, Peter Fuchs u.a., 38 Argumente gegen TTIP, CETA, TiSA & Co. Für einen zukunftsfähigen Welthandel. Hamburg 2015.
- Heike Moldenhauer, Glyphosat: Unser täglich Gift. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 12, 2015, S. 29-32.
- Petra Pinzler, Jede Stromleitung ist besser geplant als TTIP. In: zeit-online, 25.9.2014.
- Petra Pinzler, Der Unfreihandel – Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien. Reinbek 2015a.
- Petra Pinzler, Gabriel will SPD-Position zu TTIP verwässern. In: zeit-online, 7.12.2015b.
- Verdi Bundesvorstand, Fairer statt freier Handel – Was steckt hinter TTIP, CETA und TISA? Wirtschaftspolitik Informationen, Nr. 3, 2015.
Oktober 2015
Betrifft: Krisenfall Griechenland
Die „Rettung Griechenlands“ war – vor der Flüchtlingskrise – die große, alles in den Schatten stellende Herausforderung für die deutsche Politik. Der Vorgang hat, speziell in der Linken, zu einer Reihe von Veröffentlichungen geführt, die die offizielle Berichterstattung korrigieren und Aufklärung bieten wollen. Dazu eine Übersicht von Johannes Schillo.
„Im bilateralen deutsch-griechischen Verhältnis sind längst überwunden geglaubte Ressentiments an die Oberfläche getreten. Der Ton der öffentlichen Debatte wurde unfreundlich; er wurde teilweise sogar als beleidigend empfunden. Der Mangel an Wissen über Griechenland war erschreckend…“ (Klemm/Schultheiß 2015, 9). Was die Ex-Diplomaten Ulf-Dieter Klemm und Wolfgang Schultheiss – beide mit dienstlicher Griechenland-Erfahrung – in ihrem aktuellen Sammelband schreiben, ist noch diplomatisch formuliert. In der Tat, es gab in Deutschland eine unübersehbare Übereinstimmung der Medien mit der Regierungslinie bei dem Programm, den politischen Druck auf die Anfang 2015 ins Amt gekommene „linksradikale“ Syriza-Regierung aufrecht zu erhalten. Dafür wurden alle möglichen Ressentiments bemüht und unters Publikum gebracht. Ein solcher Schulterschluss hat sich übrigens beim nächsten nationalen Krisenfall, den Flüchtlingsströmen an Europas Grenzen, wiederholt, jetzt allerdings mit der umgekehrten Stoßrichtung, dass sich die deutsche Nation selbstlose Hilfe schuldig sei…
Im ersten Halbjahr 2015 dagegen taten die maßgeblichen Macher der öffentlichen Meinung alles dafür, die Hartherzigkeit der deutschen Politik zu unterstützen und sogar zu verschärfen, auf dass nur ja keine Zugeständnisse an die „faulen Griechen“ oder die „ungezogene“ linke Regierung zustande kämen (vgl. die exemplarische Bildzeitungsanalyse in Decker 2015, 61-69). Der erkennbar erpresserische Druck auf die unbequeme Regierungsmannschaft, den die EU unter Führung Deutschlands ausübte, wurde in der Öffentlichkeit gutgeheißen; er wurde „von den deutschen Medien fast uneingeschränkt mitgetragen und in der breiten Masse der Bevölkerung mit Hilfe sozialrassistischer Stereotype populär gemacht.“ (Roth 2015, 22) „So geht Volksverhetzung“, resümierte Peter Decker die Berichterstattung von „Bild“ mit ihrer „wohldosierten Mischung von Falschmeldung und Irreführung“ (Decker 2015, 64, 61).
Die Linke in Deutschland sah sich daher zur Gegeninformation herausgefordert. Ein „Faktencheck: Hellas“ wurde ins Leben gerufen, um allgemein die „Öffentlichkeit über die reale Situation in Griechenland aufzuklären“ (Faktencheck 2015, 1) und speziell den einschlägigen Stammtischparolen entgegenzutreten. Der Sammelband von Klemm/Schultheiss, der nicht aus der linken Szene kommt, gehört im Grunde ebenfalls in diese Kategorie. (Er wurde im Sommer 2015 von der Bundeszentrale für politische Bildung in ihr Publikationsprogramm übernommen; die Behörde hatte auch schon in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 2012 Griechenland mit den einschlägigen Topoi des „Klientelismus“, der „Steuerfreiheit der Reichen“, eines „ineffizienten Staatsapparats“ und einer „Veruntreuung staatlicher Gelder“, aber auch mit Hinweisen auf den deutschen „Kampagnenjournalismus“ zum Thema gemacht.) Im Sammelband der beiden Diplomaten schreiben zwar u.a. Befürworter einer gnadenlos marktwirtschaftlichen Lösung für die EU-Krise, doch ist das Interesse leitend, eine sachliche Informationsbasis zu schaffen und die kursierenden Griechenland-Klischees aus dem Verkehr zu ziehen – und das Buch wurde deshalb auch von linken Kommentatoren positiv gewürdigt (vgl. Roesler 2015). So wird ein kreuzbraver, ausgewogener Diskussionsbeitrag, der sich im Rahmen des landesüblichen wissenschaftlichen Pluralismus bewegt, zum Unterfangen mutiger Kritik!
Im Folgenden soll es darum gehen, die Leistungen der linken Gegenöffentlichkeit näher unter die Lupe zu nehmen, um dann die Publikation „Der Fall Griechenland – Fünf Jahre Krise und Krisenkonkurrenz“ (Köper/Taraben 2015), die jetzt nach der griechischen Parlamentswahl vom 20. September 2015 erscheint und sowohl die Vorgeschichte als auch den aktuellen Stand der „Griechenland-Hilfe“ thematisiert, als Beispiel einer politökonomischen Analyse vorzustellen.
Solidarische Gegenöffentlichkeit
Was hierzulande im medialen Mainstream unterging – wenn nicht gerade ein Vertreter der Linkspartei bei einer Talkshow oder Expertenrunde anwesend war und dem Syriza-Bashing entgegentrat –, das versuchten die Publikationen der Linken nachzutragen, also im Grunde eine Leistung der bürgerlichen Öffentlichkeit zu erbringen, nämlich korrekte Berichterstattung zu liefern, die z.B. nicht gleich vom Standpunkt des deutschen Steuerzahlers aus die Forderungen der „gierigen“ Griechen ins Visier nimmt, sondern sich der Faktenlage verpflichtet weiß. So ging es immer wieder (siehe Faktencheck Hellas Nr. 1) um die Widerlegung einer der beliebtesten deutschen Stammtischparolen, derzufolge „wir“ dem griechischen Volk schon Milliarden an Hilfe haben zukommen lassen und nicht weiter Geld in dieses „Fass ohne Boden“ schütten sollten. Die so genannten Hilfsgelder von rund 240 Mrd. Euro bis März 2015 waren ja, was auch Syriza-freundliche oder griechische Experten gelegentlich in Talkrunden des deutschen Fernsehens sagen durften, nie bei der Bevölkerung angekommen; die Mittel, die der dortige Staat erhielt, flossen zu 80-90 % an die Kreditgeber weiter, also direkt aus Griechenland zurück, wo sie sich für eine technische Sekunde aufgehalten hatten. Und bei der Bevölkerung kam das Gegenteil von Hilfe an, vielmehr zogen Armutsverhältnisse wie in der Dritten Welt ein (Hunger, Wohnungsnot, desaströse Gesundheitsversorgung…). Diese Lage gab dann in den hiesigen Medien – abgetrennt von der Frage nach der deutsch-europäischen Verursachung – Material für ergreifende Elendsberichte ab.
Die Versuche, die Faktenlage zur Kenntnis zu bringen, mussten natürlich notwendiger Weise zu Erklärungen der europäischen Misere ansetzen. Doch war dies nicht der Schwerpunkt. Bevor die politökonomische Analyse des europäischen Krisenfalls Marke Griechenland in Angriff genommen, angedeutet oder auch auf später vertagt wurde, trat etwas anderes in den Vordergrund: Die Gegenöffentlichkeit sollte der Solidarität dienen, und zwar mit dem Parteienbündnis Syriza, das als der große Hoffnungsträger aus den Protestbewegungen der Empörten, der Indignados, der Occupys etc. nach der Finanzkrise 2007ff hervorgegangen war. „Der Aufstieg von Syriza begann 2011 mit der Besetzung des zentralen Syntagma-Platzes in Athen durch soziale Bewegungen, Gewerkschafter, Bürgerinnen und Bürger. Das Netzwerk, das den Anstoß gab, hieß: Reale Demokratie Jetzt!“ Das schrieb der Politikwissenschaftler Alexis Passakadis im Faktencheck Nr. 1 (2015, 3), d.h. zu einem Zeitpunkt, als die neuartigen Bewegungen schon wieder weit gehend verschwunden waren. (Ulrich Irion hat die politologische Aufbereitung dieses relativ kurzfristigen Protestphänomens, die linke Vision eines (basis-)demokratischen Veränderungspotenzials und seiner systemverändernden Macht jüngst einer Überprüfung unterzogen, vgl. Irion 2015, 157ff.)
Als Syriza an die Macht kam, war also schon klar, dass die ursprüngliche Basisbewegung, auf die die Linke ihre Hoffnung gesetzt hatte – „Reale Demokratie Jetzt!“, d.h. die Abkehr vom Modell der repräsentativen und die Hinwendung zu direkter Demokratie und solidarischer Ökonomie –, gescheitert war. Jetzt musste die Transformation des radikaldemokratischen Aufbruchsgeistes ins normale parlamentarische Geschehen, wo die einen ein Wahlkreuz machen und die anderen daraus einen Wählerauftrag ableiten, so aufbereitet werden, dass sich die Enttäuschung über die Erfolglosigkeit des massenhaften Protestes in eine neue, erfolgversprechende Perspektive umdeuten ließ. Gegenöffentlichkeit hieß folglich, sich solidarisch mit einem Programm zu zeigen, um die Hoffnung auf Veränderung im Rahmen des parlamentarischen Systems am Leben zu erhalten. Ein halbes Jahr lang wurde diese Solidaritätsleistung erbracht. Man setzte auf die Syriza-Regierung, sah zwar die Möglichkeit eines Einknickens gegenüber den EU-Forderungen, hoffte aber darauf, dass Tsipras nicht nachgeben werde: „Ein solches Nachgeben ist nicht ohne weiteres möglich: Die Athener Regierung ist nicht einfach irgendeine Koalition bürgerlicher Parteien, sondern Ausdruck einer sozialen Bewegung, die sich nicht ohne Bruch über die Interessen ihrer Basis und Sympathisanten hinwegsetzen kann.“ (Kritidis 2015, 3)
Als sich dann das griechische Parlament auf Antrag der Regierung – nach dem Zwischenspiel des Referendums vom 5. Juli mit seiner Fast-Zweidrittel-Mehrheit eines eindeutigen „Ochi“ – am 15. Juli mit großer Mehrheit der EU-Erpressung beugte (229 Ja-Stimmen und 64 Nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen, 32 der 149 Syriza-Abgeordneten stimmten mit Nein, dafür die Oppositionsparteien Neo Demokratia, Potami und PASOK mit Ja), hatte die Linke hierzulande Schwierigkeiten, das Faktum überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. An der Niederlage gebe es nichts zu beschönigen, zu dieser Klarstellung sah sich etwa Thomas Sablowski (Rosa-Luxemburg-Stiftung) genötigt, auch wenn er gleich anfügte, dass das griechische Verhandlungsteam immerhin „für sich in Anspruch nehmen kann, noch das eine oder andere Zugeständnis herausgehandelt zu haben.“ (Sablowski 2015, 12) Dabei gestand der Autor selber einige Absätze später ein, „dass im Ergebnis die Forderungen an Griechenland im Hinblick auf weitere Privatisierungen, Souveränitätsverzicht und Vorleistungen wie Rentenkürzungen … noch erhöht wurden.“ (Ebd., 13) Es war also wieder, wie beim Niedergang der Demokratie-Jetzt-Bewegung, eine Enttäuschung zu verzeichnen, die verarbeitet werden musste. Hilfreich waren da etwa Überlegungen der Art, dass der Sieg der Reaktion möglicher Weise keiner sei: „Doch die Erpressung der griechischen Regierung könnte sich als Pyrrhussieg erweisen“ (ebd.) – dann nämlich, wenn sich die Herrschenden in Europa beim Beschreiten ihres Wegs, der „auf Dauer einfach nicht funktionieren kann“ (ebd.), zerstreiten würden. Trotz all solcher Versuche, aus der Niederlage in der einen Etappe schon den Vorboten eines Aufstiegs in der nächsten zu verfertigen, kam man jedoch um das Faktum des Misserfolgs nicht herum. Nur in wenigen Diskussionsbeiträgen aus der Linken wurde dies eindeutig festgehalten. So stellte das Kölner Griechenland-Solidaritätskomitee fest (http://gskk.eu/, 18.9.15), dass die „'linke' Regierung zur Erfüllungsgehilfin für das Auspressen breiter Bevölkerungsschichten“ geworden sei. Richard Aabromeit hielt in „Exit“ (2015) als Ergebnis der Syriza-Regierungszeit fest, „dass Alexis Tsipras sich endlich wirklich zum hellenischen Gerd Schröder mausert“. Die „Wildcat“-Redaktion resümierte: „Syriza hat den Weg, den andere sozialdemokratische Parteien in Jahrzehnten zurückgelegt haben, in zwei Jahren durchlaufen.“ (Wildcat 2015)
Solche klaren Worte waren, wie gesagt, die Ausnahme. Meist wurde der Kurswechsel mit einem gewissen Verständnis kommentiert oder sogar als unausweichlich dargestellt (vgl. Nölke 2015). Am weitesten gingen hier Joachim Bischoff und Björn Radke, die anscheinend durch nichts zu erschüttern sind. Der Wahlsieg von Syriza am 20. September wurde von ihnen als Erfolg gefeiert, auch wenn die niedrige Wahlbeteiligung, gerade bei den „unteren sozialen Schichten“, ein Problem sei: „Als wichtiges Faktum bleibt gleichwohl festzuhalten: Das Parteien- und politische System ist nicht implodiert und es gibt auch keine politische Blockade.“ (Bischoff/Radke 2015a, 2) Eine seltsame Beruhigung! Würden im Deutschen Bundestag über 10 % Faschisten und Rechtsradikale sitzen, die Sozialdemokratie zur Splitterpartei mutieren und die Hälfte der Bevölkerung den Wahlurnen fern bleiben, würden bei hiesigen Linken wahrscheinlich alle Alarmglocken schrillen… Andere Experten sind übrigens schon seit einiger Zeit der Meinung, dass Griechenland einen Musterfall der „Postdemokratie“ darstellt, in der der demokratische Gehalt „implodiert“ ist, oder sich auf dem Weg in den faschistischen „Maßnahmestaat“ befindet (vgl. Kritidis 2014; ähnliche Sorgen über einen in der EU dominierenden „Exekutivföderalismus“ als Wegbereiter „postdemokratischer Herrschaftsausübung“ finden sich bei Habermas 2011).
Bischoff/Radke betrachten das Einknicken Syrizas vor den Gläubiger-Forderungen gewissermaßen als Quantité négligeable. Als erstes bringen sie in ihrer Bilanz Erfolgsmeldungen wie die vom stabilen politischen System, dem Syriza-Wahlerfolg oder von immer noch vorhandenen Spielräumen, die die neue Regierung ausnützen könne. Die erstaunliche Folgenlosigkeit des Ochi-Referendums wird dann eher beiläufig erwähnt: „Der sofortige Übergang zu einer alternativen Ökonomie in Griechenland war weder vom Wahlprogramm von Syriza noch von den Wahlergebnissen im Januar 2015 gedeckt. Das Linksbündnis hatte kein politisches Mandat für eine Revolutionierung der kapitalistischen Produktionsweise.“ (Bischoff/Radke 2015a, 4) Und die beiden Autoren machen ihre eigene Solidarität, ihre „Sympathie“ mit politischen Freunden, zum Argument dafür, Syriza auch weiterhin die Stange zu halten: „Wir verfolgen seit Langem diese Option und Methode der politischen Arbeit (= der in eurokommunistischer Tradition stehende parlamentarische Kampf gegen den klientelistisch geprägten griechischen Kapitalismus, J.S.) mit großer Sympathie und Unterstützung. Und wir sehen uns in dieser Haltung bestätigt, seit nach der Zustimmung der Mehrheit von Syriza zum dritten Memorandum der demokratische Firnis bei etlichen europäischen Linksformationen abplatzte und die Rhetorik des Klassenverrats, der imperialistischen Verschwörung und des Putsches in der politischen Debatte wieder einen großen Stellenwert einnahm.“ (Bischoff/Radke 2015b, 12) In ihrer Sympathie sehen sich die Autoren bestätigt, weil andere Linke angesichts des Kurswechsels von Syriza Antipathie äußern!?
So viel lässt sich bis hierhin festhalten: Das Bekenntnis zur parlamentarischen Methode der politischen Arbeit oder, allgemeiner gesagt, das Identifizieren von Hoffnungszeichen und die Lieferung eines theoretischen Überbaus zu den daran geknüpften Erfolgsperspektiven – das ist der vorherrschende Standpunkt, von dem aus die linke Gegenöffentlichkeit antrat und an dem sie dann unter erschwerten Bedingungen im Sommer 2015 festhielt. Ähnlich praktiziert das ja in Deutschland die Linkspartei, die von der Idee eines sozialen Europas ausgeht und Tsipras dafür als Gewährsmann nimmt. Die Fraktion der Linken lehnte das dritte Reformpaket im Deutschen Bundestag ab, votierte also gegen das, was Tsipras zuhause durchsetzen muss, die Partei will ihm aber trotzdem die Treue halten. Er soll eben, auch wenn ihn widrige Umstände an der Durchsetzung seines eigentlichen Programms hindern, als Hoffnungsträger für die parlamentarisch-realistische Methode der politischen Arbeit dienen. Andere linke Kommentare ließen erkennen, dass am Vorwurf des „Klassenverrats“ etwas dran sein könnte, zielten aber vor allem darauf, dass strategische Fehler gemacht wurden. Karl-Heinz Roth z.B. gestand ein, dass Syriza nach dem überwältigenden Ochi des Referendums nicht dem Votum der Bevölkerung gefolgt sei, sondern genau den gegenteiligen Kurs eingeschlagen habe – ein Sachverhalt, dessen Ermittlung ja auch keinen großen analytischen Aufwand erfordert. Roth machte für das Einknicken aber erstens den Druck Deutschlands verantwortlich und war zweitens der Meinung, dass nach dem Referendum keine Alternative zur Verfügung gestanden habe, man also nachgeben musste (Roth 2015, 16f): Es fehlte ein Plan B (Grexit, Einführung einer Parallelwährung…), mit dem die griechische Regierung der EU-Führung hätte drohen können. Diese Unterlassung, so Roth, gehe aufs Konto des rechten Flügels von Syriza, der die rechtzeitige Vorbereitung einer solchen Widerstandsstrategie hintertrieben habe. Im Endergebnis heißt das jedenfalls, dass der Parteiführung mildernde Umstände zugestanden werden. In einem solchen Hin und Her zwischen hoffnungsvollen Möglichkeiten und der tristen, durchs deutsche Diktat bestimmten Wirklichkeit ergehen sich auch andere linke Analysen, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob man in diesem Zusammenhang noch groß von einer analytischen Leistung sprechen sollte.
So widmete „Lunapark21“, die „Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie“, ihre Ausgabe vom Sommer 2015 dem Griechenlandthema („banknix – grexit“). Sie meldete gleich im Editorial stolz, dass hier zum ersten Mal ein leibhaftiger Finanzminister schreibe – Euclid Tsakalotos von Syriza –, und bewertete im Übrigen voller Zuversicht den Ausgang des Referendums: „Mit dem großen Erfolg des 'Nein' am 5. Juli wurde die Verhandlungsposition von Syriza deutlich gestärkt“ (Lunapark21 2015, 3, 7). Als die Zeitschrift auf dem Markt war, hatte sowohl Tsakalotos sein Amt verloren als auch Syriza dem Diktat der „Institutionen“ nachgegeben! Sonstige Beiträge der Ausgabe brachten etwa Informationen im Stil der Faktenchecks oder von Wikipedia-Artikeln übers griechische Mehrwertsteuersystem. Des weiteren konnte man die Reise-Reportagen des Chefredakteurs Winfried Wolf lesen, die die Stimmungslage vor und nach dem Referendum in Athen einfingen, genauer gesagt: vor allem die Stimmung in der linken Szene, die den deutschen Redakteur und Mitherausgeber der Hellas-Faktenchecks aus Solidaritätsgründen eingeladen hatte. Wolf bekundete hier auch seinen „großen Respekt vor Alexis Tsipras, der von einem Krisengipfel zum nächsten strebt“, wobei am Rande dann doch noch eine kritische Bemerkung fiel: „Nicht nachvollziehbar bleibt für mich jedoch: Warum lässt er sich von Juncker bei jedem Treffen auf die Schultern klopfen, die Juncker'sche Krawatte über sein krawattenloses offenes Hemd halten oder sich von diesem Mann, der in der EU eine Rolle wie Blatter in der FIFA spielt, gar die Wangen tätscheln?“ (ebd., 46). Ja, das sind Fragen, die die Welt bewegen.
Man muss Wolf allerdings – dies nur nebenbei – konzedieren, dass die Führungsriege von Syriza sich genau mit solchen Fragen der persönlichen Haltung und Performance herumgeschlagen hat, sogar damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Yanis Varoufakis, der erste Finanzminister, der nach dem Referendum seinen Hut nehmen musste, veröffentliche in der Schweizer Wochenzeitung „WOZ“ unter dem ganz unironisch gemeinten Titel „Rettet den Kapitalismus!“ ein persönliches Statement, das zu den seltenen Dokumenten eines ungeschminkten Opportunismus gehört. Varoufakis resümiert in dem Aufsatz seine Begegnungen mit der Welt der großen Politik und berichtet davon, dass er „das Gefühl züchte, akzeptabel für die gute Gesellschaft zu werden. Das Gefühl der Selbstzufriedenheit, von den Einflussreichen umhegt zu werden, ist gelegentlich in mir aufgestiegen. Und welch ein unradikales, hässliches, korrumpierendes und zerstörerisches Gefühl war es!“ (Varoufakis 2015) Die Selbstanklage ist natürlich ironisch gemeint, wie aus dem Kontext und der abschließenden Bemerkung hervorgeht: „Wir müssen den revolutionären Maximalismus vermeiden, der letztlich den Neoliberalen hilft, jeden Widerstand gegen ihre selbstzerstörerische Gemeinheit zu umgehen…“ (ebd.). Tja, den Kampf um Anerkennung zu führen statt als Revoluzzer anzuecken, dabei aber nicht in totale Anpassung zu verfallen – das auszubalancieren ist schon ein schwieriges Geschäft.
Die Schweizer Zeitschrift „Widerspruch“ machte in ihrer Ausgabe Nr. 66 vom Herbst 2015 das Thema Finanzmacht zum Schwerpunkt – gerade auch deswegen, weil Debatten über Geld und Geldwirtschaft, wie es im Editorial hieß (Widerspruch 2015), „in der Linken nicht systematisch geführt“ würden. Mit Blick auf Griechenland wurde bemerkt: „Das deutliche 'Oxi' der griechischen Bevölkerung vom Juli 2015 ist als Antwort auf das neoliberale 'There is no alternative' zu verstehen: als Votum, sich eine europäische Alternative zur Austerität vorzustellen. Dass die Troika den Austeritätskurs ohne Schuldenschnitt dennoch fortsetzen will, zeigt, mit welcher Macht ein Wirtschaftsmodell verteidigt wird, das die Krise erst herbeigeführt hat.“ Und dann wurde zustimmend der ehemalige deutsche Finanzstaatssekretär Heiner Flassbeck zitiert: „Da sind politische Mechanismen am Werke, die mit der ökonomischen Vernunft schon lange nichts mehr zu tun haben (Schweiz am Sonntag, 15.7.2015)“. Es ist bezeichnend, dass die meisten kritisch gestimmten Autoren – wenn sie sich vom Feld der strategischen Begutachtung ab- und der ökonomischen Sache selber zuwenden – in der europaweit geltenden Sparpolitik keine ökonomische Rationalität erkennen können. Bei ihnen sieht es so aus, als ob eine ganze Garde europäischer Wirtschaftspolitiker dem Irrsinn verfallen sei und die Notwendigkeiten der marktwirtschaftlichen Steuerung aus den Augen verloren habe.
Die Zeitschrift „Z“ sieht das z.B. so: „Die Spar- und Umbauprogramme, die Griechenland aufgezwungen werden, entbehren jeder ökonomischen Logik.“ (Z-Redaktion 2015, 8) Die politökonomische Sache selber, da kann man dem „Widerspruch“-Editorial zustimmen, interessiert also die linke Debatte wenig bis gar nicht. Die Debattenbeiträge können und wollen in der praktizierten Wirtschaftspolitik keine zweckrationale Handlung erkennen, die in dem herrschenden System der globalen Marktwirtschaft ihren Grund hätte. Ihnen geht es in der Hauptsache um die Begutachtung von Durchsetzungsstrategien, um die Bestimmung oder Einschätzung von Kräfteverhältnissen – sei es beim griechischen Hoffnungsträger und den sozialen Bewegungen, sei es bei der politischen Klasse in Deutschland oder in anderen europäischen Staaten, wo sich ja über die Frage der Euro-Sanierungsmaßnahmen einige Kontroversen (Stichworte: Grexit, Nordeuro…) ergeben haben. Diese Differenzen, wie sie sich in Deutschland an den beiden Personen Merkel und Schäuble festmachen lassen, kann man natürlich auch zum Anlass nehmen, über die Haltbarkeit des durchgesetzten Sparregimes zu spekulieren, also auf das Ende des deutsch-europäischen Machtblocks zu setzen und neue Kräfteverhältnisse am Horizont aufscheinen zu sehen. Deutlich werde an der Verabschiedung des dritten Rettungspakets, heißt es in der Zeitschrift „Prokla“, „dass die an sich über Kreuz liegenden Fraktionen des Machtblocks (die 'autoritär-neoliberale' und die 'Reregulierungs-Fraktion', J.S.) in ihrer Gegnerschaft zur Infragestellung der bisherigen Austeritätspolitik durch Syriza – trotz aller Differenzen untereinander – zusammenstehen. Die Aufrechterhaltung der disziplinär-austeritätspolischen Agenda scheint der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Die Frage, die angesichts des offenkundigen Scheiterns von Syriza im Raum steht, ist, ob und wie lange diese vordergründige Einheit Bestand haben wird.“ (Georgi/Kannankulam 2015, 369)
Letztlich heißt das Programm für die meisten Linken also nicht Analyse des politökonomischen Härtefalls, der 2015 mit seiner sechsmonatigen Tour de force sowohl in demokratischer als auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht eindeutige Lektionen erteilt hat, sondern die Einnahme einer Haltung, die fast religiösen Charakter besitzt: Hoffen wider alle Hoffnung. Dazu eine nicht ganz unmaßgebliche Stimme aus der Linkspartei, die ja Syriza die Treue halten will. Oskar Lafontaine kommentiert die September-Wahl: „Die Wahl hat gezeigt: Obwohl Tsipras vor Merkel, Schäuble und Co auf die Knie ging, vertrauen ihm die Menschen immer noch mehr, als den korrupten Vertretern der Altparteien. Die Griechen geben die Hoffnung nicht auf, dass sich doch noch eine Möglichkeit eröffnet, die Zerstörung der Demokratie und des Sozialstaates aufzuhalten. Hoffentlich behält der Spiegel unrecht: 'Den zunehmend pragmatischen Kurs von Tsipras bewerten viele griechische Politikbeobachter positiv. Sie glauben, dass nur ein linker Regierungschef die unpopulären Reformen und Einschnitte in Griechenland umsetzen kann. Ähnliches war schon in Deutschland zu beobachten, wo ausgerechnet unter einer rot-grünen Bundesregierung die härtesten Arbeitsmarktreformen und der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr beschlossen wurden.' Gott bewahre, nicht noch mal!“ (Lafontaine 2015). Ja, jetzt kann wohl nur noch Gott helfen, dass nicht die Realitäten der Europapolitik, sondern die frommen Wünsche aus der Solidaritätsbewegung zum Zuge kommen!
Der politökonomische Kern
Sablowski hat in seinem „Junge Welt“-Essay die Schwachstelle der linken Debatte benannt, obwohl er selber weitestgehend im Rahmen des Taxierens von Kräfteverhältnissen verbleibt: „Es ist eine entscheidende Schwäche der überwiegend keynesianisch argumentierenden deutschen Linken, dass sie aus einer an der effektiven Nachfrage orientierten Perspektive die Austeritätspolitik immer nur als irrational darstellt…“ (Sablowski 2015, 13). In der Tat liegt hier der Hund begraben. Rudolf Hickel z.B. als Vertreter einer keynesianischen Position sieht im dritten Reformpaket, das Syriza jetzt umzusetzen hat, „eine noch härtere Dosis jener Austeritätspolitik, deren Scheitern seit langem offensichtlich ist“ (Hickel 2015, 61). Dass die EU „jenen alten falschen Kurs fort(setzt), den Staat zu Lasten der Gesamtwirtschaft zu schrumpfen und dabei den ökonomischen Absturz zu produzieren“ (ebd.), führt der Ökonom auf eine „sture Disziplinierungsdoktrin der Geldgeber“ (ebd., 66) zurück. Die EU-Politiker versperrten sich „der notwendigen Erkenntnis, dass die bisherige Politik gescheitert ist – auch weil sie an der Leitidee des handlungsunfähig gemachten Staates festhalten“ (ebd.). Letztlich erscheint das, was praktiziert wird, als ein einziges Zerrbild wirklicher politischer Gestaltung: Ökonomisch jenseits jeder Vernunft, politisch destruktiv agieren Europas Macher und ruinieren nicht nur das Leben ganzer Völker, sondern ihre eigene demokratisch-marktwirtschaftliche Basis, und zwar nur, weil sie stur an einer irrwitzigen Doktrin festhalten.
Dass das nicht stimmen kann, ergibt sich schon aus der vorstehenden Bilanz der linken Anstrengungen, den „Fall Griechenland“ zum Thema einer Gegenöffentlichkeit zu machen. Wie gezeigt, lassen sich die Anstrengungen auf weite Strecken von Wunschbildern leiten. Die Sache selber, die in Europa realisiert wird, interessiert wenig, die Möglichkeit eines sich abzeichnenden Auswegs aus der Misere dagegen brennend. Und dass dieser Weg nicht wie erhofft beschritten wird, bringt solchen Kommentaren und Einschätzungen die praktizierte Politik nur so ins Blickfeld, dass sie als Verhinderung einer eigentlich gebotenen Besserung erscheint (ein solidarisches Europa, in dem die Völker nicht gegeneinander aufgestellt sind, sondern die Starken den Schwachen helfen; eine Ökonomie, die keine Dis-, vielmehr Proportionalitäten produziert; ein europaweit ausgeglichenes nationales Wachstum, das Arbeitsplätze, aber keine Geschäftsgelegenheiten fürs Finanzkapital schafft; eine wirkliche europäische Wertegemeinschaft, die anderen Regionen hilft, statt…). Immerhin ist mit dem kritischen Gegenlesen der offiziellen Versionen genügend Material auf den Tisch gekommen, aus dem sich die politökonomische Logik des Vorgangs entnehmen lässt. Auf die Erarbeitung solchen Materials stützte sich auch die Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ (GS), die zum Frühjahr 2010 ihre erste Analyse zu „Griechenlands Staatsbankrott“ (GS 1/10) vorlegte; eine Auswahl der seitdem erschienenen Texte fasst jetzt der Sammelband von J. Köper und U. Taraben (2015) zusammen (eine Übersicht über die Veröffentlichungen zum Thema Griechenland und Eurokrise bietet zudem die Website www.gegenstandpunkt.com unter der Rubrik „Aktuelle Themen“).
Auch hier ging es mit der Zurückweisung der Ideologie los, die sich als herrschende Erklärung der hellenischen Pleite etabliert hat: dass nämlich diese das Resultat der dortigen Misswirtschaft sei – alle, Staat und Volk, hätten rücksichtslos „über ihre Verhältnisse gelebt“ – und dass damit letztlich ein Fremdkörper in der Europäischen Union solide wirtschaftender Standorte die gerechte Antwort für sein im Grunde illegales Verhalten kassiert habe. Demgegenüber wies der „Gegenstandpunkt“ nach, dass es sich bei Griechenlands EU-Auftritt nicht um einen un- oder außereuropäischen Sonderfall handelt, sondern um ein Resultat der Konstruktion, die dem europäischen Staatenbündnis, seiner Wirtschafts- und Währungsunion zu Grunde liegt. So weit gibt es wohl auch eine Übereinstimmung mit den Befunden der linken Gegendarstellungen. Die GS-Analyse legte dann aber Wert darauf, dass die Ursache im EU-Konstruktionsprinzip selber zu finden sei und nicht in einer neoliberalen oder marktradikalen Verzerrung, die dem angeblich auf Zusammenhalt und Verständigung hin angelegten Europaprojekt widerfahren sei.
Die drei Kernthesen, die jetzt auch die Eröffnung des neuen Bandes bilden und dort ausführlich begründet werden, lauten: (1) Der Bankrott Griechenlands ist die – angesichts des von ihm eingebrachten Wettbewerbspotenzials – sachgerechte Quittung dafür, dass das Land der EU samt Währungsunion beigetreten und den damit verbundenen Anforderungen an seine Nationalökonomie nachgekommen ist. (2) Der Staatsbankrott ist die ebenfalls sachgerechte Reaktion des Finanzgewerbes auf den gigantischen Aufwand, den die Euro-Staaten zur Rettung dieses „systemrelevanten“ Gewerbes nach der großen Krise von 2007ff erbracht haben, und ein erster Offenbarungseid über den unauflöslichen Widerspruch der Währungsunion, nämlich die in nationaler Konkurrenz betriebene Bilanzierung des gemeinsam emittierten und benützten Kreditgeldes. (3) Um das weitere Funktionieren des Euro-Systems zu retten, dementieren die EU-Führungsmächte, allen voran Deutschland, den politökonomischen Inhalt der griechischen Finanzkrise und demonstrieren „den Märkten“, dass der Bankrott eine isolierte Entgleisung darstelle und durch eine bessere Haushaltspolitik zu bereinigen sei – mit der Konsequenz: „Den Griechen fällt die unlösbare Aufgabe zu, ihren Staat durch Verelendung wieder kreditwürdig zu machen.“ (GS 1/10, 121)
Allgemeiner gesagt heißt das: Der Fall Griechenland zeigt einen Krisenfall des Weltkapitalismus an, der allerdings von den politisch Verantwortlichen, einem Staatenbündnis konkurrierender Souveräne, per Lokalisierung zu lösen versucht wurde, was gleichzeitig den Streit um die Führungsfrage im Bündnis voranbrachte. Dass Griechenland ins Visier der Finanzspekulation geriet – mit der Herabstufung durch die Rating-Agenturen fing die Notlage an –, könnte man (wenn man an Gerechtigkeit glaubt) als höchst ungerecht beklagen, denn das Land hatte seinen Staatskredit zur Rettung der Banken gar nicht übermäßig strapaziert. Es erwies sich nur als der unterlegene Teilnehmer an der durch Binnenmarkt und Gemeinschaftsgeld entfesselten Konkurrenz der europäischen Kapitalstandorte. Und seine „Rettung“, die 2010 in Gang kam, war der Sache nach gar nicht so sehr auf diesen speziellen Fall bezogen, sondern eine – komplex angelegte – Abwehr jeder Art von Anti-Euro-Spekulation. Sie fand in der griechischen Regierung einen willigen Mitmacher, dem die Rettung seines Kredits in gleicher Weise notwendig erschien, auch wenn ihm einiges an Verelendung seines Volkes und – weit wichtiger – an Beschränkungen staatlicher Wachstumsförderung zugemutet wurde.
Davon ausgehend folgten dann in der Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ regelmäßig Untersuchungen, die sich der Krisenbewältigung in den Zentren des Kapitalismus widmeten, speziell natürlich den europäischen Entscheidungen in Sachen ESM und erneuerter Stabilitätspakt, dem Streit um Rettungspakete und konkrete Reformforderungen an die Adresse der südeuropäischen Problemstaaten sowie um Fragen der Führung und Unterordnung. Das Stichwort lautete „imperialistische Geldsorgen“ (vgl. GS 2/11 mit Beiträgen zu den USA und zur EU). Es zielte auf den Tatbestand, dass mit dem Euro zu Beginn des neuen Jahrhunderts dem Weltgeld Dollar ein Konkurrent gegenüber getreten war, der nach der Finanzkrise seine erste große Bewährungsprobe zu bestehen hatte. Dieser europäische Aspirant auf die Weltgeldrolle war das wirkliche Objekt des deutsch-europäischen Rettungseifers – ganz im Sinne von Merkels berühmter Ansage, man wolle stärker aus der Krise herauskommen, als man in sie hineingegangen sei. Und dieses Rettungsaufgabe folgte ihrer eigenen finanzkapitalistischen und imperialistischen, d.h. auf die Benützung und Funktionalisierung auswärtiger Staatsgewalten gerichteten Logik. Dafür – und das ist die ökonomische Vernunft, die in einer globalisierten Marktwirtschaft waltet – mussten die Wachstumsnotwendigkeiten des griechischen Standorts und die Lebensnotwendigkeiten der dort ansässigen Bevölkerung brutal zurückgestellt werden.
Die weiteren Analysen des „Gegenstandpunkt“ zur Krisenbewältigung in den Jahren 2013 und 2014 (nachzulesen etwa in GS 2/13 zum Fall Zypern oder in GS 4/14 zur gesamteuropäischen Krisenlage) zielten auf diesen Punkt: Aus der übergeordneten, imperialistischen Sorge ums Gemeinschaftsgeld erwuchsen Härten, die den weniger wettbewerbsfähigen Standorten Europas schwer zu schaffen machten. Hier war es vor allem die deutsche Politik, die jedem Vorschlag, nach wirtschaftspolitischen Alternativen zu suchen, eine Absage erteilte. Dabei war sie nicht „verblendet“ oder in einem neoliberalen „Wahn“ befangen: Die ökonomisch Logik ihrer Kontrahenten konnte sie damit kontern, dass deren Programm gerade keine Garantie eines sich selbst tragenden, nachhaltigen Wachstums versprechen könne, im Gegenteil zur weiteren Schwäche des Euro beitrage. Und dessen Stärke bzw. die staatliche Partizipation an solcher Geldmacht ist ja das Lebenselixier der famosen europäischen Wertegemeinschaft, die keinen zum Eintritt zwingt, sondern von jedem auf nationale Führung abonnierten Politiker als große Chance begriffen wird. So hat sich ja auch – nachdem Anfang 2015 mit Syriza eine neue Regierungsmannschaft angetreten war, die die Beschädigung ihres Gemeinwesen nicht länger hinnehmen wollte – die Union zu dem gemeinschaftlichen Beschluss aller Mitglieder vorgearbeitet, dass die Stärke des Euros alle Opfer verdiene. Selbst die oppositionelle, „linksradikale“ Syriza-Regierung hat sich zu dieser Einsicht vorgekämpft und gewissermaßen – wie damals Schröder mit seiner Agenda und jetzt Merkel mit ihren Flüchtlingen – aus höherem nationalen Interesse eine Entscheidung getroffen, die beim Wahlvolk nicht unbedingt gut ankommt. Für das Syriza-Bündnis hat der Schwenk – zunächst jedenfalls – kein Desaster bedeutet, woran man sieht, welche Handlungsfreiheit die Demokratie ihrer Herrschaft zur Verfügung stellt und welche Folgsamkeit sie bei ihren Untertanen herbeiführen kann. Nicht zuletzt hat ja das Griechenland-Kapitel in der EU einige Lektionen dazu erteilt, was Demokratie für die Bewältigung kapitalistischer Krisen leistet, wie man sie zu gebrauchen und vor Missbrauch zu schützen hat. Diese vorerst letzte Etappe im Rettungstheater hat der „Gegenstandpunkt“ 2015 in zwei großen Untersuchungen – unter dem Motto „An Griechenland wird ein Exempel statuiert“ – zum Thema gemacht (die beiden Beiträge sind in dem Band von Köper/Taraben enthalten und bilden dort mit einem kürzeren Text zur Rolle der deutschen Linken den Schlusspunkt). Der Beitrag der hiesigen politischen Öffentlichkeit, also – siehe die einleitenden Bemerkungen – des in allem Pluralismus selbstbewusst gleichgeschalteten Medienbetriebs, wird dabei mit abgehandelt.
Literatur
- Richard Aabromeit, Vor welcher Wahl steht Griechenland nach der Wahl? Πἁντα ῥεῖ – nur in Griechenland nicht. In: Exit (2015): http://www.exit-online.org.
- Aus Politik und Zeitgeschichte – Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament: Griechenland. Nr. 35-37, 2012.
- Joachim Bischoff/Björn Radke, SYRIZAS politischer Auftrag und die Strategiedebatte der Linken. In: Sozialismus, Nr. 10, 2015a, S. 2-6.
- Joachim Bischoff/Björn Radke, „Isch over“? Griechenland und die Eurozone – Syrizas Kampf gegen die neoliberale Hegemonie. Hamburg 2015b.
- Faktencheck: Hellas. Nr. 1, April 2015.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Zweierlei Absagen an den Supranationalismus der deutschen Europapolitik. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2015, S. 61-71.
- Fabian Georgi/John Kannankulam, Kräfteverhältnisse in der Eurokrise – Konfliktdynamiken im bundesdeutschen ‘Block an der Macht’. In: Prokla, Nr. 180, 2015, S. 349-369.
- Jürgen Habermas, Zur Verfassung Europas – Ein Essay. Berlin 2011.
- Rudolf Hickel, Rettet Griechenland! In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9, 2015, S. 61-67.
- Ulrich Irion, Zur marxistischen Debatte über Staat und Wirtschaft. In: Johannes Schillo (Hrsg.), Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Hamburg 2015, S. 151-176.
- Ulf-Dieter Klemm/Wolfgang Schultheiss (Hrsg.), Die Krise in Griechenland – Ursprünge, Verlauf, Folgen. Frankfurt/M. 2015. (Auch als Band 1608 in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen.)
- J. Köper/U. Taraben, Der Fall Griechenland – Fünf Jahre Krise und Krisenkonkurrenz. Europa rettet sein Geld – die deutsche Führungsmacht ihr imperialistisches Europa-Projekt! München 2015.
- Gregor Kritidis, Griechenland – auf dem Weg in den Maßnahmestaat? Autoritäre Krisenpolitik und demokratischer Widerstand. Hannover 2014.
- Gregor Kritidis, Kein Ende des Ausnahmezustandes – Das Ringen der griechischen Regierung mit der Eurogruppe um die Austeritätspolitik nähert sich dem Wendepunkt. In: Sozilastische Positionen, Nr. 6, 2015, S. 1-6, www.sopos.org.
- Oskar Lafontaine, Kolumne Nr. 1: Diesmal zu den Wahlen in Griechenland. In: Nachdenkseiten, 21.9.2015, www.nachdenkseiten.de.
- Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie: banknix – grexit. Nr. 30, 2015.
- Andreas Nölke, Abschied vom Euro? Europas Linke nach der Griechenlandkrise. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9, 2015, S. 68-76.
- Jörg Roesler, Was schief gelaufen ist. In: Neues Deutschland, 3.7.2015.
- Karl-Heinz Roth, Griechenland am Abgrund – Die deutsche Reparationsschuld. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage, Hamburg 2015.
- Thomas Sablowski, Die Etappenschlappe. In: Junge Welt, 18./19.7.2015, S. 12-13.
- Yanis Varoufakis, Rettet den Kapitalismus. In: WOZ, Nr. 9, 2015.
- Widerspruch – Beiträge zur sozialistischen Politik: Finanzmacht – Geldpolitik. Nr. 66, 2015.
- Wildcat, Der linke Reformismus ist eine klare Verliererstrategie. In: Wildcat Nr. 98, 2015, www.wildcat-www.de/index.htm.
- Z-Redaktion, Griechenland: Aus Niederlagen lernen. In: Z – Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Nr. 103, September 2015, www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de.
September 2015
Arbeitsmarkt und „Ausländerproblem“
Dem in Privatinitiative tätigen „Dunkeldeutschland“ hat die deutsche Politik mit ihrer „Willkommenskultur“ den Kampf angesagt. Ausländerfeindlichkeit, wie sie hierzulande herumwest oder per Facebook einsickert, gilt zur Zeit als eine einzige Störung: Dass Ausländer „uns“ die Arbeitsplätze wegnehmen, ist out; dass sie Deutschland bereichern, ist in. Hierzu bringt Johannes Schillo einiges aus den Debatten der letzten Jahre in Erinnerung.
„Fremdenfeindlichkeit ist eine Krankheit… sie ist ansteckend. Und sie kommt – wie es scheint – immer wieder zum Ausbruch. Wenn Menschen jegliche Selbstbeherrschung verlieren, sobald von Ausländern, Flüchtlingen, Asylbewerbern die Rede ist, möchte ich eher Ärzte zu Hilfe rufen als Polizisten“, schreibt Stefan Berg im „Spiegel“-Leitartikel (Berg 2015) und bringt damit schon fast die ganze Nachdenklichkeit der Leitmedien auf den Punkt. Währenddessen geht die Politik mit Polizei und Justiz gegen die Störenfriede vor und überlegt, welche Möglichkeiten von NPD-Verbot und Weiterem sich bieten. Nebenher kommen Experten zu Wort, zählen das Ausmaß des dunklen Deutschlands nach, beleuchten die Hintergründe etc. Auch hier läuft es meist auf ein quasi-therapeutisches Programm für den Volkskörper hinaus: Man müsse sich, wie der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über das neue, zufällig am Ausländer festgemachte Angstsyndrom schreibt (2015), in der Politik jetzt darauf konzentrieren, „die Angst wieder aus der Mitte der Gesellschaft herauszubringen.“
Die Bildzeitung, die sich in den 1990er Jahren als Sprachrohr der besorgten Bürger verstand, steht heute voll auf Seiten der „Willkommenskultur“. Der Pädagoge Klaus-Peter Hufer, der ein „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ entwickelte (vgl. Hufer 2001, 2006), lehnte seinerzeit das – aus seiner Sicht – heuchlerische Angebot der Bildzeitung ab, in dem Blatt mit einer Kolumne anzutreten, die dem Bürger seine Sorgen nimmt. Anno Domini 2015 macht „Bild“ selber das Argumentationstraining für seine Leser, in großen Lettern auf Seite eins und zwei: „Jobs, Kriminalität, Geld – 7 Wahrheiten über Flüchtlinge… BILD entlarvt die sieben Lügen über Asylbewerber, sagt, wie es wirklich ist.“ (27.8.15) Marei Pelzer von Pro Asyl resümiert: „In den Medien überwiegt ein sachlicher Ton“ (Pelzer 2015, 8). Und für die legendäre Zivilgesellschaft konstatiert Ralf Schröder erstaunlich zuversichtlich in „Konkret“, dass sich „eine Anzahl von Initiativen und Projekten entwickelt (hat), die den ankommenden Flüchtlingen ein Willkommen signalisieren wollen.“ (Schröder 2015, 12). Besteht also Grund zur Hoffnung, dass dieses Mal die Vernunft siegt? Dazu müsste man allerdings erst einmal eine vernünftige Erklärung der verbreiteten Ausländerfeindlichkeit leisten!
Marktradikalismus, Standortnationalismus
Wenn man Ausländerfeindlichkeit als ein allgemeinmenschliches Krankheitsphänomen nimmt, das – siehe den Sündenbockritus – bis in biblische Zeiten zurückreicht (so Berg 2015), entkleidet man sie ihres politischen Gehalts und verwandelt sie in einen abstrakten psychologischen Mechanismus. Diese Art von Ursachenforschung ist in bestimmten wissenschaftlichen Abteilungen beliebt, sie gibt es teilweise auch in der Linken. Anders verfährt die Erklärung des Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge, der nach dem legendären „Aufstand der Anständigen“ von 2001 mit einer Reihe von Publikationen auf die neue Welle von Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit im vereinten Deutschland einging. In seiner Publikation „Rechtsextremismus“ (2002) kritisierte Butterwegge theoretische Konzepte, die – getreu dem Extremismusansatz – vom Rand der Gesellschaft ausgehen. Dem stellte er seine eigene Erklärung gegenüber, die die Gründe für die Entstehung rechtsextremer Tendenzen in der „Mitte der Gesellschaft“ lokalisierte: Nicht in randständigen Extremen, die sich dann auch noch auf dem rechten und linken Pol berühren sollen, sondern in den sozioökonomischen Krisenerscheinungen einer freigesetzten Konkurrenzordnung, Stichwort: „Marktradikalismus“, und – seit Ende des 20. Jahrhunderts – im Prozess der Globalisierung sowie im dazu gehörigen politisch-kulturellen „Standortnationalismus“ liegen demnach die Triebkräfte für den modernen Rechtsextremismus. Im Grunde bilde die ultrarechte Programmatik eine zugespitzte Variante des Marktfundamentalismus.
Butterwegge unterschied dabei freilich zwischen der Globalisierung an sich, die zu begrüßen sei, und ihrer neoliberalen Erscheinungsform, die zu einem Standortsicherungsprogramm mit Sozialabbau und verschärfter gesellschaftlicher Ausgrenzung führe – eine durch die offizielle Politik gewollte Linie, die zum Einfallstor von Sozialdemagogie und autoritär-militaristischen Konzepten rechter Kreise werde. Der Politikwissenschaftler machte dies in der Folge mehrfach zum Thema. Er richtete sich damit auch gegen die Erklärung, wie sie der Erziehungswissenschaftler Freerk Huisken seit Anfang der 1990er Jahre vorgetragen hatte (vgl. Huisken 1993, 2001); diese ist mit der Überschrift der beiden Bände „Nichts als Nationalismus“ auf den Punkt gebracht. Huisken hat dies mit verschiedenen Diskussionsbeiträgen fortgeschrieben (vgl. zur jüngeren Entwicklung Huisken 2012). Seine grundsätzliche Position formulierte er so: „Die demokratische Form der Verwaltung einer kapitalistisch verfassten und weltweit erfolgreichen Ökonomie bringt regelmäßig (neue) Faschismen hervor… der demokratische Schoß ist und bleibt ‚fruchtbar‘. Punkt!“ (ebd., 10).
Nationalismus ist nicht gleich Nationalismus, hieß dagegen Butterwegges Grundthese; man müsse zwischen einem emanzipatorischen und einem rassistischen Nationalismus trennen. Nur letzterer sei als Element des modernen Rechtsextremismus einzuordnen. Für die aktuelle Lage sei vor allem der Prozess der Globalisierung einzubeziehen. Zwischen dem Neoliberalismus und dem Rechtsextremismus bestehen laut Butterwegge signifikante Übereinstimmungen, indem beide Denkstrukturen dazu tendierten, Höchstleistungen zu verabsolutieren – „sei es des einzelnen Marktteilnehmers oder der ‚Volksgemeinschaft’ insgesamt“ – und die Durchsetzung des Starken gegenüber dem Schwachen in der Konkurrenz zu glorifizieren (Butterwegge u.a. 2008, 205f). Je stärker insbesondere die Verlierer der Modernisierung unter der „sozialen Kälte einer Markt-, Hochleistungs- und Konkurrenzgesellschaft“ leiden, umso mehr sehnten sie sich nach „emotionaler Nestwärme“, die von rechtsextremistischer Gesinnung versprochen werde (ebd., 210). Durch die verschärfte Konkurrenz auf den Weltmärkten, die soziale Polarisierung, die partielle Renationalisierung des öffentlichen Diskurses und die Tendenz zur Biologisierung und Ethnisierung sozialer Beziehungen böten neoliberale Entwicklungen zahlreiche Anknüpfungspunkte für rechtsradikale Orientierungen.
„Standortnationalismus“ lautet somit – kurz gefasst – die Formel für den neuen Aufschwung des Rechtsradikalismus. Butterwegge hat dies anlässlich der Debatte um „Dunkeldeutschland“ wieder hervorgehoben. In einem aktuellen Essay für die „Junge Welt“ schreibt er, man müsse bei der Analyse auf „drei Untersuchungsebenen ansetzen: auf der ökonomischen, der gesellschaftlichen und der politischen.“ (Butterwegge 2015) Er selbst plädiert dann für ein „Erklärungsmodell, das von der Konkurrenz als entscheidender Triebkraft des Wirtschaftssystems ausgeht… Rückt die Konkurrenz in den Mittelpunkt zwischenstaatlicher und -menschlicher Beziehungen, so lässt sich die ethnische bzw. Kulturdifferenz politisch aufladen.“ (Ebd.) Als Konsequenz ergebe sich dann die „Förderung einer neuen Kultur der Solidarität… Das längerfristige Ziel sollte eine inklusive Gesellschaft sein.“ (Ebd.)
Auffällig ist: Die Forderung nach mehr gesellschaftlicher Inklusivität gerät ziemlich in die Nähe der offiziell angesagten „Willkommenskultur“, die das gute, helle Deutschland vom dunklen absetzen und so die Güte der Nation hervorheben will. Bevor man sich aber mit solchen Konsequenzen auseinander setzt, sollte man sich Klarheit bei der Ursachenforschung verschaffen. Dafür ist es grundlegend, auf die Rolle nationaler Arbeiterklassen im Rahmen der globalisierten Konkurrenz einzugehen. Zur Klärung kann eine Analyse beitragen, die Autoren der Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ 2002 in dem Band „Das Proletariat“ vorgelegt haben (vgl. Decker/Hecker 2002, 239-244). Im Folgenden sollen diese Überlegungen, die sich mit dem internationalisierten Arbeitsmarkt befassen, referiert werden – als Anstoß dazu, die Debatte fortzuführen. Dies ist auch deshalb notwendig, weil in den aktuellen Auseinandersetzungen um die Zuwanderung in Deutschland der Verweis auf die industrielle Reservearmee und den Druck, den sie auf die Beschäftigten ausübt, schnell als Rechtsradikalismus abqualifiziert wird – so z.B. in „Hart, aber fair“ (ARD, 14.9.2015), wo der Marx-Experte Münkler auch noch die Erkenntnis beisteuerte, die Theorie von der Reservearmee sei „Vulgärmarxismus“. Wie könnte also eine nicht-vulgäre marxistische Erklärung aussehen?
Proletariat und Subproletariat
Peter Decker und Konrad Hecker resümieren im fünften Teil ihrer Abhandlung über „die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse“ – sie steht unter den Stichworten „politisch emanzipiert, sozial diszipliniert, global ausgenutzt, nationalistisch verdorben“ – die Rolle des dienstbaren Volks als Instrument im weltumspannenden Konkurrenzkampf der Kapitalisten und Nationen. Die Politik sorge unter den heutigen Bedingungen einerseits mit dem Ausländerrecht für die Reproduktion der Arbeiterklasse, andererseits damit, dass sie sich der „demographischen Herausforderung“ stelle, sich also mit einer entsprechenden Familienpolitik um das „Bedürfnis nach einheimischem Nachwuchs, nach natürlicher Regeneration des quasi von Natur aus staatseigenen Menschenschlags“ (Decker/Hecker 2002, 245) kümmere, ja dies als bindenden Auftrag für ihr Volk deklariere. Wo sich in Folge dieser widersprüchlichen Betreuung des Arbeitsvolks „proletarischer Rechtsradikalismus“ (ebd., 248) bemerkbar macht, stehe die Polizeigewalt bereit. Demokratische Regierungen demonstrieren hier ja – wie aktuell in der Kampagne gegen das dunkle Deutschland – ihre starke Hand. Sie machen gegenüber den Rechten deutlich, dass sie „sich von rechts nicht so leicht überholen (lassen)“ (ebd., 248).
Worin besteht nun die genannte Reproduktionsleistung? Decker/Hecker erinnern eingangs daran, dass die Wirtschaft in den kapitalistischen Metropolen nicht bloß wohlfeile exotische Spitzenkräfte gut gebrauchen kann. „In gewissen Abteilungen entwickelt sie,“ so heißt es (ebd., 239), „ungeachtet 10- und höher-prozentiger Arbeitslosenraten, großen Appetit auf Arbeitskräfte aus den Elendsregionen der mit grenzenloser Marktwirtschaft gesegneten Staatenwelt, die in zunehmender Masse den Weg in die Zentren des Weltgeschäfts suchen und auch finden. Denn diese modernen Vagabunden sind ganz besonders billig zu haben, weit unterhalb des überkommenen Entlohnungs- und Versorgungsniveaus. Dank diesem Vorzug sind sie in etlichen Branchen und Regionen bereits zum unentbehrlichen 'Wirtschaftsfaktor' geworden.“ Diese Nützlichkeit, ja Unentbehrlichkeit wird auch in der aktuellen Debatte über die Flüchtlingswelle herausgestellt; sie soll Verständnis hervorrufen, zudem ein Kriterium für die Sortierung der hereinströmenden Menschen abgeben.
„Der soziale und humanitäre abendländische Rechtsstaat hat an diesem Zustand maßgeblich mitgewirkt. Er wirbt solche Kräfte schon längst nicht mehr an; im Gegenteil: Er begegnet dem 'Phänomen' der 'modernen Arbeitsmigration' – auch so höflich lässt sich über die verzweifelten Bemühungen einer vergleichsweise bessergestellten, jedenfalls aktiven Minderheit aus den Armutsquartieren der Welt um einen Überlebenschance in den USA oder der EU daherreden – erst einmal restriktiv, mit Schließung seiner Außengrenzen für solche nicht bestellten Zuzügler und Abschiebung, wenn sie es trotzdem schaffen. Er wehrt sich auf diese Art gegen die Einwanderung von Bruchteilen des menschlichen Elends, das nicht zufällig zu Beginn des 3. Jahrtausends so massenhaft ausfällt – der definitive Siegeszug der von ihm machtvoll vertretenen und verbreiteten marktwirtschaftlichen Sitten und Gebräuche, verbunden mit der Zerrüttung der Existenzbedingungen in ziemlich vielen Ländern der Welt, hat dafür gesorgt und sorgt für Nachschub. Er wehrt sich; denn unproduktive Armut hat er schon in seiner angestammten Gesellschaft nach eigener Einschätzung mehr als genug zu verwalten…“ (ebd., 239). Deshalb hat z.B. die deutsche Politik im Wahljahr 2013 die Armutseinwanderung von Roma aus Bulgarien und Rumänien oder vom Balkan explizit als nationales Problem ausgerufen (vgl. Decker 2013).
„Vor allem seine sozialpolitische Schadensbilanz und Nutzenkalkulation fällt grundsätzlich gegen das wandernde Elend aus, das – nach den goldenen Worten eines christlichen bayerischen Innenministers – 'uns' nichts nützt, sondern 'uns nur ausnutzt'. Hinzu kommt eine eher noch wichtigeres Kriterium abendländischer Menschlichkeit, das man schon deswegen nicht 'völkisch' nennen darf, weil es das zwar ist, der Hitler diesen Ausdruck aber in Verruf gebracht hat: Das 'staatspolitische' Bedürfnis nach einem Staatsvolk mit einwandfrei angeborener 'nationaler Identität' gebietet die Fernhaltung und Entfernung von Leuten, die mit ihrem exotischen Inneren und Äußeren die 'Aufnahmebereitschaft' und 'Toleranz' christlich aufgeklärter Zeitgenossen überfordern – jedenfalls nach den Feststellungen der demokratisch regierenden Herren, die die Meinung ihres Volkes am effektivsten dadurch bilden, dass sie sich für ihre entsprechende Praxis darauf berufen.“ (Decker/Hecker 2002, 239f)
Dies ist der politische Standpunkt, der in der längst süd- und osterweiterten EU gilt. Decker/Hecker gehen dann aber darauf ein, dass sich, was den ökonomischen Standpunkt des Kapitals betrifft, durchaus andere Rechnungen finden lassen: „Mit dem marktwirtschaftlichen Konkurrenzkalkül großer Teile der nationalen Arbeitgeberschaft stimmt diese Politik der gnadenlos geschlossenen Grenzen jedoch nicht überein. Ehrbare Handwerker und Gastwirte, Bauunternehmer und Bauern, Reinigungs- und Altenpflege-Unternehmer – fast durchwegs Musterexemplare eingeborenen Volkstums! – brauchen Handlanger, die fast zum Nulltarif jeden Dreck wegmachen; und sie wissen sich ihr Personal auch zu verschaffen. So kommt es, dass der 'globalisierte' Rechtsstaat mit seiner gesetzlichen Fremdenfeindlichkeit etwas ganz anderes erreicht als eine saubere Sortierung der 'Ethnien'. Auf seinem kapitalistisch so erfolgreichen Standort hausen ganze Heerscharen von Arbeitskräften, die auf Grund ihres besonderen ausländerrechtlichen Status – als Illegale, Geduldete, 'Schein-Asylanten', Schein-Touristen, anerkannte Saisonarbeiter, EU-Anschlusskandidaten, Leute mit befristetem oder vorläufig unbefristetem Aufenthaltsrecht usw. – einen ganz speziellen sozialen 'Stand' bilden: Sie sind die unterste Abteilung des jeweiligen nationalen Proletariats, dabei wieder untereinander je nach ihrer Rechtsstellung hierarchisch sortiert. Politökonomisch gehören sie allesamt zur Arbeiterklasse ihres 'Gastlandes'; als deren Billig-Komponente, die auf niedrigstem Niveau, zu billigsten Löhnen, ohne die ansonsten noch übliche vom Sozialstaat eröffnete Aussicht auf eine lebenslange Reproduktion, einer besonderen Gruppe kapitalistischer Arbeitgeber zu Profiten verhilft – ungefähr so, wie reformeifrige Sozialpolitiker es sich für ihre herkömmlichen Arbeitslosen und Sozialhilfe-Empfänger vorstellen! Sie realisieren längst, und zwar idealtypisch, den 'Niedriglohnsektor', den die Freunde umfassender 'Beschäftigung' erst einrichten wollen.“ (Ebd., 240)
Die letzte Bemerkung ist heute natürlich überholt. Die Analyse der beiden Autoren erschien 2002, als die Agenda 2010 in Vorbereitung war. Im Januar 2005, Hartz IV war gerade in Kraft getreten, pries Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine Arbeitsmarktreform: „Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“ (Zit. nach FR online, 8.2.2010) Mittlerweile, zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der Reform, ist der Niedriglohnsektor fester Bestandteil des deutschen Lohngefüges und mit einer gesetzlichen Mindestlohn-Regelung gekrönt. Die weiteren Ausführungen von Decker und Hecker halten dann die allgemeinen Bestimmungen fest, die auch für die aktuelle Lage relevant sind. Die ausländerrechtlich abgesonderten Teile der Arbeiterschaft tragen demnach „zur Verringerung der nationalen Durchschnitts- und Gesamt-Lohnkosten für die Produktion des nationalen Durchschnitts- und Gesamt-Profits bei; helfen mit, den allgemeinen und durchschnittlichen proletarischen Lebensstandard im Lande zu senken; setzen Maßstäbe für die Behandlung, die eine nützliche Arbeiterklasse, zumindest in ihren unteren Segmenten, sich allmählich wieder gefallen lassen muss. Folgerichtig nimmt in dieser durchs Ausländerrecht definierten Unterabteilung die proletarische Armut zuerst und wie in einer Ausschnittsvergrößerung all die groben Erscheinungsweisen an, die im Zuge der Revision des bürgerliche Sozialstaatswesens insgesamt, auch unter den bislang so 'überversorgten' Lohnarbeitern, einreißen: Im Arbeitsleben sind sie der Willkür ihrer Chefs ausgeliefert; die Arbeitsbedingungen lassen sich praktisch beliebig verschlechtern. Ihr Privatleben spielt sich in verwahrlosten Gettos ab; die nachbarschaftliche und familiäre Idylle, sofern überhaupt vorhanden, wird mit klassischen und modernen Betäubungsmitteln durchgestanden. Der Nachwuchs hat es schon weit gebracht, wenn er lesen und schreiben kann; Fernziel ist der Hauptschulabschluss. Grenzen zum alteingesessenen Subproletariat sind fließend, am unteren Ende in der Lebensführung überhaupt nicht mehr auszumachen.“ (Decker/Hecker 2002, 241) In dem Text klingt auch eine gewisse moralische Entrüstung übers „Lumpenproletariat“ an, die schon bei Marx zu spüren war. Derartiges sollte man besser unterlassen. Rein sachlich gesehen ist es ja so, dass der Griff zu Betäubungsmitteln ebenfalls für Hochleistungsarbeitnehmer, die in ihrem Job alles geben, zur Notwendigkeit wird.
Hinzu kommt, dass für viele Migranten – worauf Thilo Sarrazin mit seiner Hetze zielte – der Griff zur Ersatzdroge, nämlich zum „Opium des Volkes“ in Gestalt muslimischer Normal- oder Strenggläubigkeit, zum Halt wird, mit dem sie ihren Alltag durchstehen. So kann das Elend dann sogar wieder zivile Formen annehmen (und progressive, denn angeblich gibt es seit Neuestem auch eine „muslimische Befreiungstheologie“). Das Resümee von Decker/Hecker zum „Pauperismus“ – also zu den Endresultaten kapitalistischer Verelendung, die in der heutigen Sozialwissenschaft unter Namen wie „Prekariat“ oder „Unterschicht“ klassifiziert werden (zu den Problemen der Klassifizierung vgl. Dörre 2015) – hält die grundlegenden Punkte fest, die auch für die aktuelle Debatte wichtig sind.
„Die Ausländergesetze, mit denen die Staaten der '1. Welt' einerseits den globalen Pauperismus von sich fernhalten, andererseits doch auch Varianten der Duldung unerwünschter Zuwanderer kodifizieren, bewähren sich somit als Rechtsgrundlage für die Reproduktion einer nicht ganz unbedeutenden Abteilung der Arbeiterklasse dieser Staaten. Sie bewirken die Regeneration einer Sorte produktiver Armut, die nie ausgestorben, deren Erscheinungsbild aber doch weitgehend wegreguliert war, deren allmähliche Verallgemeinerung nunmehr in Planung ist – und die auffällig an den ältesten, nämlich ersten Normalfall proletarischer 'Daseinsgestaltung', im 'Manchester' des 19. Jahrhunderts erinnert.“ (Decker/Hecker 2002, 241) Auch hier wäre natürlich anzumerken, dass man am Standort D inzwischen über die Planungsphase weit hinaus gekommen ist – nicht zuletzt die neu aufgekommene Armutsforschung legt davon Zeugnis ab und zieht vielfältige Parallelen zum „Manchester-Kapitalismus“. Über die Rolle der Politik heißt es weiter:
„Für die Armut selbst und ihre produktive Ausnutzung auf brutalst-möglichem Niveau sorgt – wie seinerzeit – das Kapital mit seinem speziellen Bedarf an besonders unbedarften Arbeitskräften; der Staat organisiert den Nachschub an Leuten, die keine andere Überlebenschance haben, als für genau diesen Bedarf zur Verfügung zu stehen; und er tut das eben zum Einen sehr wirksam mit den toleranten Seiten seines Ausländerrechts. Zum anderen arbeitet er mit der Reform seiner Sozialgesetzgebung zielstrebig darauf hin, die Reihen der 'unteren Lohngruppen' mit einheimischen Dienstkräften aufzufüllen. Dabei wahrt er jedoch den einen, für die Verfassung seiner proletarischen Gesellschaft ganz wesentlichen Unterschied: die Unterscheidung zwischen den eigenen Bürgern, die er in Anknüpfung an seine sozialen Traditionen mit der Gewalt neuer Rechtsvorschriften in die niederen Abteilungen seines nationalen Arbeitsmarkts hineinbugsiert, und den Zuwanderern, für die eine 'Beschäftigung' in diesem 'Segment' kapitalistischer Ausbeutung eine mehr oder weniger – oder eigentlich gar nicht – geduldete Gunst darstellt, weil sie 'von Haus aus' aus der sozial betreuten nationalen Klassengesellschaft erst einmal grundsätzlich ausgeschlossen sind. Für diesen Menschenschlag gehört sich das Elend, in dem es sich herumtreibt; ihm steht von Rechts wegen nichts anderes zu – was andersherum gelesen bedeutet: Alles, was diese Leute auszuhalten und mitzumachen haben, ist gar nicht das, was es tatsächlich, seiner politökonomischen Natur nach, ist, nämlich proletarisches Elend, sondern bloß die ganz normale Rechtsfolge ihres besonderen Rechtsstatus: die spezielle und spezifische Lebenslage von unerwünscht zugewanderten Ausländern. Die anderen, die Einheimischen, werden dagegen mit einer neuen 'Beschäftigungschance' ausgestattet, auf die sie ein Recht haben. So ist es organisiert, und das gilt dann auch.“ (Ebd., 241f)
Die abschließenden Überlegungen des Kapitels gehen dann darauf ein, in welcher grundlegenden, noch gar nicht als polizeilich-juristisches Problem auffälligen Gestalt Ausländerfeindlichkeit auftritt. Mit der Implementierung des speziellen Rechtsstatus sei „zum Einen ideologisch viel erreicht. Der neubelebte Normalfall einer proletarischen Billigexistenz in all ihren drastischen Formen ist Ausländerschicksal; und das fällt schon mal überhaupt nicht dem einheimischen Kapitalismus zur Last, der diese Elendsvariante erzeugt und ausnutzt – sozialrechtlich nicht und deswegen auch nicht moralisch. Eher schon liegt da ein Fall von humanitärer Großzügigkeit vor: Die reiche Nation übernimmt freiwillig einen Anteil am drittweltlichen Elend. Deswegen geht der schäbige Umgang mit Ausländern auch nicht bloß in Ordnung, weil sowieso nichts daran zu ändern ist; man darf daran auch gar nichts ändern, soll es überhaupt erst gar nicht versuchen, weil man sonst 'den Ärmsten der Armen' ihre letzte Erwerbschance verdirbt; aber das nur nebenbei. Viel wichtiger ist die andere Klarstellung, nämlich an die Adresse der hauseigenen Fußvolks, dem es in der Sache gar nicht so viel anders geht. Das steht nämlich trotz allem mit den Ausländern, die nichts Besseres als Elend verdienen, weil sie eigentlich gar nicht her gehören, überhaupt nicht auf einer Stufe: Es gehört her und darf deswegen auch nicht so schlecht behandelt werden, wie es sich für Ausländer durchaus gehört.“ (Ebd., 242)
Dies ist, sachlich gesehen, der Punkt, an dem sich eine Reihe von linken Überlegungen festmacht: Ausländerfeindlichkeit – zumindest die distanzierte oder besorgte Haltung, die der normale Arbeitnehmer (im Unterschied zur Ausländerfreundlichkeit des kosmopolitisch orientierten Bildungsbürgertums) an den Tag legt – sei eine Art des sozialen Protestes. Soziale Forderungen oder sozialer Unmut lassen sich in der Tat auch dort finden, wo sich ausländerfeindliche Stimmung und Opposition breit machen. Erstens ist das aber nicht das Movens solchen Protests, und zweitens muss man den Charakter dieser Unzufriedenheit genauer betrachten. Decker und Hecker greifen die Vorstellung von den sozialen Konsequenzen, die der Vorrang des Eigenvolks vor dem Fremdvolk hat (oder haben sollte), so auf: „Diese frohe Botschaft ist so bedeutend, weil sie die letzte Sozialleistung darstellt, die die kapitalistischen Erfolgsnationen ihrem eingeborenen Proletariat zukommen lassen: Das Privileg, mit vollem Recht dort und dort voll im Recht zu sein, wo 'die anderen' nichts verloren haben, und sich als Rechtssubjekt aufführen zu dürfen, wo und wie man es für nötig hält – das nimmt ihm niemand weg. Freilich kann sich ein einheimischer Zeitgenosse von diesem wunderbaren Recht nichts kaufen; auch er muss zusehen, dass er mit seiner rechtmäßigen Lohnarbeit über die Runden kommt; und wenn der Sozialstaat ihn in einen extra für ihn und seinesgleichen geschaffenen Billiglohn-Sektor einweist oder als Sozialhilfefall dienstverpflichtet, dann hilft ihm seine angeborene Staatsangehörigkeit und 'nationale Identität' überhaupt nichts. Der Rechtsstatus ist und bleibt aber ein anderer; der erhebt ihn über 'die Ausländer'. Wenn ein Betroffener beim besten Willen nicht erkennen kann, inwiefern er dadurch materiell besser gestellt wäre als ein eingewanderter Prolet, dann soll er sich nur umso mehr an diese prinzipielle Seite halten, seinem gesunden nationalen Rechtsempfinden freien Lauf lassen und die entsprechende Anspruchshaltung pflegen. Statt rein materialistisch die Identität der Klassenlage zur Kenntnis zu nehmen und danach zu handeln, dürfen lohnabhängige Eingeborene dann den gebührenden Abstand zwischen sich und dem rechtlosen Strandgut von auswärts vermissen und auf erkennbare Schlechterstellung der eigenen Klassengenossen klagen – eben unter dem Gesichtspunkt, auf den ihr Staat sie andauernd mit der Nase stößt, dass die nämlich eigentlich gar nicht da sein dürften.“ (Ebd., 242f)
Das ist die ideologische Seite der Angelegenheit. Aber die Sache erschöpft sich nicht darin, denn „damit ist umgekehrt über die sozialen Perspektiven der aus dem internationalen Pauperismus rekrutierten Teile des Proletariats der kapitalistischen Metropolen schon viel entschieden. In ihrer an die Anfangszeiten des Kapitalismus gemahnenden Rechtsstellung haben sie jedenfalls keine Arbeiterbewegung auf ihrer Seite; im Gegenteil. Schon mit ihrem bloßen Da-Sein, erst recht mit jeder Forderung nach einem gesicherten Rechtsstatus und nach Angleichung ihrer Lebensbedingungen an diejenigen des autochthonen Arbeiterstandes geraten sie in Gegensatz zur Mehrheit ihrer eigenen Klasse. Die stellt sich ausgrenzend bis feindlich gegen ihre eigene Minderheit, soweit und nur weil sie per Ausländerrecht aus dem nationalen Zusammenhang herausdefiniert und ausgegrenzt ist; und sie tut das nur um so unversöhnlicher, je weniger an materiellen Unterschieden der Sozialstaat ihr noch zugesteht. Ausgerechnet dieser Staatsgewalt bleibt es überlassen, und nur sie lässt sich unter Umständen dazu herbei, die von ihr selbst geschaffene Abgrenzung zwischen in- und ausländischer Arbeitskraft und die rigide aufrecht erhaltene Ausgrenzung eigentumsloser Zuwanderer auch schon mal kritisch zu überprüfen; natürlich zuerst einmal und vor allem auf die Zweckmäßigkeit der ergriffenen Maßnahmen hin. Dabei kommt dann auch ein Gesichtspunkt zur Sprache, der schon wieder an die tiefe Einsicht erinnert, die dem 'Obrigkeitsstaat' des 19. Jahrhunderts von wohlmeinenden sozialen Denkern vorgetragen und irgendwann von seiner aufrührerischen Arbeiterklasse beigebogen worden ist: das 'Argument' der Unverzichtbarkeit des ausgegrenzten 'Abschaums'. Trotz aller Abwehr unerwünschter Immigration stellen die Zugewanderten eben doch schon, dank reichlichem kapitalistischem Interesse an ihnen und entsprechender behördlicher Duldsamkeit, einen essentiellen Bestandteil der nationalen Klassengesellschaft dar. Gerade als Billigabteilung der nationalen Arbeiterschaft sind sie längst unentbehrlich geworden; auch Standort-politisch. Experten haben, in staatlichem Auftrag sogar, den speziellen betriebswirtschaftlichen Nutzen der auswärtigen Billiglöhner volkswirtschaftlich hochgerechnet und herausgefunden, dass manche reiche Nation ohne massenhafte Zuwanderung als Kapitalstandort auf den absteigenden Ast gerät – fürs hartgesottene öffentliche Gemüt scheint sich die Rente, für die irgendwann niemand mehr mit Beitragszahlungen aufkommt, ganz besonders gut zur Bebilderung dieser drohenden Katastrophe zu eignen, hilfsweise auch das Bild von der Nation als Altersheim, dessen Insassen auf philippinische Pflegerinnen angewiesen sind. Wenn also feststeht, dass kein geringerer als die Nation Einwanderer braucht, dann sollten die – so das vorsichtige humanitäre Bedenken – nicht dauerhaft auf den rechtlich minderwertigen und dann doch irgendwie auch politisch prekären Status einer bloß geduldeten Ausländergemeinde festgelegt werden. Womöglich droht ein 'Volk im Volk'; das darf nicht passieren. 'Integration' tut not – neben dem Abschieben. Die muss natürlich anders aussehen als einst die Integration der heimischen Arbeiterklasse ins bürgerliche Gemeinwesen – obwohl sich manches doch auch da wieder gleicht: Sprachlich, gesinnungsmäßig und sittlich müssen die ausländischen Rekruten der proletarischen Drecksarbeit auf die Linie der 'nationalen Leitkultur' gebracht werden. Als Belohnung winkt ihnen dann, vorausgesetzt, sie werden auch wirklich gebraucht und kontinuierlich benutzt, ein gesicherter Rechtsstatus, am Ende ein Pass: Das ist die Sozialleistung, die der 'globalisierte' Sozialstaat sich die Reproduktion seiner Arbeiterklasse aus dem internationalen 'Migranten'-Heer allenfalls kosten lässt.“ (Ebd., 243f)
Das Argument der Unverzichtbarkeit oder zumindest Brauchbarkeit der „fremden“ Populationen hat seit dem Sommer 2015 in Deutschland wieder Konjunktur – allerdings nicht, weil arbeitsmarktpolitisch ein spezieller Bedarf entdeckt und in Abstimmung mit der Wirtschaft Maßnahmen eingeleitet worden wären. Mit Deutschlands Schwenk in der Flüchtlingspolitik – Merkel: „Wir schaffen das“ – ist vielmehr ein übergeordneter weltpolitischer Gesichtspunkt zum Zuge gekommen, in dessen Folge sich erst wieder Überlegungen einstellen, was die Wirtschaft davon hat. Die Unternehmer machen hier in der Hauptsache klar, dass sie sich nicht vor ihrer gesellschaftlichen Verantwortung drücken wollen: „Firmen engagieren sich für Flüchtlinge – Ob Handwerksbetrieb oder Konzern, lokal verankert oder global unterwegs: Alle wollen Verantwortung übernehmen“ (General-Anzeiger, 14.9.2015). Telekom, Daimler, BMW, Bayer, Rossmann, RAG… sind mit guten Taten zur Stelle. Und erst danach hört man von einzelnen Unternehmen, dass man mit den Zuwanderern eventuell auch etwas anstellen könnte. „Flüchtlinge sind kein Problem, sondern ein Zugewinn für uns alle“, so Uwe Hück, Betriebsratschef von Porsche (ebd.). So wird auch von der Wirtschaft klargestellt, dass momentan einen besondere Situation existiert, die aufs Konto der politischen Absichtserklärung geht.
Literatur
- Stefan Berg, Was heilt – Es hilft nicht, wenn der Westen dem Osten vorrechnet, wie fremdenfeindlich er ist. In: Der Spiegel, Nr. 37, 2015.
- Christoph Butterwegge, Rechtsextremismus. Unter Mitarbeit von Lüder Meier. Freiburg u.a. 2002.
- Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/Ralf Ptak (Hg.), Neoliberalismus – Analysen und Alternativen. Wiesbaden 2008.
- Christoph Butterwegge, Dunkeldeutschland – Die Rechtsextremisten in der BRD wittern Morgenluft. In: Junge Welt, 7.9.2015.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Vom Zusammenhang zwischen Deutschlands Triple A an den Finanzmärkten und der Roma-Frage. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 2013, S. 22-27.
- Peter Decker/Konrad Hecker, Das Proletariat. München 2002
- Klaus Dörre, Unterklassen – Plädoyer für die analytische Verwendung eines zwiespältigen Begriffs. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“, Nr. 10, 2015, S. 3-10.
- Klaus-Peter Hufer, Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Schwalbach/Ts. 2001.
- Klaus-Peter Hufer, Argumente am Stammtisch. Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus. Schwalbach/Ts. 2006.
- Freerk Huisken, Deutsche Lehren aus Rostock und Mölln – Nichts als Nationalismus, Band 1. Hamburg 1993 (Neuausgabe 2001) .
- Freerk Huisken, Brandstifter als Feuerwehr – Die Rechtsextremismuskampagne. Nichts als Nationalismus, Band 2. Hamburg 2001.
- Freerk Huisken, Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus. Hamburg 2012.
- Herfried Münkler, Fremdenfeindlichkeit – Gefährliche Angst in der Mitte der Gesellschaft. In: SZ online, 30.8.2015.
- Marei Pelzer, Flüchtlinge: Der inszenierte Notstand. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9, 2015, S. 5-8.
- Ralf Schröder, Fühlt euch wie zu Hause! In: Konkret, Nr. 9, 2015, S. 12-15.
Der Protest gegen TTIP
TTIP ist laut ATTAC „die Fortsetzung eines alten Denkens, das statt auf die Teilhabe aller auf die Gewinne weniger fokussiert“. Zu den Argumenten der Protestbewegung liegt jetzt in der Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ (3/15), die am 18. September 2015 erschienen ist, eine ausführliche Kritik vor. Näheres dazu von Gegeninformation Köln.
Das Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen – kurz TTIP – bewegt seit einiger Zeit die Gemüter, nicht nur der Fachleute, sondern auch breiter Kreise der Bevölkerung in den Mitgliedsländern der EU (sowie etwas unauffälliger in den USA). Mittlerweile hat sich eine – verglichen mit anderen Fällen – große Protestbewegung herausgebildet, die von braven Sozialdemokraten bis ins linksradikale Lager reicht. Am einen Ende des Spektrums steht etwa der Bestsellerautor Thilo Bode („Die Freihandelslüge“), seines Zeichens Chef der Verbraucherschutzorganisation „Foodwatch“, der schon seit seiner Jugend allergisch auf linke Sprüche vom Welthandel als „Ausbeutung durch Imperialisten“ reagiert (Bode 2015, 7) und jetzt bekennt: „Von der Idee des fairen Handels, der allen Beteiligten Vorteile bietet, bin ich bis heute überzeugt“ (ebd., 8). Damit ist er nahe an der offiziellen SPD-Position, die, wie der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Hubertus Heil formulierte, „die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen will“ – sie dürften „nicht mit Verweis auf das mögliche Wachstumspotenzial des Freihandels weggewischt werden“ –, die aber auch die „Chancen, die freier und fairer Handel bietet“, gewürdigt sehen will (Heil 2014, 16).
Am anderen Ende des Spektrums steht beispielsweise die taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, die im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung dem Freihandel als „Projekt der Mächtigen“ entgegentritt (Herrmann 2014). Die Autorin, die jüngst auch eine Geschichte des Kapitalismus veröffentlichte, hat in ihr Gutachten für die Luxemburg-Stiftung einen Rückblick dazu aufgenommen, „wie die Industrieländer reich wurden“: denn die „vergangenen 250 Jahre erklären, warum die Entwicklungsländer arm bleiben – und wieso der Freihandel nur den reichen Ländern nutzt“ (Herrmann 2014, 5). Im „Junge Welt spezial: TTIP stoppen“ (8.4.2015) wurden Stimmen aus der europäischen Linken dokumentiert, so die Forderung von John Hilary aus England, man müsse „TTIP zu Fall bringen, bevor es uns auf Dauer zu Sklaven der transnationalen Kapitalistenklasse macht“ (JW, 4). Hier fiel aber eigentlich nur das Statement von Jean-Marie Jacoby (KP Luxemburg) aus dem Rahmen des üblichen Protests, indem der Autor feststellte: „Wer nur Verträge wie TTIP ablehnt, nicht aber die Europäische Union, greift zu kurz. Denn mit den Verträgen tut die EU exakt das, wofür sie geschaffen wurde“ (JW, 7).
Die Kritik von ATTAC
Die Verhandlungen zwischen den USA und der EU, die für die europäischen Länder das Mandat wahrnimmt, sind im Fluss und werden möglicher Weise erst 2017 oder 2019 abgeschlossen – wobei auch ein gänzliches Scheitern nicht ausgeschlossen ist. Im Herbst 2015 sollte die parlamentarische Auseinandersetzung um das TTIP-Abkommen (sowie den CETA-Vertrag mit Kanada) in die heiße Phase eintreten. ATTAC Deutschland rief deshalb Anfang des Jahres – mit der Begründung, dass das Abkommen „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und auszuhebeln“ drohe – gemeinsam mit anderen Organisationen zu einer bundesweiten Großdemonstration auf, die jetzt am 10. Oktober in Berlin stattfinden wird (ww.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/1010-grossdemo/). Die Protestaktion soll deutlich machen, dass gesellschaftliche Errungenschaften wie Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeiterrechte „unverhandelbar“ sind. Außerdem gelte es, eine nachhaltige, bäuerliche Landwirtschaft und die kulturelle Vielfalt zu schützen und auszubauen.
ATTAC gehört zu den prominenten Kritikern des Freihandelsabkommens. Zwei ATTAC-Basis-Texte (vgl. Klimenta u.a. 2014, 2015) haben die Grundsatzposition formuliert; umfangreiches weiteres Material findet sich im Internet (attac.de/startseite/). TTIP ist, so könnte man die Kritik von ATTAC zusammenfassen, „die Fortsetzung eines alten Denkens, das statt auf die Teilhabe aller auf die Gewinne weniger fokussiert“ (Klimenta u.a. 2015, 7). Mit seinem Einspruch wendet sich das globalisierungskritische Netzwerk nicht nur gegen das projektierte Abkommen, sondern auch gegen die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Praxis der Globalisierung. Denn das Meiste im vorgesehenen TTIP-Vertrag ist gar nicht neu, sondern fester Bestandteil der bestehenden Weltwirtschaftsordnung. Dies betrifft etwa die umstrittenen Schiedsgerichte zum Schutz privatwirtschaftlicher Investitionen vor staatlichen Eingriffen, wie es sie bereits in Deutschland bzw. Europa gibt; in über 3.000 internationalen Abkommen wurden Konzernen hier schon weitreichende Klagerechte eingeräumt (vgl. Klimenta 2014, 65). Auch beim Freihandel oder der Aushebelung nationaler Schutzvorschriften hat der europäische Binnenmarkt zahlreiche Regelungen getroffen, die in TTIP nicht schärfer vorgesehen sind.
Einwände aus antikapitalistischer Sicht
Die Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ nahm bereits 2014 zum Thema TTIP mit einer ausführlichen politökonomischen Würdigung des Vorgangs Stellung (vgl. Decker 2014); ihr Chefredakteur Peter Decker führte dazu auch Vortragsveranstaltungen durch, die im Netz dokumentiert sind (vgl. youtube.com/watch?v=hJa88Znw8A0). Die Kritik richtete sich bei dieser Analyse ebenfalls dagegen, dass „ein neues Regime für den Weltkapitalismus“ (Decker 2014, 112) auf den Weg gebracht werde, wirkte also auf den ersten Blick wie eine Bestätigung der breiten Protestbewegung. Auf den zweiten Blick ließ sich hier natürlich sofort erkennen, dass eine andere Kritikposition eingenommen wurde. Sie rückte Fragen in den Mittelpunkt, die bei der landläufigen Aufregung über Chlorhühnchen, Fracking und Gentechnik keine Rolle spielen, nämlich speziell die Gegensätze der beiden kapitalistischen Zentren USA und Europa sowie ihre Konkurrenz ums Weltgeld. Die Schwäche der Protestbewegung hat jetzt die Ausgabe 3/15 des „Gegenstandpunkts“ noch einmal explizit zum Thema gemacht (siehe Decker 2015).
Der Artikel befasst sich mit den Befürchtungen, die die Protestbewegung im Blick auf die geplanten Eingriffe in Verbraucher- und Tierschutz, Kennzeichnungspflichten, Medikamentenzulassung, Datenschutz, Buchpreisbindung, öffentliche Ausschreibungsverfahren, Wasserversorgung und andere öffentliche Dienstleistungen oder in das Arbeitsrecht artikuliert. Er will all dem seine Berechtigung nicht absprechen, konzentriert sich aber auf einen grundlegenden Widerspruch, den sich der TTIP-Protest leistet: Sowohl das Gewinninteresse, das hierzulande gilt, als auch die staatliche Aufsicht, die es reguliert, beschränkt, ja erst in Kraft setzt, werden mit ihren nationalen bzw. europäischen Härten vom Protest durchaus zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig – wenn es jetzt um die Schaffung eines transatlantischen Wirtschaftsraums geht – in ihrer ökonomischen Wucht nicht ernst genommen und in politischer Hinsicht als eine gegen die Macht des Großkapitals zu verteidigende Bastion behandelt. „Mit ihrem Anliegen 'TTIP verhindern!' halten sich die Kritiker bei ihrem Befund über die systematische Rücksichtslosigkeit des Geschäfts also nicht lange auf. Sie beschäftigen sich gar nicht weiter mit der Frage nach der Natur des herrschenden 'Gewinninteresses', nach dessen systemischen Gründen, woher es seine Macht bezieht, die gesamte Gesellschaft von seinen geschäftlichen Notwendigkeiten abhängig zu machen: Man zielt nicht auf die Beseitigung der Quelle der beklagten Folgen kapitalistischer Geschäftstätigkeit, sondern auf eine staatliche Beschränkung bei der Wahrnehmung der Interessen, die diese Wirkungen zeitigen.“ (Decker 2015, 109) Das lässt sich auch daran belegen, dass die Protestbewegung auf die Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS – Investor-State-Dispute-Settlement) fokussiert, in denen sie den Niedergang staatlicher Souveränität und das Hauptproblem des Abkommens entdeckt.
Im September 2015 gehen nun die TTIP-Verhandlungen in eine neue Runde. Dazu gibt es neue Ansagen. „Die Europäische Kommission reagiert auf anhaltende Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen und hat sich für eine grundlegende Reform der umstrittenen Schiedsgerichte für Investoren ausgesprochen“, meldet die FAZ (17.9.2015). EU-Handels-Kommissarin Cecilia Malmström schlug am 16. September eine umfangreiche Reform des aktuellen Schiedsgerichtssystems vor: „Wir wollen ein System einrichten, dem die Bürger trauen“ (faz.net, 16.9.2015). Es bleibt abzuwarten, was realpolitisch daraus wird. Es steht aber zu befürchten, dass die Protestbewegung solche Modifikationen als großen Erfolg feiert und sich auf den Standpunkt stellt, dass ihre Kritikpunkte – zumindest teilweise – Gehör gefunden haben und dass der Bürger – bedingt – der Politik wieder trauen kann.
Gegeninformation Köln ist ein Diskussionskreis, der sich regelmäßig im Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln trifft (Website: gegeninformation.org). Er hat seit 2014 Veranstaltungen zu TTIP durchgeführt. Interessenten, die dieses Thema noch einmal aufgreifen möchten, können sich über die Gegeninformation-Website melden (dort ist auch das Flugblatt dokumentiert, das Gegeninformation bei der Kölner Anti-TTIP-Demonstration im Frühjahr 2015 verteilte).
Literatur
- Thilo Bode, Die Freihandelslüge. Warum TTIP nur den Konzernen nützt – und uns allen schadet. Unter Mitarbeit von Stefan Scheytt. München 2015.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Mit TTIP zur Wirtschafts-NATO. Dollar-Imperialismus und Euro-Binnenmarkt – gemeinsam unüberwindlich. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2014, S. 103-114.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der Anklagepunkt der TTIP-Kritiker – Die Degradierung des Gemeinwohls zum Handelshemmnis. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2015, S. 107-119.
- Hubertus Heil, Mut zur Differenzierung – Risiken und Chancen von TTIP. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Nr. 10, 2014, S. 16-19.
- Ulrike Herrmann, Freihandel – Projekt der Mächtigen. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Büro Brüssel, 2014. Im Netz: www.rosalux-europa.info.
- Harald Klimenta, Andreas Fisahn u.a., Die Freihandelsfalle. Transatlantische Industriepolitik ohne Bürgerbeteiligung – das TTIP. Hamburg 2014.
- Harald Klimenta, Maritta Strasser, Peter Fuchs u.a., 38 Argumente gegen TTIP, CETA, TiSA & Co. Für einen zukunftsfähigen Welthandel. Hamburg 2015.
Juli 2015
Noch ein Gespenst: Der Ego-Kapitalismus
„Alle denken an sich und keiner an mich.“ Die bekannte Klage hat jüngst noch der ach so früh verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher – einer der Matadoren der gehobenen deutschen Diskurskultur – zu einer gnadenlosen Anklage gegen den Ego-Kapitalismus verarbeitet. Dazu aus aktuellem Anlass Anmerkungen von Johannes Schillo.
Anfang 2013 erschien Frank Schirrmachers Streitschrift „Ego“, gerichtet gegen den modernen Informationskapitalismus und dessen totalitären Kontroll-Zugriff auf die Menschheit. Der im Sommer 2014 verstorbene Herausgeber der FAZ landete damit wieder – wie bei seinen früheren Veröffentlichungen zum Krieg der Generationen oder zur Macht des Internets – einen Bestsellererfolg. Sein Buch reiht sich ein in neuere Diagnosen, die vor dem Siegeszug eines Raubtier- oder Turbokapitalismus warnen. In diesem Kontext erfährt auch seit Jüngstem das Kuriosum einer katholischen Kapitalismuskritik wieder Auftrieb und wird, speziell seit den Statements des Bergoglio-Papstes, bis in linke Kreise mit Zustimmung aufgenommen. So sehen jetzt die Theologen Franz Segbers und Simon Wiesgickl, die gerade den Sammelband „Diese Wirtschaft tötet“ vorgelegt haben, in Papst Franziskus den entscheidenden Gewährsmann für Kapitalismuskritik; diese halten sie zudem für den sozialethischen Grundsatz der heutigen christlichen Kirchen (und tendenziell darüber hinaus): „Erstmals gibt es eine große Ökumene der … Kirchen in der klaren Ablehnung von Geist, Logik und Praxis des Kapitalismus.“ (Segbers/Wiesgickl 2015, 10)
Solche religiösen Kritiker verweisen darauf, dass seit den biblischen Zeiten eine Verurteilung der „ungehinderten Geldvermehrung“ und des „Götzendienstes“, den die Menschheit dem „Mammon“ leiste (ebd., 15), existiert. Die religiöse Kritik habe sich mit Anbruch der Moderne verschärft, denn für die sei „typisch, dass Geldgier und Mammon ethisch neutralisiert und sogar als dynamischer Faktor der Wirtschaft wertgeschätzt werden“ (ebd.). In der Tat hat etwa die katholische Soziallehre seit dem beginnenden Kapitalismus und dann seit dessen Etablierung im 19. Jahrhundert vielfach gegen die „Geldgier“ Stellung bezogen. Noch 1745 bekräftigte Papst Benedikt XIV. in seiner Enzyklika „Vix pervenit“ das totale Zinsverbot; 120 Jahre später verurteilte Pio Nono in seinem berühmt-berüchtigten „Syllabus errorum“ (1864) so gut wie alle Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft als sündhafte Zeitirrtümer, worauf sich dann Leo XIII. mit „Rerum novarum“ (1891) detaillierter der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und dem unseligen Geist der Neuerung (vor allem Entstehung einer Arbeiterbewegung!) zuwandte. Seitdem hat die katholische Kirche den in der Wirtschaft herrschenden Egoismus, Materialismus & Konsumismus vielfach gegeißelt. Teilweise uferte das sogar zur Anklage einer strukturellen Sündhaftigkeit der ökonomischen Ordnung aus. Die schärfsten, an Systemkritik erinnernden Worte fand das Rundschreiben „Quadragesimo anno“ (1931), das nach der Weltwirtschaftskrise erschien: „Zur Ungeheuerlichkeit wächst (die) Vermachtung der Wirtschaft sich aus bei denjenigen, die als Beherrscher und Lenker des Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung haben über den Kredit und seine Verteilung nach ihrem Willen bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des ganzen Wirtschaftskörpers; das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, daß niemand gegen ihr Geheiß auch nur zu atmen wagen kann.“ (Zit. nach KAB 1975, 129)
Solche harten Worten passten damals zum Zeitgeist. Von dort bis zur Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ (2009) des Ratzinger-Papstes wurde dann wieder die konsumistische, materialistische Haltung des Einzelnen, also von uns allen, in den Mittelpunkt gerückt, was der neue Papst Franziskus insofern korrigiert hat, als er der Anklage einer menschenfeindlichen Wirtschaftsordnung („Diese Wirtschaft tötet“) jetzt neuen Nachdruck verleiht – passend zur allgemeinen Stimmungslage nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Doch auch bei Franziskus ist die materialistische Haltung des Einzelnen der Dreh- und Angelpunkt. Franziskus hat in seiner neuesten Enzyklika „Laudato si“ (2015) noch einmal bekräftigt, was er bereits in „Evangelii gaudium“ (2013) als Ursache ausfindig gemacht hatte: Alles Übel kommt daher, dass „der Mensch sich selbst ins Zentrum stellt“ (LS 122). Das „vorherrschende technokratische Paradigma“ (LS 101) bestimme seit einiger Zeit das moderne Wirtschaftsleben. Das soziale Grundproblem besteht demnach in der „Art und Weise, wie die Menschheit tatsächlich die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem homogenen und eindimensionalen Paradigma angenommen hat. Nach diesem Paradigma tritt eine Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf des logisch-rationalen Prozesses das außen liegende Objekt allmählich umfasst und es so besitzt. Dieses Subjekt entfaltet sich, indem es die wissenschaftliche Methode mit ihren Versuchen aufstellt, die schon explizit eine Technik des Besitzens, des Beherrschens und des Umgestaltens ist. Es ist, als ob das Subjekt sich dem Formlosen gegenüber befände, das seiner Manipulation völlig zur Verfügung steht.“ (LS 106) Die FAZ (20.6.15) kommentierte zutreffend, dass dies eine „deutliche Absage an das moderne Weltbild (ist), wonach der Mensch die Welt zu seinem Nutzen gestalten solle… Das anthropozentrische Weltbild, das den Menschen im Mittelpunkt sieht, ist für Franziskus die Ursünde.“
Die FAZ nahm natürlich, da sie die (von Ratzinger noch gelieferte) Verklärung des Marktes vermisste, dezidiert Stellung gegen die Verurteilung des „anthropozentrischen Weltbilds“, gegen das jüngste „moralinsaure Gebräu“ (FAZ, 18.6.15) aus dem Vatikan, und wartete mit der üblichen Beschönigung der Verhältnisse in der globalisierten Marktwirtschaft auf. Wirklich schade, dass der Allerhöchste Schirrmacher so früh abberufen hatte; so konnte der die neueste päpstliche Botschaft nicht mehr kommentieren. Im Grunde hätte er sich durch die Bedenken des Pontifex Maximus bestätigt sehen müssen. Es ist allerdings zweifelhaft – auch wenn die Ausführungen zur Herrschaft des „Ego“ bestens zum Mainstream der Klagen über den ungebändigten, maßlosen Kapitalismus passen (vgl. jetzt auch Emunds/Hockerts 2015) –, ob die These einer anthropologischen Wende haltbar ist und eine Erklärung des heutigen Wirtschaftslebens liefert.
Die Entdeckung des Egos
Als Erstes muss man festhalten: Dass moderne Menschen ein Ego haben und es in den Mittelpunkt rücken, ist eine seltsame Entdeckung, mit der man aber im Bereich der Kultur- und Zivilisationskritik anscheinend immer noch Punkte machen kann. So stieß Jürgen Habermas in seinem philosophischen Dialog mit Joseph Ratzinger – noch vor der großen Finanzkrise – auf das Charakteristikum der modernen Globalisierung, dass „private Sphären in wachsendem Maße auf Mechanismen des erfolgsorientierten, an je eigenen Präferenzen orientierten Handelns umgepolt“ werden (Habermas 2005, 26). In ähnlicher Weise ging dann Schirrmacher ein paar Jahre später das Geheimnis der „Ära des Informationskapitalismus“ (Schirrmacher 2013, 10) auf, dass nämlich „hinter den Kulissen unseres Lebens“ (ebd., 9) ein neues Modell, in dem „jeder Mensch ausschließlich an sich und seinen Vorteil denkt“ (ebd.), errichtet wurde.
Das sind nun wirklich erstaunliche Mitteilungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts! Der älteste Hut des Liberalismus – das seit den Zeiten von Bernard Mandeville und Adam Smith problematisierte Verhältnis von private vices und public benefits, von privater Vorteilssuche und allgemeiner Wohlfahrt, das durch die invisible hand des Marktes zum harmonischen Ausgleich geführt werden soll – wird als brandneue Entdeckung präsentiert. In der Tat, wo der Markt 'herrscht', sind die Menschen in Konkurrenz gegeneinander gestellt, suchen ihren Vorteil auf Kosten anderer. Sie müssen sich, wenn sie hier bestehen wollen, als Personifikationen der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, als „Charaktermasken“, wie Marx formulierte (MEW 23, 100), aufführen, wobei der Kapitalismus als allgemeiner Konkurrenzkampf organisiert ist, in dem man „bei Strafe des Untergangs“ (MEW 25, 255) mitmachen muss.
Genau diese praktisch gültig gemachte Welt des homo oeconomicus hat Marx vor 150 Jahren der Analyse unterzogen. Er hat übrigens damals schon den Typus Kapitalismuskritik, den Konservative wie Schirrmacher heute als Neuigkeit liefern, aufgespießt. Im Kommunistischen Manifest brachte er einen fulminanten Verriss des „reaktionären“ und „pfäffischen Sozialismus“, der sich der Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse entgegen stellen wollte (vgl. MEW 4, 482ff). Diese moralisch auftretende Kritik sei „halb Klagelied, halb Pasquill, halb Rückhall der Vergangenheit, halb Dräuen der Zukunft, mitunter die Bourgeoisie ins Herz treffend durch bitteres, geistreich zerreißendes Urteil, stets komisch wirkend durch gänzliche Unfähigkeit, den Gang der modernen Geschichte zu begreifen.“ (Ebd., 483) „Nichts leichter“, resümiert das Manifest, „als dem christlichen Asketismus einen sozialistischen Anstrich zu geben.“ (Ebd., 484)
Die asketisch-antimaterialistische Klage über die „Umpolung“ auf eigennütziges Verhalten ist der ganze Witz von Schirrmachers Einblick in das „Spiel des Lebens“. Gleich eingangs heißt es: „Dieses Buch basiert auf einer einzigen These“ (Schirrmacher 2013, 15), dass wir nämlich „in unserer Lebenswelt“ einen „ökonomischen Imperialismus“ (ebd.), eine „Ökonomisierung von allem und jedem“ (ebd., 16), erleben. Inhalt dieses Prozesses ist die Durchsetzung des Menschenbildes vom homo oeconomicus, „dass jeder eigennützig handelt und den anderen reinlegen will“ (ebd., 28). Es geht Schirrmacher aber nicht um eine theoretische Klärung der ökonomischen Verhältnisse, in denen sich dieses Menschenbild festgesetzt hat. Er „inspiziert“ (ebd., 16) vielmehr, mit gewollt verschwörungstheoretischen Anklängen, die Machenschaften von akademischen Spiel- und Handlungstheoretikern, denn sie geben mehr her „für die Geschichte, die dieses Buch erzählen will“ (ebd., 17).
Die Erzählung geht im Kern so: Mathematisch, physikalisch, kybernetisch etc. versierte Wissenschaftler dienten im Kalten Krieg als Personal zur Perfektionierung der Mutual Assured Destruction (MAD), des legendären Gleichgewichts des Schreckens, das nach der Ausrufung des nuklearen Patts die Abschreckungsstrategie des Westens bestimmte. Mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes wurden diese Wissenschaftler arbeitslos, zogen darauf in die Wall Street um, wo sie, mit Hilfe der parallel entstandenen Computerisierung, den neuen „Informationskapitalismus“ schufen. Im Endeffekt regiert jetzt das ökonomistische Menschenbild die Welt, macht sich als eigenständiges Subjekt, vom Autor auch „Nummer 2“ (so der Name eines Filmbösewichts) oder „Big Data“ genannt, die Menschen untertan, die es wie ein Puppenspieler oder Drahtzieher dirigiert. Dieser Entfremdungsprozess, in dem die Menschen ihre Subjektivität verlieren und von einer Art Golem beherrscht werden, macht klassen- und schichtenübergreifend den neuen Skandal des Informationskapitalismus aus. Das Buch gibt keine Theorie des modernen Kapitalismus. Es verfährt auch eher bebildernd als erzählend. Schirrmacher knüpft dabei immer wieder an die Gruselliteratur des 19. (Frankenstein, Dr. Jekyll und Mister Hyde, Dracula) oder die Science-Fiction des 20. Jahrhunderts (Aldous Huxley, Philip K. Dick) an und verzichtet auch nicht auf die einschlägigen Knalleffekte aus der Gespensterbahn. So heißt es in der Mitte des Buchs: „An diesem Punkt unserer Erzählung würde ich den Leser gerne bitten, sich noch einmal kurz umzudrehen, um zu sehen, wie sich gerade langsam eine Hintertür in seinem Rücken zu öffnen beginnt. Es ist die Tür, durch die Nummer 2 in sein Zimmer hineinzuschlüpfen versucht.“ (Ebd., 143)
Angesichts der Redundanz der Mensch-Maschinen-Vergleiche und Monster-Beispiele (von Dr. Frankenstein bis zu Horst Köhlers Rede von den Finanzmarkt-„Monstern“) und der Ignoranz gegenüber dem ökonomischen Geschehen, in das Schirrmachers Geistersubjekt implantiert worden sein soll, verwundert es nicht, dass das Buch analytisch nicht viel mehr anzubieten hat als ein Lob der guten alten Zeit der sozialen Marktwirtschaft, als „gesellschaftliche Konflikte zwischen Realwirtschaft, Staat und Gesellschaft kooperativ gespielt wurden“ (ebd., 169). Tja, gemischt mit „Rückhall der Vergangenheit“ und „Dräuen der Zukunft“ lässt sich anscheinend immer wieder die alte Kalenderweisheit verkaufen, dass das „Spiel des Lebens“ um einiges erträglicher wäre, wenn nicht alle an sich, sondern auch an die andern denken würden.
Anmerkung: Bei dem vorstehenden Text handelt es sich um die erweiterte und überarbeitete Fassung einer Rezension, die im Journal für politische Bildung (Wochenschau-Verlag), Nr. 2/15, unter dem Titel „Überwachen und Manipulieren“ erschienen ist.
Literatur
- Caritas in veritate. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 186, Bonn 2009.
- Bernhard Emunds/Hans Günter Hockerts (Hrsg.), Den Kapitalismus bändigen – Oswald von Nell-Breunings Impulse für die Sozialpolitik. Paderborn 2015.
- Evangelii gaudium, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013.
- Jürgen Habermas, Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates? In: Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung – Über Vernunft und Religion. Freiburg u.a. 2005, S. 15-37.
- KAB – Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands (Hrsg.), Texte zur katholischen Soziallehre – Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln 1975.
- LS – Laudato si. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 202, Bonn 2015 (zit. als LS nach den Nummern der Abschnitte).
- Karl Marx/Friedrich Engels, Das Manifest der kommunistischen Partei. In: Marx Engels Werke, Band 4, Berlin 1974 (zit. als MEW 4).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx Engels Werke, Band 23, Berlin 1971 (zit. als MEW 23).
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. In: Marx Engels Werke, Band 25, Berlin 1983 (zit. als MEW 25).
- Frank Schirrmacher, Ego – Das Spiel des Lebens. 3. Aufl., München 2014 (zit. nach der Erstausgabe von 2013).
- Franz Segbers/Simon Wiesgickl (Hrsg.), ›Diese Wirtschaft tötet‹ (Papst Franziskus) – Kirchen gemeinsam gegen Kapitalismus. Hamburg 2015.
Juni 2015
Vom Pazifismus zum Militarismus
Mit der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts 2014 wurde auch das in der linken Szene anvisierte rot-rot-grüne Regierungsbündnis wieder fraglich. Ist der linke Pazifismus dessen „Sollbruchstelle“? Ein Überblick zur Entwicklung in 2014 von Sabrina Zimmermann, der auch an den Erfolgsweg einer anderen Protestpartei erinnert.
Die FAZ (1.9.14) bilanzierte den „deutschen Demo-Stand“ am Antikriegstag 2014: „In Hamburg protestierten ein paar hundert gegen hohe Mieten, in Berlin ein paar tausend gegen digitale Überwachung. Keine Demo, nirgends, gegen Waffenlieferungen an die Kurden, gegen mögliche neue Nato-Stützpunkte in Osteuropa. Noch nicht einmal ein Aufschrei.“ Und das Blatt resümierte: „Der Pazifismus, einst ein Straßenfüller, ist erkennbar ein Ideologem von vorgestern.“ Eine solche Einschätzung verdankt sich nicht dem konservativen Blickwinkel. „An die großen Anti-Kriegsproteste der 80er Jahre kommt die gegenwärtige Friedensbewegung nicht heran. Und dies, obwohl die Welt so kriegerisch ist wie lange nicht“, meldete z. B. das Neue Deutschland (18.8.14) zu den spärlichen Versuchen, Proteste gegen die militärischen Ambitionen und Machenschaften der deutschen Nation und gegen die von ihr mitgetragenen Aktivitäten der Bündnispartner in Gang zu setzen.
Grund zum Aufschreien bestünde in der Tat genug. Was Deutschland heute vorhat und unternimmt bestimmt wesentlich die Weltlage mit, die ja wirklich so kriegerisch ist wie lange nicht mehr, und wird selbst von den Protagonisten hierzulande als riskanter Aufbruch, ja Tabubruch – siehe die Entscheidungen in Sachen Rüstungsexport vom Sommer 2014 – verstanden. Doch von einer Friedensbewegung, wie sie seinerzeit mit ihren großen Demonstrationen in die Annalen der Protestgeschichte einging, ist weit und breit nichts zu sehen. Eine erstaunliche Entwicklung! Vielleicht kann ein kleiner zeitgeschichtlicher Rückblick hier Aufklärung bieten.
1. Die grüne Partei zeigte, wie es geht
Die Grünen gehören mittlerweile, blickt man etwa auf die Konfliktlage in Osteuropa, zu den entschiedenen Scharfmachern, neben denen selbst altgediente NATO-Generäle und Politiker der Regierungsparteien wie mäßigende Kräfte wirken (vgl. Irion 2014, Fücks 2014). Das mag überraschen, da die Partei zu Zeiten der Antiatom- und Friedensbewegung mit dem Grundwert Gewaltfreiheit an den Start ging und ihn nach wie vor im Programm führt. Sieht man sich das friedensbewegte Ethos der Grünen jedoch näher an, erscheint die Entwicklung konsequent. Klar wird so auch einiges vom Elend des Pazifismus überhaupt – und es ergeben sich aktuelle Bezüge zur Linkspartei, deren Politikfähigkeit gerade angesichts der Umfragemehrheit für Rot-Rot-Grün 2014 wieder diskutiert wurde (und weiterhin diskutiert wird, wie der Bielefelder Parteitag der LINKEN im Juni 2015 demonstrierte). Dabei riet man ihr ganz offenherzig, den grünen Weg von 1999 als „Vorbild“ zu nehmen. Die Süddeutsche Zeitung (19.8.14) schrieb: „Der Parteitag (der Grünen von 1999, Anm. d. A.) stimmte dem bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im Kosovo schließlich zu. Viele prominente Grüne verließen ihre Partei. Aber es kamen neue hinzu. Heute, 15 Jahre nach dem Beschluss, stehen die Grünen besser da als je zuvor. Nie hatten die Grünen mehr Mitglieder, nie hatten sie bessere Wahlergebnisse, als in den Jahren danach. Für Linke könnte es sich lohnen, genauer auf die grüne Geschichte zu schauen.“
Die Grünen entstanden 1980 als Partei eines Protestmilieus, verstanden sich anfangs als parlamentarischer Arm neuer sozialer Bewegungen und wollten eine Art Antiparteienpartei sein, jedenfalls kein weiterer konstruktiver Beitrag zum politischen Establishment. Dass alles anders kam, ist bekannt. Im Bunde mit der SPD führten sie 1998/99 das wiedervereinigte Deutschland in seinen ersten veritablen Krieg (vgl. Held 1999), während Kanzler Kohl in den Jahren zuvor noch von Bedenken – die historische Erbschaft der Wehrmacht auf dem Balkan betreffend – angekränkelt war. Und zu Beginn des neuen Jahrhunderts legten sie als mitregierende Partei mit der Agenda 2010, die neue Maßstäbe in puncto Senkung des nationalen Lohnniveaus setzte, die Grundlage für Deutschlands aktuelle Führungsrolle als europäische Wirtschaftsmacht. Seitdem ist die Nation politisch und ökonomisch derart anspruchsvoll, dass sie sich immer stärker für globale Führungsaufgaben prädestiniert sieht. „Mehr Verantwortung“ (Gauck) will und muss sie übernehmen – natürlich nur zum Wohle der Völkerfamilie und mit Krieg als allerletzter Konsequenz, wie versichert wird.
Weniger bekannt ist die innere Logik dieses Prozesses, den die Grünen in atemberaubender Weise bewerkstelligten, vor allem die Abkehr von vorwiegend ökologisch begründeten kapitalismuskritischen Tönen und von einer Kriegsgegnerschaft, die sich am (westlichen) Atompotenzial festmachte. Die Wende der Partei bedeutete ja nicht einfach eine realpolitische Vernachlässigung der hehren Ziele, sondern arbeitete sich zum glatten Gegenteil der angekündigten Zielsetzungen vor: zum forcierten Ausbau des Kapitalstandorts Deutschland und seiner militärischen Macht. In der modernen Parteienforschung gilt das übrigens als ganz normal. In derartigen Wandlungsprozessen „geschah das, was man in der Geschichte der Menschen schon tausendfach hatte erleben können. Die Oppositionellen von ehedem wurden zu Verfechtern der lange attackierten Ordnung.“ (Walter 2010, 88) So behandelt der Parteienforscher Franz Walter in seinem historischen Abriss die Grünen gleich im Doppelpack mit der FDP. Ihm geht es dabei um die Nöte von Parteien, die ihr Milieu bzw. ihre Klientel bedienen müssen. Speziell die Grünen hätten sich durch das Angekommensein von Partei- und Wählerbasis in der Welt der Besserverdienenden herausgefordert gesehen.
Diese Sicht zeugt von bemerkenswerter Abgebrühtheit. Man geht davon aus, dass die Staatsnotwendigkeiten sowieso feststehen und neue Anwärter im Politikbetrieb bei allem programmatischen Getöse nur eins im Blick haben können: Chefsessel und Dienstwagen – und meint das nicht als Kritik wie etwa Konkret-Herausgeber Gremliza mit seinem Diktum: „Wenn sie dafür ihre Dienstwagen behalten dürfen, genehmigen die Grünen fünf neue Atomkraftwerke und erklären Rußland den Krieg.“ (Konkret 8/10) Politologen sind hier ganz realistisch. Walters Parteigeschichte verliert zum Übergang, den die Grünen 1998 ins bellizistische Lager vollzogen, kein Wort; sie resümiert nur im Allgemeinen den Wandlungsprozess. Da sind ehemalige Politiker der Grünen schon eher bemüht, den Werdegang der Partei zu erklären. So unterschiedliche Ex-Protagonisten wie Ludger Volmer oder Jutta Ditfurth kommen bei ihrer Ursachenforschung sogar zu einer gewissen Übereinstimmung: Es war Verrat, verübt von anderen Protagonisten, wobei an erster Stelle immer wieder der spätere Außenminister Joschka Fischer rangiert. Wenn Ditfurth dessen Leistungen rekapituliert, trifft sie natürlich die Anpassungsfähigkeit des Parteistrategen an die gewandelte Lage.
Doch es greift zu kurz, wenn man diesen Prozess einfach zu einer Personal- und Charakterfrage, zu einer Sache opportunistischer Preisgabe der „linken Überzeugung und der persönlichen Würde“ (Ditfurth 2000, 286; vgl. Schmidt 1999) macht und nach Verrätern fahndet. Die Grünen wurden eben politikfähig, was die überwältigende Mehrheit der Mitglieder wollte und Millionen Wähler honorierten. Die realpolitischen FührerInnen hielten so dem grünen Gründungsauftrag die Treue, unter dem Zeichen der Sonnenblume in den Parlamenten mitzumischen. Der Partei war ja auch immer jede Stimme recht, selbst von Wertkonservativen und Ökoreaktionären, die zudem den Gründungsakt mitbestimmt hatten. Sie verkaufte den nationalen Reformbedarf in Sachen Umwelt als Wohltat „eines ökologischen Umbaus der Industriegesellschaft“ und propagierte den Realismus der kleinen Schritte und des Machbaren. All das ratifizierten die Macher, als sie an die Macht kamen. In der Frage von Krieg und Frieden hatten sie dabei eine besondere Umorientierung zu bewältigen, aber auch die Absage an den Pazifismus hatte ihre innere Logik.
2. Pazifismus und Militarismus
Beim Pazifismus hat man es nämlich nicht – das zeigt die grüne Geschichte paradigmatisch – mit einer theoretisch begründeten Absage an den Militarismus zu tun, also mit einer fundierten Kritik der nationalstaatlichen Logik „kriegerischer Konfliktlösung“, und mit einer kritischen Praxis, die dann, wenn sie an Einfluss gewinnt, zur Beseitigung der Kriegsursachen schreiten würde. Pazifismus bedeutet vielmehr eine prinzipielle Einverständniserklärung mit staatlichem Handeln, wenn und solange sich dieses an die entscheidende Maxime hält, (nach außen) keine Gewalt anzuwenden. Der Pazifist greift nur den Übergang an, den Nationalstaaten, wie Clausewitz formulierte, bei der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln machen. Wenn Staaten die Bedingungen eines Friedenszustandes als nicht mehr hinnehmbar betrachten und – durch Krieg – einen neuen, haltbaren Frieden schaffen wollen, hört sein Einverständnis auf. Den Ausgangs- und Endpunkt, Frieden, hält er als einen moralischen Höchstwert in Ehren, das kriegerische Mittel gilt ihm als Verfehlung.
In seiner klassischen Form, wie man sie vom deutschen Recht der Kriegsdienstverweigerung nach 1945 kennt (siehe Artikel 4 des Grundgesetzes), bezieht sich der Pazifismus nur auf das Außenverhältnis. Dabei stellt er sich anerkennend und moralisierend zu der Leistung des staatlichen Gewaltmonopols, Privatgewalt zu unterbinden und alle Gesellschaftsmitglieder auf einen zivilisierten, gewaltfreien Umgang festzulegen. Dies soll die generell gültige politische Maxime sein. Dass sie der Staat selber nicht befolgt, weiß der Pazifist und setzt seine eigene Moralität dagegen: Er persönlich ist das Beispiel dafür, dass es auch anders ginge, und beweist seine Gewissensintegrität in der Regel damit, dass er sich einer alternativen staatlichen Dienstverpflichtung zur Verfügung stellt. Auf diese Weise etablierte sich in Westdeutschland ein KDV-Wesen, das nach 1968 sogar zur relativen Massenbewegung avancierte.
Pazifisten bekennen sich zu einem Wert, den sie leben; sie bekunden eine moralische Einstellung, an der sie den Staat messen. Kommt einiges zusammen – wie im Fall der BRD-Gründung ein verlorener Krieg als historische Voraussetzung und die neue Frontstaat-Rolle in einem Militärbündnis, dessen Subjekt man nicht selber ist –, kann sich diese Haltung eben zu einer breiten Protestbewegung auswachsen. Das fand seine Fortsetzung Anfang der 1980er-Jahre in der BRD, als Menschen massenhaft entdeckten, dass das auf „Vorneverteidigung“ programmierte Vaterland zum atomaren Schlachtfeld werden könnte. Die Illustrierte Stern titelte im Januar 1981 „Atomrampe BRD“, „Raketen sind Magneten“ schrieb kurz darauf Franz Alt und so waren die wichtigsten Stichworte der neuen Friedensbewegung beisammen, deren Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ lautete. Getreu dem pazifistischen Grundsatz traute man dem westlichen Staatenblock zu, dass er sein Interesse zur Öffnung des Ostens („den Grenzen das Trennende nehmen“, CDU/CSU/SPD…) auch auf nichtmilitärischem Wege realisieren könnte – eine Hoffnung, die ja dann 1989 auch irgendwie aufging.
Das alles zeigt: „Nicht der Zurüstung auf Krieg galt diese Kritik, sondern der befürchteten Wirkung des nationalen Untergangs. Der Preis kam den Liebhabern einer friedlichen Bundesrepublik entschieden zu hoch vor… Die Feindschaftserklärung der Nation war also gebilligt, ihre Vollstreckung dagegen nicht.“ (Held 1996, 157f) Wie in der pazifistischen Grundeinstellung liegt dem friedensbewegten Protest die Parteinahme für die eigene Nation zu Grunde. Wenn die nationale Selbstbehauptung sich gegen fremde Gewalt ausspricht, gerät der pazifistisch gesinnte Mensch in Schwierigkeiten. Der eigene Staat gilt ihm, solange er sich friedlich verhält, nicht als kritikabel. Der Friedenszustand und damit die politisch-ökonomischen Interessengegensätze, die zum Krieg führen (können), werden abgesegnet. „Der Gedanke, dass Frieden und Krieg zwei qualitativ verschiedene Zustände seien, die nicht miteinander zusammenhängen, dass im Krieg vielmehr die Politik versage, ist nicht haltbar: Frieden ist auch Kriegsbereitschaft. Soll man kriegsbereite Politik als gewaltlose Politik verharmlosen, weil die Waffen noch nicht eingesetzt werden?“ (Franz 2014, 2)
3. Und die Linken?
In der Linkspartei hat längst eine Debatte darüber begonnen, ob man sich den Weg der Grünen zum Vorbild nehmen soll. Gemeinsamkeiten mit Grünen oder SPD werden ausgelotet (vgl. Brandt u. a. 2013, Thie 2013) und für tragfähig befunden; ein neuer Sammelband von Ex-MdB Paul Schäfer vermisst eigens das außenpolitische Feld, um Differenzen und Übereinstimmungen festzustellen, denn hier gilt die Linke aus dem Blickwinkel ihrer potenziellen Koalitionspartner als politik-, also regierungsunfähig. Außenpolitik ist laut Polit-Jargon die Sollbruchstelle in einer zukünftigen Regierungs-Koalition. Gysi und andere arbeiten schon seit einiger Zeit daran, diese letzte Politikunfähigkeit, die im Blick auf die Bundesebene besteht, zu überwinden. Ein maßgebliches Datum war der Beschluss des SPD-Parteitags vom November 2013, „dass man für die Zukunft auch im Bund keine Koalition grundsätzlich ausschließen wolle.“ (Schäfer 2014, 11) Zwar sind durch den Verlauf der Ukraine-Krise die Hoffnungen, dass sich diese Möglichkeit 2017 (oder sogar früher, beim Auseinanderbrechen der großen Koalition) realisieren lässt, schwer gedämpft worden. Aber es gibt in der Partei das entschiedene Bestreben, an dieser Option festzuhalten. Der außenpolitische Experte Schäfer hält fest: „Ein Regierungswechsel gibt nur Sinn, wenn es um einen 'Richtungswechsel auf neuer Grundlage' geht. Und gerade deshalb ist es notwendig, dass das Feld für ein anderes Regierungsbündnis längerfristig bereitet wird.“ (Ebd., 12)
Neben dem Parteitagsbeschluss der SPD gibt es ein weiteres wichtiges Datum: Im April 2014 beschloss der Deutsche Bundestag, sich bei der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen zu beteiligen. In der Linkspartei hatte es vor der Abstimmung eine rege Diskussion über den Bundeswehreinsatz gegeben. In Übereinstimmung mit dem Grundsatzprogramm lehnt die Linksfraktion ja regelmäßig und geschlossen Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Bei dieser Bundestagsentscheidung wurde jedoch die bisherige Linie verlassen. „Abgeordnete des Reformerflügels fordern mehr Pragmatismus. Sie halten den Einsatz für richtig, weil es sich um eine Abrüstungsmission handelt. Auch Fraktionschef Gregor Gysi steht dem Reformkurs offen gegenüber. Er wollte erreichen, dass sich die Fraktion geschlossen enthält, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Vertreter des linken Parteiflügels um die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hatten klargemacht, sie würden mit Nein stimmen, weil sie eine weitere Militarisierung der Außenpolitik befürchteten. Letztlich stimmten fünf Abgeordnete der Linken mit Ja, die Mehrheit votierte aber gegen den Einsatz.“ (Spiegel online, 9.4.14)
In der SPD wurde dies als erster Schritt zu einem Lernprozess der Partei interpretiert. MdB Rolf Mützenich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, schrieb im linken Sammelband zur Außenpolitik: „Die Freigabe der Abstimmung war zumindest der allerkleinste Nenner, auf den sich die Linksfraktion einigen konnte. Immerhin stimmte die LINKE erstmals in Teilen für einen Auslandseinsatz der Bundeswehr.“ (Schäfer 2014, 233) Mützenich erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass dieser Beschluss einen Vorläufer im Jahr 2010 hatte, wo sich im Bundestag 25 Linke bei der Abstimmung über die Sudan-Mission unter UN-Flagge der Stimme enthielten und sich damit gegen den linken Flügel und dessen Vorwurf der Abweichung vom Grundsatzprogramm stellten. Der SPD-Politiker begrüßte im Sommer 2014 diese Aufweichung einer 'Verweigerungshaltung', die programmatisch bislang noch für die linke Partei gilt.
Was das Programmatische aber wert ist macht der Diskussionsband von Schäfer, in dem linke, grüne und sozialdemokratische Experten über Deutschlands Rolle in der Welt schreiben, schlagend deutlich. Das Resümee des Herausgebers lautet: Das Programm der Linkspartei muss einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis – auch auf dem Feld der Außenpolitik – nicht entgegenstehen. Also: Rot-Rot-Grün kann regieren. Die Linkspartei wird – wenn man sie denn lässt – außen- und sicherheitspolitische Aktionen, die sich aus Deutschlands gewachsener und von der Linkspartei prinzipiell anerkannter Verantwortung in der Welt (so Schäfer in seiner Einleitung, vgl. ebd., 7ff) ergeben, absegnen oder mittragen. Ob sie dafür ihr Programm ändern oder es nur neu interpretieren muss, kann sie frei entscheiden. Und diejenigen, die den neuen Kurs einschlagen wollen, haben volles Verständnis dafür, dass es auch Pazifisten in der Partei gibt, die sich somit weiter auf das „Alleinstellungsmerkmal Antikriegspartei“ berufen kann.
Literatur
- Peter Brandt/André Brie/Michael Brie/Frieder Otto Wolf, Für ein völlig neues Crossover – Die Wiederbelebung des linken Projekts. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 11, 2013.
- Jutta Ditfurth, Das waren die Grünen – Abschied von einer Hoffnung. München 2000.
- Uwe Franz, Wo bleibt die Friedenspädagogik oder wem gehört die Weltbevölkerung? In: Auswege, Juli 2014, www.magazin-auswege.de/tag/franz/.
- Ralf Fücks, Raus aus der Komfortzone – Deutschland auf dem Weg zu mehr internationaler Verantwortung? Rede vom 19. Juni 2014. Internationale Politik online, Nr. 6, 2014 (zeitschrift-ip.dgap.org/de).
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Das Elend des Pazifismus – Die Karriere von Kriegsgegnern zu gewissenhaften Militaristen. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1-2, 1996.
- Karl Held (und Redaktionskollektiv), Wie die Grünen den Pazifismus in den deutschen Militarismus überführen, für den sie Regierungsverantwortung tragen wollen. In: Gegenstandpunkt, Nr. 2, 1999.
- Ulrich Irion, Die Friedenskriegspartei – Wie die Grünen auf dem langen Marsch zur Eroberung des Ostens alle Eskalationsschritte mitgehen und gleichzeitig vor ihnen warnen. In: Junge Welt, 25. 7. 2014.
- Paul Schäfer (Hrsg.), In einer aus den Fugen geratenden Welt – Linke Außenpolitik: Eröffnung einer überfälligen Debatte. Hamburg 2014.
- Christian Schmidt, Wir sind die Wahnsinnigen – Joschka Fischer und seine Frankfurter Gang. Akt. TB-Ausgabe. München 1999.
- Hans Thie, Ökologische Gleichheit – Warum grün zu sein heute links sein bedeutet. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 10, 2013.
- Ludger Volmer, Die Grünen. Von der Protestbewegung zur etablierten Partei – eine Bilanz. München 2009.
- Franz Walter, Gelb oder Grün? Kleine Parteiengeschichte der besserverdienenden Mitte in Deutschland. Bielefeld 2010.
Linke Außenpolitik
In der Linkspartei wird über linke Außenpolitik diskutiert. Der Bielefelder Parteitag demonstriert Realismus, da man politikfähig werden will. Ein Sammelband des Ex-MdB Paul Schäfer („In einer aus den Fugen geratenden Welt“, Hamburg 2014) reflektiert programmatische Grundlagen. Dazu ein Kommentar von Sabrina Zimmermann.
Seit dem Jahresanfang 2014 – mit seiner Verschärfung des Ukraine-Konflikts und den allgemeinen Ansagen von Gauck, Steinmeier oder von der Leyen zur gewachsenen deutschen Verantwortung in der Welt – ist die militärische Dimension der deutschen Außenpolitik wieder zu einem Thema geworden, das die politische Öffentlichkeit intensiver beschäftigt (vgl. Decker 2014). Auch in der Linken ist einiges in Bewegung geraten, gehört die Angelegenheit doch zu den entscheidenden Hürden für eine rot-rot-grüne Option im Bund. Paul Schäfer, ehemaliger verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, stellte dazu am 17. September 2014 in Berlin gemeinsam mit Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) und Claudia Roth (Grüne) eine Publikation vor, die solche Hürden abbauen will. Ihr Titel ist parteipolitisches Programm: „In einer aus den Fugen geratenden Welt – Linke Außenpolitik: Eröffnung einer überfälligen Debatte.“ Eröffnet werden soll ja nicht eine Diskussion über das Thema Außenpolitik – dazu ließen sich bei PDS/LINKE die verschiedensten Statements finden –, sondern über eine strategische Umorientierung.
Diese Umorientierung ist in der Partei seit einiger Zeit in Arbeit. Der Bielefelder Parteitag vom Juni 2015 hat es wieder einmal dokumentiert (vgl. Wehr 2015). So bemühte man sich etwa beim Leitantrag zum Thema Ukraine-Konflikt darum, eine einseitige Verurteilung des Westens zu vermeiden, um keine allzu hohen Hürden für künftige Regierungsverhandlungen mit SPD und Grünen zu errichten. Der pazifistisch gestimmte Antrag „Frieden statt NATO“ wurde dagegen nicht behandelt. Der mit viel Lob bedachte scheidende Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi erklärte kurz vor dem Parteitag in einem Interview (taz, 30. 5. 2015), dass „sich unsere Partei strikt gegen Kriegseinsätze ausspricht. Wir könnten aber darüber reden, um welche es vor allem geht.“ Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow empfahl seiner Partei, „ihr Verhältnis zur Bundeswehr zu klären“ (RP-online, 4. 6. 2015). In dem Interview äußerte er u. a.: „Pazifismus ist nichts für Deutschland… Wir haben unter uns (in der LINKEN, Anm. d. A.) unser Verständnis von einer neuen Weltfriedensordnung noch nicht deutlich genug gemacht. Das interpretieren zu viele noch zu unterschiedlich. Wir sollten unser Verhältnis zur Bundeswehr klären. Unaufgeregt, ruhig und sachlich. Für mich ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee nötig, für mich sind die Standorte der Bundeswehr in Thüringen wichtig. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass die Bundeswehr schlechte Gewehre, schlechte Schiffe und schlechte Hubschrauber hat, aber als Landesverteidigungs- und nicht als Interventionsarmee.“ (Zur Realpolitik des Thüringer Ministerpräsidenten vgl. auch Decker 2015.)
Ramelow äußerte gleichzeitig Hochachtung vor jedem Pazifisten in der Partei. Und eine derartige friedliche Koexistenz hat ja ihre Vorteile: So kann die LINKE mit ihren beiden Flügeln, deren Auseinandersetzung das ernsthafte Bemühen um eine wirkliche Friedenspolitik dokumentiert, in Richtung rot-rot-grünes Bündnis marschieren, muss auch vorher keine Verhandlungspositionen preisgeben. Der Bielefelder Parteitag hat diesen Politikwechsel jedenfalls ins Visier genommen. Und parteipolitische Vordenker zeichnen eifrig am Bild eines entsprechenden „Neubeginns“ (vgl. Brandt u. a. 2015). Vertreter der drei Parteien SPD, Linke und Grüne streben die „Wiedergewinnung einer strukturellen 'linken' Mehrheit“ an; dafür müssten die Politiker „die Sprache der Gerechtigkeit, Solidarität und Demokratie, des Friedens und des behutsamen Umgangs mit der Natur“ wieder sprechen lernen (ebd., 88). Das ist übrigens die einzige Stelle in dem dreifach beglaubigten Aufriss eines Politikwechsels, die das Thema Frieden anspricht. Für die Autoren scheint der Streitpunkt, der ja sonst als wichtigste Hürde für eine rot-rot-grüne Koalition verhandelt wird, gewissermaßen schon geklärt. Ihr Hauptaugenmerk gilt der Frage wie man eine Sprache findet, die das gesellschaftliche Unten anspricht – und mitnimmt, nämlich hin zur Wahlkabine, der bedauerlicher Weise so viele Unterprivilegierte fernbleiben. Wie der gegenwärtige Diskussionsstand in der Linkspartei zum Thema Krieg und Frieden aussieht, gibt der Sammelband von Schäfer in repräsentativer Form wieder.
Eine Problemansage
Dass die Welt zur Zeit, wie der Linkspolitiker feststellt, „aus den Fugen gerät“, ist eine seltsame Ansage. Sie suggeriert, die Welt sei zuvor, etwa in den Jahrzehnten der Blockkonfrontation mit globalem Rüstungswettlauf, atomarer Vernichtungsdrohung und zahlreichen Stellvertreterkriegen, in stabiler Ordnung gewesen. Das Bild ist zwar absurd, ergibt aber Sinn, und zwar vom westlichen Ordnungs- und Aufsichtsstandpunkt aus. Für die transatlantische Führungsmacht der NATO und die ihr zugeordneten europäischen Großmächte wurde mit dem Jahr 1989/90 der alte, festgefügte Rahmen einer Orientierung auf den östlichen Hauptfeind hinfällig. Neue Konkurrenten tauchten auf, neue Konkurrenzlagen machten sich auch im Bündnis bemerkbar, so dass einiges in Unordnung geriet. Passender Weise wurde beim NATO-Gipfel vom Herbst 2014 die neue Einschwörung des Bündnisses auf den alten Feind Russland regelrecht als Behebung einer „Identitätskrise“ begrüßt (vgl. FAZ, 4.9.14).
Zudem beginnt der Ex-MdB sein Buch gar nicht mit einem Szenario der aus dem Ruder laufenden Weltprobleme, sondern gleich sachgemäß mit der politischen Rhetorik der deutschen Außenpolitik, die zum Jahresanfang 2014 „mit einem Paukenschlag“ (Schäfer 2014, 7), genauer gesagt: mit erneutem Nachdruck, Anspruch auf eine globale Führungsrolle anmeldete. Die Diagnose von Steinmeier und Co., die Welt sei eine Ansammlung von Krisenfällen, die „mehr deutsche Verantwortung“ herausforderten, nimmt Schäfer mit seinem Bild auf und ernst. Das ist die erste bemerkenswerte Leistung dieses Sammelbandes, in dem linke, grüne und sozialdemokratische Experten über Deutschlands Rolle in der Welt schreiben. Der Herausgeber teilt das deutsche Anspruchsdenken in Sachen Weltpolitik und unterschreibt die Rechtfertigung, man müsse Verantwortung für die Lösung der weltweiten Ordnungsprobleme übernehmen – jedenfalls im Prinzip, denn bei den Details, speziell bei der Frage nach dem Einsatz militärischer Gewalt, will sich der Linkspolitiker nach wie vor vom Mainstream absetzen, zumindest im Programmatischen. Das muss aber, wie er selber bemerkt, nicht viel heißen. Bei seiner Synopse „Rot-Rot-Grün-Programme: Konsens und Dissens – eine andere Politik ist möglich“ hält er gleich eingangs fest: „dass a) die jeweiligen Programmabschnitte nicht identisch damit sein müssen, wie die Parteien in ihrer Gesamtheit 'ticken', und b) dass die formulierten Programmatiken und die tatsächliche Politik nicht deckungsgleich sind.“ (Ebd., 250) Eine interessante Mitteilung in einem Band, in dem sich die Autoren programmatisch äußern (sollen)!
Bedenken Schäfers richten sich darauf, dass es bei dem außenpolitischen Aufbruch „um neudeutsches Großmachtgehabe“ (ebd., 7) gehen könnte. Klar sei nämlich bei der Anmeldung der neuen deutschen Ansprüche, „dass es sich um Machtverhältnisse und Machtverschiebungen in Europa handelt. Die drängende Frage lautet: Soll jetzt ökonomische Stärke in mehr politische Stärke umgemünzt werden?“ (Ebd., 9) Das Vorhaben an sich erscheint Schäfer aber nicht bedenklich. Er teilt die Gauck'sche Beurteilung, dass sich (West-)Deutschland seit der Nachkriegszeit einer „Kultur der Zurückhaltung“ befleißigt habe (vgl. ebd., 18), es sei bislang „'niedriges Profil' angesagt“ gewesen (ebd., 9). Das hält der Linkspolitiker allen Ernstes dem ehemaligen hochgerüsteten NATO-Frontstaat BRD zugute, der, eingebunden ins größte Kriegsbündnis aller Zeiten, jahrzehntelang als Speerspitze einer Vorwärts- bzw. Vorneverteidigung fungierte, die ab Ende der 70er Jahre, übrigens auf Antrag eines sozialdemokratischen Kanzlers, zum Terrain einer nuklearen Nachrüstung ausgebaut werden sollte – ein Vorgang, der immerhin in den 80er Jahren die Massendemonstrationen einer Friedensbewegung gegen das atomare Schlachtfeld Deutschland auslöste. Die Eröffnung eines zweiten, europäischen, vornehmlich deutschen Frontabschnitts, der die Erstschlagsfähigkeit des Westens durch die Schließung aller Rüstungslücken und durch einen möglichen Enthauptungsschlag gegen Osten wiederherstellen sollte, alarmierte zwar die Bevölkerung, aber nicht die Politik. Dort war von Zurückhaltung nichts zu spüren. Dass es nicht zum Schlagabtausch kam, verdankte sich dem zurückhaltenden Agieren der anderen Seite und schließlich Gorbatschows Verabschiedung aus dem Rüstungswettlauf.
Das zweite Bemerkenswerte ist, dass Schäfer die Bedenken bewusst klein hält. Er zitiert zwar die Sorgen bezüglich „einer hegemonialen Stellung Deutschlands“ (ebd., 10). „Doch“, fährt er fort, „dass nun die alten deutschen Großmachtambitionen wiederbelebt werden sollen, ist bis dato nicht zu belegen.“ Zu belegen ist in seinen Augen vielmehr eine verbreitete Friedfertigkeit der Bevölkerung laut Infratest-Umfrageergebnissen vom April/Mai 2014. „Es ist offenbar hilfreich, das Volk zu befragen.“ (Ebd., 11) Daraus ergebe sich nämlich „der konstruktive Hinweis: Deutschland kann und sollte mehr für eine friedliche, demokratische und nachhaltige Entwicklung in der Welt tun!“ (Ebd.) Ein Meinungsbild vom Frühjahr 2014, in dem sich anlässlich der Ukraine-Krise die Verunsicherung über den deutschen Erfolgsweg, die auch die politische Klasse beschäftigt, niederschlägt und ihre Kreise zieht, soll als Auftrag zu einer neuen friedlichen Außenpolitik verstanden werden – und das bei einer Wahlbevölkerung, die ein halbes Jahr zuvor die Entscheidungshoheit über die internationale Rolle Deutschlands in die Hände der Politiker gelegt hatte, die im Innern und Äußern möglichst anspruchsvoll durchregieren wollen.
Die Stimmungslage der Bevölkerung steht bei Schäfer aber für etwas anderes. Dass die Welt aus den Fugen gerät, ist gewissermaßen ein Bild für das eigentliche Thema, dass nämlich in Deutschland die schwarz-rote Koalition aus den Fugen geraten könnte. Eine Mehrheit beim Wahlvolk wäre dafür in Sicht. Aber wollen es auch die Sozialdemokraten und die Grünen? Im Prinzip ja, meint Schäfer und ist damit bei dem, was ihn wirklich interessiert, bei der Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition. Der entscheidende Anhaltspunkt ist für ihn der Beschluss des SPD-Parteitags vom November 2013, „dass man für die Zukunft auch im Bund keine Koalition grundsätzlich ausschließen wolle.“ (Ebd.) Zwar ist durch den Verlauf der Ukraine-Krise Schäfers Hoffnung, dass sich diese Möglichkeit realisieren ließe, schwer gedämpft worden. Aber im Blick auf das Wahljahr 2017 will er doch daran festhalten: „Ein Regierungswechsel gibt nur Sinn, wenn es um einen 'Richtungswechsel auf neuer Grundlage' geht. Und gerade deshalb ist es notwendig, dass das Feld für ein anderes Regierungsbündnis längerfristig bereitet wird.“ (Ebd., 12)
So geht der Einstieg Schäfers in die „Eröffnung einer überfälligen Debatte“, und das erlaubt ein Zwischenfazit. Was heißt hier „drängende Weltprobleme“? Den Ausgangspunkt bildet der weltpolitische Aufbruch der deutschen Politik unter der großen Koalition, das Drängende ist also der Führungsanspruch, der von Deutschland für Europa und darüber hinaus angemeldet wird. Den nimmt der Linkspolitiker ganz unaufgeregt zur Kenntnis. Grund zur Kritik daran, was der Inhalt dieses Programms ist und worauf es hinausläuft, hat er erst einmal nicht. Wegen möglicher hegemonialer Bestrebungen oder eines unpassenden Politikstils („Großmachtgehabe“) könnten zwar Sorgen aufkommen, der Sache nach handele es sich aber um einen offenen Prozess, der auch ganz anders zu gestalten wäre – ließe man nur die Linken im Bund mitregieren.
Eine Grundlegung
Das Konzept einer neuen Außenpolitik wird von Schäfer im Folgenden erläutert, wobei, kurz gesagt, die Sprachregelungen, wie man sie von den etablierten Parteien kennt, als linke Diagnose präsentiert werden. Die Beschönigungen des offiziellen Globalisierungsdiskurses finden sich hier wieder: Die Welt wächst zusammen, die Informationsströme der modernen Kommunikationsindustrie rasen um den Globus etc. „Man kann es auch in einem Satz sagen: Außenpolitik (Internationale Politik) ist heute Weltpolitik.“ (Ebd., 14) Oder: „Außenpolitik (Internationale Politik) ist heute immer auch Gesellschaftspolitik.“ (Ebd.) Bevor Schäfer jedoch dazu kommt, die „normativen Grundlagen linker Außenpolitik“ zu benennen, befasst er sich noch eigens mit den „Determinanten“, die jeder deutschen Außenpolitik zu Grunde liegen sollen, also auch den Gestaltungsspielraum linker Politik definieren. Dazu gehören die geopolitische Mittellage und die Prägung durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zu Letzterem gelingt Schäfer die rekordverdächtige Stilblüte: „Die Schatten von Hitler, Auschwitz und zweier Weltkriege sind verdammt lang.“ (Ebd., 18) So sieht das Gauck wahrscheinlich auch, wenn er sich abends an der Hotelbar einmal gehen lässt. Die geschichtspolitische Legende, dass auf der Bundesrepublik das schwere Erbe von Auschwitz laste, wird allen Ernstes nachgebetet. Dem westdeutschen Staat, der nach seiner Gründung kein Jahr zögerte, eine Remilitarisierung in Gang zu setzen und sich für den nächsten, den dritten Weltkrieg (gegen den vormaligen Hauptfeind im Osten) zu rüsten, wird im Stil der offiziellen Lügen militärische Zurückhaltung attestiert.
Dass der ehemalige Kriegsverlierer bei seiner Integration ins westliche Bündnissystem und bei seinem Aufstieg als europäische Großmacht zu einer Art schuldbewusstem Nationalismus gezwungen war, dass ihm seine Militärmacht als Teil eines Bündnisses zugestanden wurde und nicht von vornherein als Ausdruck „nationaler Selbstbehauptung“ galt (wie es heute deutsche „Verteidigungs“-Experten formulieren), dass er sich, wie die anderen europäischen Mächte auch, als Frontabschnitt in der von der US-Führungsmacht gegen Osten aufgemachten Hauptkampflinie aufstellen musste und sich in der Konkurrenz mit den europäischen Rivalen, gemessen an diesem Hauptziel, nicht störend betätigen durfte – all das gilt als eine Läuterung, die Schäfer der Nation, den Regierenden wie den Regierten, gutschreibt. Wie gesagt, im Prinzip, denn es könnte auch aus all dem wieder neues „Großmachtgehabe“ entstehen, wenn nicht endlich die Linken in einem neuen Regierungsbündnis zum Zuge kommen. Dessen Außenpolitik wäre nämlich etwas ganz anderes, wie Schäfer in seinem Sammelband vorab – jenseits der speziellen Akzente, die dann die Vertreter der einzelnen Parteien setzen – festhält.
Absurderweise beginnt Schäfer seine Skizze der „normativen Grundlagen“ mit einem Rekurs auf das Manifest der Kommunistischen Partei und dessen Appell „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“. (Marx schrieb natürlich „euch“ – man darf auf die nächste Revision gespannt sein: vielleicht „Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen“?) Absurd ist der Bezug deshalb, weil Schäfer den alten Aufruf dazu, die nationalen Unterschiede für unerheblich zu erklären und statt dessen den sozialen Gegensatz von Oben und Unten, von Kapital und Staat auf der einen Seite und der arbeitenden Bevölkerung auf der andern, in den Mittelpunkt zu rücken, überhaupt nicht teilt. Sein Ausgangspunkt ist gerade der Anspruch des deutschen Staates, die nationale Macht, über die er verfügt, außenpolitisch, weltpolitisch, in den internationalen Beziehungen zu betätigen, und Schäfer ist daran interessiert, diesem Programm eine humane, friedliche oder sonstwie wohlklingende Fassung zu geben. Es ist also das genaue Gegenteil von dem, was Marx und Engels mit ihrem Manifest ins Auge fassten.
Nach der pflichtgemäßen Verneigung vor der internationalistischen Tradition der sozialistischen Parteien kommt Schäfer dann auch gleich auf seinen eigentlichen Bezugspunkt zu sprechen: auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also auf die Programmpunkte der bürgerlichen Revolution. „Dieses Programm ist bis heute uneingelöst“ (ebd., 20), heißt es dazu, und seine Einlösung habe sich die Linkspartei auf ihre Fahnen zu schreiben. Schäfer geht es um die Menschenrechte, auf die sich der bürgerliche (im Kommunistischen Manifest noch als der Garant der Klassenherrschaft dingfest gemachte) Staat beruft, deren Durchsetzung er zum Nonplusultra menschlichen Zusammenlebens idealisiert und deren Geltung in den Zentren des demokratischen Kapitalismus nichts anderes als das reibungslose Funktionieren einer modernen Geldwirtschaft garantiert. Sie sollen aber nicht in dieser alt- oder neoliberalen Funktion aufgehen, so die Ansage des Linkspolitikers, sondern – endlich! – in ihrer idealen Form realisiert werden. Bei dieser Berufung auf die Höchstwerte aus dem bürgerlichen Emanzipationsprozess kommt nichts anderes zustande als der übliche Menschenrechtsidealismus, den die deutsche Politik sowieso tagein tagaus beschwört: Es geht um die Installierung einer „gerechteren Weltwirtschaftsordnung“ (ebd., 21), darum, sich „in die internationale Gemeinschaft einzubringen“ (ebd.), „der UN kommt eine Schlüsselrolle zu…: Beseitigung der Armut, Gleichstellung der Frau, Durchsetzung der weltbürgerlichen Rechte“ (ebd.). Undsoweiter.
Schäfer arbeitet sich sogar – wenn auch auf gewundenem Wege – bis zum Verständnis für die neue, von den USA lancierte Auslegung der UN-Charta als menschenrechtliche Schutzverantwortung („Responsibility to protect“ – R2P), vulgo Menschenrechtsimperialismus, vor. Im Namen der Menschenrechte wurden und werden bekanntlich von imperialistischen Staaten Kriege geführt, das muss auch Schäfer konstatieren. Das sei ein Missbrauch dieser Idee für „hegemonial-kapitalistische Einflussnahme“ (ebd., 22), hier würden Menschenrechtsverletzungen zum Vorwand für „bellizistische“ Maßnahmen gemacht. Aber: „Wenn man die Dinge vom Ende her bedenkt, müsste klar sein, dass die Menschenrechte nicht dem Gewaltverbot untergeordnet werden dürfen.“ (Ebd.) Beleg dafür soll der amerikanische Bürgerkrieg sein, der zur Befreiung der Sklaven geführt worden sei, wobei sich Schäfer nicht entblödet, auf Lincoln, wie er „im gleichnamigen Film zitiert“ wird (nämlich in dem Polit-Rührstück von Steven Spielberg), zu verweisen…
Man mag sich nun denken, das sei eine klare Aussage – Menschenrechte brauchen notfalls Gewalt, sie stehen über dem Gewaltverbot –, doch es bleibt nicht dabei: „Umgekehrt gilt auch: Menschenrechte können nicht durch noch größere Menschenrechtsverletzungen durchgesetzt werden.“ (Ebd.) Eine überraschende Einschränkung, da doch gerade Lincoln mit seinem Bürgerkrieg, einem der ersten modernen, „totalen“ Kriege des industrialisierten Zeitalters mit seinen gnadenlosen Zerstörungsakten, als Beleg dafür aufgeboten wurde, dass Gewalt im Namen der Menschenrechte rücksichtslos eingesetzt werden darf. Das soll jedoch nicht so stehen bleiben, es wird eine ausweglose Situation konstatiert: „Wir haben es also mit einem schwerwiegenden Zielkonflikt zu tun, einem Dilemma, dem man nicht entgehen kann“ (ebd.). Wenn es sich um ein (völker-)rechtliches Dilemma handelt, wäre zu erwarten, dass die angesprochene Relativierung des Gewaltverbots, also die Zulassung von Gewalt im Namen der Höchstwerte, nicht zustande kommt, dass sie als praktische Maxime ausfällt. Dem ist aber – eine neue Wendung – nicht so, aus dem Dilemma ergibt sich nur eine angespannte Situation: „Dieses Spannungsverhältnis hat sich auch in der Entwicklung des Völkerrechts abgebildet – indem es der legitimen Gewaltanwendung möglichst enge Grenzen setzt, sie aber nicht kategorisch ausschließt.“ (Ebd.) Das Dilemma lässt sich also ganz locker beseitigen, wenn man sich nämlich bei der Gewaltanwendung an bestimmte Grenzen hält bzw. zu halten verspricht. Doch das ist auch wieder nicht das letzte Wort, denn es folgt eine neue Zurücknahme der völkerrechtlichen Ausnahme, zumindest im Allgemein-Programmatischen: „Dabei sollte kein Zweifel daran bestehen, dass sich Linke immer als Bewegung gegen Krieg und Militarismus verstehen müssen.“ (Ebd.)
Als Referenz für diesen linken Gestaltungswillen wird dann – etwas unvermittelt – das Zeugnis der christlichen Kirchen in Deutschland für einen gerechten Frieden angeführt, also der Institutionen, die mit ihrer Militärseelsorge, kriegsethischen Unterweisung („bellum iustum“), Politikberatung etc. die deutsche Militärpolitik seit den Anfangsjahren konstruktiv begleiten. „Auf dieser Grundlage“, heißt die erstaunliche Fortsetzung, „kann man die Wesensmerkmale linker Außenpolitik bestimmen: Gerechtigkeit – die die freiheitlichen und sozialen Menschenrechte umfasst; Frieden mit friedlichen Mitteln; internationale Solidarität, um diese Ziele zu erreichen, aber auch als Ziel selbst.“ (Ebd., 22f) Also irgendwo zwischen Gauck und Käßmann, wertebasiert im Sinne der Ideale, wie sie alle Parteien kennen und in ihren Sonntagsreden feiern, aber eingedenk sozialistischer Traditionen von vorgestern hat man sich die Grundlagen der Linkspartei vorzustellen.
Eine Sammlung
Was in dem Band folgt ist eine Sammlung politischer und politikwissenschaftlicher Statements zur internationalen Politik und zum Globalisierungsdiskurs. Michael Brie (Die Linke) versucht sich an einer Epochenbestimmung der Gegenwart – eine eher feuilletonistische Randnotiz. Peter Wahl (WEED) rekapituliert Erfahrungen mit dem Konzept der Global Governance. Es ist zwar, so der Autor, gescheitert, könnte aber einiges zu denken geben. MdB Frithjof Schmidt (Grüne) informiert über TTIP, mehrere Beiträge widmen sich der Rolle der UN oder der EU; auch die Chancen, die die Zivilgesellschaft bieten soll, kommen nicht zu kurz. Leitmotiv ist dabei die Hoffnung, dass sich mit einer wirklich multilateral agierenden UN die Weltprobleme lösen ließen. Dafür müsste allerdings, so der Politikwissenschaftler Jochen Hippler, „die selektive Instrumentalisierung oder Ignorierung der Vereinten Nationen“ (ebd., 75) durch die USA unterbunden werden; nur dürften die Chancen dafür schlecht stehen, denn den mächtigen „westlichen“ Staaten gehe es eher nicht um Werte, sondern um die Durchsetzung ihrer Interessen.
Der Beitrag der Politikwissenschaftler Lothar Brock und Silke Weinlich beschwört ebenfalls die UN als Rahmen für „eine Weltordnung mit verlässlichen Regeln“ (ebd., 85): „Dass in den internationalen Beziehungen nicht mehr die Macht des Stärkeren gelten, sondern das Recht regieren sollte, kann als Kernanliegen einer aufgeklärten internationalen Politik gelten.“ Dem folgt jedoch die Mitteilung auf dem Fuße, dass die Vereinten Nationen den Rahmen dafür gerade nicht bieten. Realiter „bleibt die Weltorganisation in ihrer jetzigen Form hinter den Erfordernissen zurück, die sie in Bezug auf kollektives Handeln, als multilateral legitimierter Akteur und als Garant der regelbasierten Weltordnung erfüllen müsste.“ (Ebd., 95) Sie leide an überkommenen Machtverhältnissen, was aber durch ein stärkeres deutsches Engagement zu beheben wäre: „Das Plädoyer für die Übernahme von mehr internationaler Verantwortung, das die neue Bundesregierung und der Bundespräsident auf der Münchner Wehrkundetagung 2014 ausgesprochen haben, ist in diesem Rahmen hoch willkommen. Die Frage ist, wie solche Verantwortung gefüllt wird.“ (Ebd., 95f) Sie müsste natürlich, so die beiden Autoren, mit zivilisierendem, humanisierendem Inhalt gefüllt werden. Deutschland figuriert dabei als wahrer Anwalt des Multilateralismus; es könne diese Aufgabe zwar nicht allein bewältigen, aber mit kleinen Schritten die UN in die richtige Richtung steuern. Die Autoren schlagen dazu allen Ernstes „hochrangige Teilnahme von MinisterInnen und der Kanzlerin an relevanten UN-Veranstaltungen“ (ebd., 96) vor. Doch selbst die Idealisierung des deutschen Einsatzes für die Völkerfamilie findet zum Realismus von Gauck und Co. zurück, dass nämlich als letztes Mittel auch militärische Gewalt geboten sei: „Die zivile Konfliktaustragung muss Vorrang haben. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es zu Situationen kommt, in denen ein militärisches Eingreifen verhältnismäßig sein kann. Dann kann eine glaubwürdige multilaterale Politik auch bedeuten, dass sich Deutschland an einem derartigen militärischen Einsatz beteiligen muss.“ (Ebd., 97)
Denselben Gedanken, den andere Autoren auf die UN beziehen, exerzieren der Staatsrechtler Andreas Fisahn am Beispiel der EU oder der Linkspolitiker Stefan Liebich an der KSZE/OSZE durch. In Wirklichkeit, so Fisahn, ist die EU ein neoliberales Projekt, „Europa in seiner gegenwärtigen Verfassung ist Teil des Problems“ (ebd., 157), das muss aber nicht so bleiben. Man müsste nur endlich etwas Anderes daraus machen. Die Formel dafür heißt: „Europa neu begründen.“ (Ebd., 159) Diese eigentlich anstehende Aufgabe wird freilich gleich relativiert, denn der Wissenschaftler fügt die Bemerkung an: „Gegenwärtig gilt es allerdings, vorrangig Kräfte zu bündeln, die dem Umbau der EU durch eine autoritäre Wirtschaftsregierung Einhalt gebieten.“ (Ebd.) Die Neubegründung ist also erst einmal zurückgestellt, momentan geht es eher darum, den Status quo zu erhalten und die neoliberale EU vor einer drohenden weiteren Verschlechterung ihrer Verfassung zu schützen. Liebich präsentiert mit derselben Dialektik die KSZE, die einerseits eine großartige Chance zur Zeit des Ost-West-Gegensatzes dargestellt habe, aus der andererseits nichts geworden sei. Im Blick auf die OSZE-Charta von 1990 stellt er fest, dass in der heutigen Weltlage „vom Geist dieser Charta nicht mehr viel zu spüren“ sei (ebd., 165). Statt dessen gebe es „Kalter Krieg Reloaded“ (ebd., 166).
Auf den letzten 100 Seiten der Publikation, auf denen die Parteivertreter und -experten schreiben, wird dann das eigentliche Thema angepackt: Gibt es realistische Chancen für eine rot-rot-grüne Koalition im Bund? Ist nicht die Außenpolitik von vornherein die Sollbruchstelle eines Regierungsbündnisses? Dazu Marius Müller-Henning von der Friedrich-Ebert-Stiftung: „Außen- und Sicherheitspolitik werden regelmäßig als Haupthindernisse für eine rot-rot-grüne Koalition gesehen. Dies nicht ohne Grund, doch die Skeptiker bei Grünen, LINKEN und SPD müssen sich eine grundlegende Frage stellen: Fokussieren sie sich zu sehr auf die Fallstricke und vernachlässigen die Chancen einer progressiven Friedenspolitik?“ (Ebd., 173) Der sozialdemokratische Experte will die Chancen herausstellen, und im Prinzip pflichten ihm alle Autoren bei. Eine rot-rot-grüne Gemeinsamkeit existiert auch auf diesem Feld, der Streit um die Militäreinsätze soll eine eher untergeordnete Bedeutung haben. Müller-Henning: „Neben der allgemeinen Orientierung aller drei Parteien an den übergreifenden Werten 'Frieden' und 'internationale Solidarität' stechen hier vor allem das Primat der Vereinten Nationen, die Betonung des Präventionsgedankens und der zivilen Form der Konfliktbewältigung ins Auge.“ (Ebd., 174) Heidemarie Wieczorek-Zeul kann es auch kürzer: „'Gegen Krieg' sind wir alle – in der Tradition Willy Brandts.“ (Ebd., 193) Die Linkspartei müsse sich nur noch bereit finden, die nötigen Militäreinsätze – natürlich immer als letztes Mittel und wenn sich eine völkerrechtliche Legitimation dafür finden lässt – mitzutragen.
Der Sammelband zeigt unübersehbar, dass die Bereitschaft dazu bei der Linkspartei existiert. MdB Stefan Liebich demonstriert dies durch seine formal korrekte Bezugnahme auf das linke Grundsatzprogramm, das dieser Bereitschaft an sich entgegen steht. Im Programm heißt es: „Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem…“ (zit. nach Liebich, ebd., 171) Dazu merkt Liebich an: „Bewusst haben wir uns nicht zu einem Austritt aus kollektiven Sicherheitssystemen entschieden. Dass Deutschland sich nicht wieder isoliert, ist nicht nur eine Lehre aus der schrecklichen Vergangenheit…, sondern auch eine sinnvolle Antwort auf Fragen, die die globalisierte Welt heute stellt.“ (Ebd., 171) Solange kein neues Sicherheitssystem existiert, wird sich also auch eine Linke mit der vorläufigen 'Sicherheitsarchitektur', wie sie im Westen vorliegt, abfinden müssen. Eine „europäische Streitmacht“ (ebd., 172) ist sowieso Teil der europäischen Vision, die Liebich aus der sozialistischen Tradition schöpft. Man kann sich also einen langwierigen Diskussionsprozess mit SPD und Grünen vorstellen, wie dieser Aufbau eines neuen Sicherheitssystems (das ja auch in den beiden Parteien seine Anhänger hat) aussehen soll.
Den Part, hartnäckig auf der linken Programmatik zu bestehen, übernehmen in dem Sammelband der Linkspolitiker Jan van Aken und seine Mitarbeiterin Maria Oshana. Aber sie tun dies, nachdem sie erst einmal Zustimmung signalisiert haben: „Auch wir finden, dass Deutschland Verantwortung übernehmen muss, ganz besonders für das eigene globale Handeln.“ (Ebd., 217) „Deutschland sollte Verantwortung übernehmen – für eine gerechte Weltordnung, für die Durchsetzung der individuellen Menschenrechte, für Abrüstung, für eine ressourcenschonende Wirtschaftspolitik, für den Schutz des Klimas, für eine friedliche globale Entwicklung. Wenn von der Leyen, Steinmeier, Gauck und Co. von Verantwortung in der Welt sprechen, sprechen sie aber genau darüber nicht. Mit Übernahme von Verantwortung ist bei ihnen vor allem der Griff zu den Waffen gemeint.“ (Ebd., 218) Der Unterschied zu Gauck und Co. ist minimal, auf der programmatischen Ebene ist er gekünstelt. Denn der Präsident und die große Koalition, deren Vertreter in dem Sammelband unverdrossen ihre friedenspolitischen Ideale ausbreiten, wollen im Namen der von allen geteilten Ideale die Welt gestalten und nicht permanent Krieg führen. Die Differenz liegt – noch – bei der Entscheidung für Militäreinsätze, im Rahmen der UN-Charta oder von R2P. „Eine gemeinsame rot-rot-grüne internationalistische Friedenspolitik ist derzeit nicht in Sicht. Zu groß sind die Differenzen in der zentralen Frage des Einsatzes von Gewalt als Mittel der Politik. Wir sagen: Friedenspolitik braucht Gewaltverzicht.“ (Ebd., 227) So das Resümee der beiden Autoren – es ist aber nicht das letzte Wort. Da sie in puncto Verantwortungsübernahme viel Gemeinsames sehen, bieten sie einen Lern- und Diskussionsprozess an und entdecken Gebiete, auf denen sich „LINKE, Grüne und SPD gemeinsam für eine Frieden fördernde Weiterentwicklung des Völkerrechts einsetzen“ können (ebd.).
Ein Fazit
Aus diesem Angebot des außenpolitischen Sprechers der Linkspartei zieht Schäfer dann abschließend das Fazit: Ja, es gibt Differenzen, das will er nicht verschweigen. Aber es überwiege das Gemeinsame. Dafür wird auch noch einmal der analytische Teil des Sammelbandes rekapituliert. Grundtenor: Deutschlands Rolle in der Welt ist zunehmend gefragt, „die globalen Zwänge zur Regulation und Kooperation nehmen zu.“ (Ebd., 241) Zwar gehe es ziemlich wüst auf dem Globus zu, aber „Pauschalurteile helfen nicht weiter.“ (Ebd., 244) Soll heißen: Bei den Aktivitäten der NATO oder im Namen der UN gibt es viel zu kritisieren, aber man soll die Möglichkeit, hieraus etwas friedenspolitisch Wertvolles zu machen, nicht pauschal ablehnen. Dasselbe gilt für die EU. Und wenn man dann noch die Potenziale der Zivilgesellschaft hinzudenkt, ergeben sich lauter erfreuliche Perspektiven. Die GASP und eine „kohärente Friedensstrategie der EU“ (ebd., 248) müssten weiter entwickelt werden. „Gesprochen werden muss über eine Gemeinsame Verteidigung“ (ebd.), wie überhaupt die Landesverteidigung als Selbstverständlichkeit abgehakt ist (vgl. ebd., FN 8). Der eigentliche Konflikt besteht nur noch darin, wie Deutschland seine militärische Rolle auf dem Globus gestalten soll. Hier identifiziert Schäfer drei Dissens-Punkte, die aber alle nicht dem Einstieg in eine rot-rot-grüne Koalition entgegen stehen sollen.
Der erste Punkt betrifft R2P, also Kriegsführung im Namen der internationalen Schutzverantwortung. Die linken Bedenken werden darauf reduziert, dass sich der Einsatz von Gewalt zum Schutz der Bevölkerung vor Menschenrechtsverletzungen – d. h. der Angriff auf einen anderen Staat im Namen einer humanitären Zielsetzung – missbräuchlich auf diese Legitimation berufen könnte. Dieses Bedenken, so Schäfer, sei auch Thema der unabgeschlossenen Debatte in der UNO und werde speziell von den Grünen geteilt. (In der Tat kennt auch die NATO dieses Bedenken: Im Falle von Putins Einsatz zum Schutz der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine gab es die heftigsten Entlarvungen dieser Legitimation.) Die Linken artikulieren demnach einen konstruktiven Gedanken, der die noch offene Diskussion um R2P voranbringen könnte. R2P ist also im Grunde kein Dissens-Punkt mehr, sondern ein Thema, zu dem auch die Linke etwas beizusteuern hat.
Der zweite Punkt ist das Verhältnis zur NATO. Ja, die „Linke plädiert dafür, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen der NATO austritt. Dies ist freilich eher als 'weiches Kriterium' formuliert. Es ist keine Vorbedingung für den Eintritt in eine Regierung.“ (Ebd., 258f) Die Auflösung der NATO ist ein Fernziel, die Realisierung der Forderung ein langwieriger Prozess, der sich erst einmal mit der Mitgliedschaft in diesem Bündnis abzufinden habe. Schäfer nimmt so die Vorlage von Liebich auf, der zwischen Auflösung und Austritt unterscheidet. „Die Perspektive der Bündnisauflösung und dessen Ersetzung durch neue kollektive Sicherheitsstrukturen soll durch die Auseinandersetzung innerhalb der NATO, die sich ja auch als politische Gemeinschaft versteht, vorangetrieben werden“ (ebd., 259), schlussfolgert er. Auflösung per Mitmachen heißt also die Devise. „Außerdem: Wer Widerspruch zu illegitimen Gewaltinterventionen der NATO anmelden möchte…, wird das ernsthaft nur als Vollmitglied tun können.“ (Ebd.)
Drittens bleiben noch die grundsätzlich abgelehnten deutschen Militäreinsätze, wie gesagt im Ausland, denn die Existenz einer Bundeswehr oder einer europäischen Streitmacht zur Landes- bzw. Bündnisverteidigung ist kein Streitthema mehr. Schäfer zitiert die Ablehnung seiner Partei. Aber: „Ist jeder Militäreinsatz als Krieg zu bezeichnen?“ (Ebd.) Nein, heißt die Antwort, jeder Einsatz ist anders, man muss also zur Einzelfallprüfung schreiten und sich von Pauschalurteilen verabschieden. „Damit ist mitnichten gesagt, dass sich politisch nur eine Seite bewegen müsste. Im Gegenteil: Die Grundsatzkritik der LINKEN am militärischen Interventionismus hat ihre Berechtigung und zwingt die anderen Parteien immer wieder, ihre Haltung zu überdenken. Aber: Ohne eine grundsätzliche Bereitschaft zur Einzelfallprüfung wird eine ja durchaus notwendige Debatte über die Neubestimmung der der deutschen Militärpolitik schwerlich zustande kommen.“ (Ebd., 261)
Also: Rot-Rot-Grün kann regieren. Im Programmatischen, „sofern es um das Wort geht“ (ebd., 263), seien die drei Parteien ziemlich nah beieinander. Die „Militärfrage“ muss sich, so Schäfer, hier nicht störend bemerkbar machen. „Ausgangspunkt einer Regierungsalternative muss ein alternatives Programm sein. Das heißt nicht, dass mit einer solchen Veränderung alle Grundkonstanten deutscher Außenpolitik in Frage gestellt werden sollen. Niemand kann die gewachsenen Bündnisbeziehungen … aufs Spiel setzen wollen.“ (Ebd., 263f) Und überhaupt gilt ja die oben erwähnte Relativierung der programmatischen Ebene, die laut Schäfer nicht mit der wirklichen Parteipolitik übereinstimmen muss. In diesem Sinne sekundiert auch der SPD-Politiker Rolf Mützenich seinem linken Kollegen. Befürworter eines links-grünen Bündnisses wüssten eben, „dass in der (Regierungs-)Politik Pragmatismus im Zweifelsfall vermeintlich eherne Leitlinien sticht.“ (Ebd., 228) Er kennt ferner das Argument, „dass eine Regierungsbeteiligung der LINKEN, wie damals auch bei Bündnis 90/Die Grünen, in der Außenpolitik jenen Realitätsschock bescheren würde, den sie bei ihren Regierungsbeteiligungen in den Ländern bereits bei der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erleben musste.“ (Ebd., 238) In puncto Anfälligkeit für Realitätsschocks kann der Sozialdemokrat Mützenich – gerade im Gedenkjahr 2014 – natürlich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken, seine Partei hat die Verabschiedung vom „Vulgärpazifismus“ (ebd., 235) immerhin schon hundert Jahre hinter sich. Schockierend dürfte allerdings für linke Friedensfreunde die von Schäfer und Co. signalisierte Bereitschaft sein, alle aus der Grundorientierung ihrer Partei abgeleiteten antimilitaristischen Positionen zur Diskussion zu stellen – und für die Bereitschaft zum Mitmachen nur zu fordern, dass man mit den Koalitionären in spe interessante Diskussionen über die Ausgestaltung des Programms „Mehr deutsche Verantwortung“ führen möchte.
Schäfers Bekenntnis dazu, „dass sich Linke immer als Bewegung gegen Krieg und Militarismus verstehen“ (ebd., 22), muss dabei nicht gelogen sein. Gerade der anvisierte Koalitionspartner Bündnis 90/Grüne hat es 1999 als „Friedenskriegspartei“ (vgl. Irion 2014) mustergültig vorgeführt, wie man sich zum Grundwert Gewaltlosigkeit bekennt und gleichzeitig, wenn es geboten ist, das deutsche Militär aufs Schlachtfeld kommandiert.
Literatur
- Peter Brandt/André und Michael Brie/Frieder Otto Wolf, Von unten sieht man besser: Für einen linken Neubeginn. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 7, 2015, S. 81-88.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Osterspaziergang … reloaded. In: Gegenstandpunkt, Nr. 3, 2014, S. 32-35.
- Peter Decker (und Redaktionskollektiv), Der erste LINKE-Ministerpräsident wird gewählt – Drei Botschaften über Wählen und Regieren im demokratischen Rechtsstaat. In: Gegenstandpunkt, Nr. 1, 2015, S. 121-124.
- Ulrich Irion, Die Friedenskriegspartei – Wie die Grünen auf dem langen Marsch zur Eroberung des Ostens alle Eskalationsschritte mitgehen und gleichzeitig vor ihnen warnen. In: Junge Welt, 25. 7. 2014.
- Paul Schäfer (Hrsg.), In einer aus den Fugen geratenden Welt – Linke Außenpolitik: Eröffnung einer überfälligen Debatte. Hamburg 2014.
- Andreas Wehr, Ein bisschen Frieden. In: Junge Welt, 4. 6. 2015.
- Andreas Wehr, „Trübe Brühe“. In: Junge Welt, 8. 6. 2015.